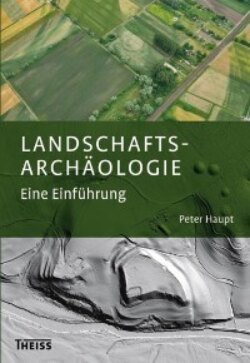Читать книгу Landschaftsarchäologie - Peter Haupt - Страница 14
1.4 Kulturlandschaftsgenese
ОглавлениеUnter der Bedingung, der Mensch als kulturschaffendes Wesen und die Gesamtheit der übrigen Natur seien trennbar – menschliche Kultur also nicht nur Facette einer Gesamtnatur – ließen sich verschiedene Formen der landschaftsbezogenen Interaktion zwischen dem Menschen und seiner Umwelt beschreiben. Wir tun es heute in der Regel dann, wenn wir von Umwelt- und Naturschutz sprechen oder „menschliche Wirkungen auf die Natur“ beschreiben.
Einwirkung des Menschen
Prinzipiell kann für die Nacheiszeit jedoch nicht von einem Wirken des Menschen in einem unbeeinflussten Naturraum ausgegangen werden. Anthropogene Einflüsse prägen spätestens seit der Jungsteinzeit die Landschaften Mitteleuropas, es ist seit dieser Zeit sogar von einer aktiven und bewussten Beeinflussung der Lebensgrundlagen auszugehen. Folglich muss man von einer wechselseitigen Abhängigkeit (Interdependenz) sprechen: der prähistorische wie auch der rezente Mensch passt nicht allein sich seiner Umgebung an, sondern gleichzeitig diese auch seinen Bedürfnissen. Bis in das 19. Jahrhundert ist die Komplexität dieser Wechselwirkungen einigermaßen überschaubar; doch mit der Industrialisierung lassen sich Ursachen und Wirkungen vielfach nicht mehr vernünftig trennen:
Wechselwirkungen
Während im Mittelalter die Beeinflussung eines Waldgebietes durch Bergbau- und Hüttenbetriebe recht gut nachvollzogen werden kann, sind die Wirkungen des heutigen globalen Rohstoffhandels auf den Baumbestand eines Forstes zwar noch zu erkennen, die eigentlichen Ursachen aber nur schwer zu rekonstruieren.
Im Grunde lässt sich die heutige Komplexität, die durch unvermutete Mitwirkungen entsteht, ansatzweise auch in den frühesten Zeiten wiederfinden: So sind religiöse Vorbehalte gegen bestimmte Formen der Landschaftsnutzung überliefert – den Römern und Griechen, aber auch den Galliern waren heilige Haine geläufig, die einer wirtschaftlichen Nutzung nur eingeschränkt zur Verfügung standen. Möglicherweise gab es solche auch in Kulturen, zu denen uns keine zeitgenössische Überlieferung vorliegt. Schon bandkeramische Bauern könnten bestimmte Waldgebiete aus religiösen Gründen gemieden haben – davon wissen wir heute jedoch nichts mehr, und wir gehen in unseren Modellen auch nicht davon aus, weil wir nicht eine unbekannte Variable in eine gerade noch überschaubare Gleichung einführen wollen. Dieses Beispiel religiöser Einflüsse steht exemplarisch für verschiedene kulturell bedingte Verhaltensweisen, die uns allesamt nicht überliefert sind.
aktive und passive Anpassung
Kulturlandschaftsgenese ist also die Entstehung der aktuellen Kulturlandschaft durch menschliche Einflüsse, die in Wechselwirkung mit der Kulturlandschaft ihrer jeweiligen Zeit standen. Das scheint kompliziert zu sein, doch eigentlich geht es nur um die Optimierung menschlicher Existenz im Wechselspiel mit der Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen beziehungsweise durch aktive Änderung derselben. Die passive Anpassung findet letztlich als Evolution im biologischen Sinn statt, die Fähigkeit zur aktiven Anpassung kann auch als Selektionsvorteil betrachtet werden – die Kulturlandschaft ist dabei das Biotop (oder, je nach Ansicht, der Kampfplatz). Auf dieser zur Soziobiologie führenden Basis bauen die wesentlichen Errungenschaften der letzten Jahrtausende auf: Landwirtschaft, Rohstoffnutzung und -verarbeitung, Siedlungswesen, Technik, Handel. Dies sind gleichzeitig die wichtigsten kulturlandschaftsgenetisch relevanten Faktoren.
Kulturlandschaftswandelkarte
Der Verlauf kulturlandschaftsgenetischer Prozesse kann in sogenannten Kulturlandschaftswandelkarten dargestellt werden. Das statische Element der kartographischen Darstellung und die sich chronisch verändernden Informationen eines Geographischen Informationssystems werden hierbei zusammengeführt: die resultierende Karte zeigt die Entstehungszeiten bestimmter Landschaftselemente. Genaugenommen handelt es sich dabei „nur“ um eine thematische Karte mit einer etwas ungewöhnlichen Fragestellung; in der praktischen Anwendung, besonders in der Denkmalpflege, kann eben dieser Darstellungsform aber unter Umständen eine ganz besondere Wichtigkeit zukommen. So lassen sich aus der Kulturlandschaftswandelkarte charakteristische und identitätsstiftende Merkmale herauslesen, allerdings unter Vorbehalt einer entsprechend umfassenden Datengrundlage und mit der Einschränkung, dass Altes nicht zwangsläufig für die Charakteristik einer Landschaft oder die Identität ihrer Bewohner wichtiger sein muss als Neues.
Marker als Charakteristika einer Kulturlandschaft
Vielmehr sind es „Marker“, die für eine Kulturlandschaft charaktergebend sind. Heute können stillgelegte Fördertürme in ehemaligen Bergbaugebieten solche Marker sein, selbst Kühltürme eines Atomkraftwerks oder eine Autobahnbrücke. Ebenso aber auch Landschaftsbestandteile wie die Flureinteilung der Landwirtschaft, angebaute Pflanzen, Hecken oder solitäre Bäume. Marker dienen der Orientierung des Menschen und bilden damit eine Vertrautheit, die durchaus mit dem Begriff „Heimat“ bezeichnet werden kann. Umgekehrt können charakteristische Marker auch gerade die Fremdheit einer Landschaft für Außenstehende verdeutlichen; man denke hier an die in der römischen Antike beliebten Darstellungen phantastischer Nillandschaften, die über Krokodile, Schilfboote, pharaonische Architektur und anderes mehr leicht erkennbar waren. Trotz der Ziele des gesellschaftspolitischen Instruments „Landschaftsschutz“ sind solche Marker aber ersetzbar: Verschwindet der alte Baum, nimmt ein anderer Marker dessen Bedeutung auf – wenn auch in Grenzen: Die Auswirkungen des Braunkohletagebaus sind ganz treffend als eine Zerstörung von Heimat zu bezeichnen; wenn alle Marker einer Kulturlandschaft beseitigt werden, verliert sich auch die Kulturlandschaft.
Da Marker immer der subjektiven Wahrnehmung durch Individuen unterliegen, befinden sich die Deutungen und Bedeutungen zu einer Kulturlandschaft zwar (wie oben ausgeführt) in einem Konsens – sie bleiben aber relativierbar. Der Charakter einer Kulturlandschaft kann deshalb rasch gewandelt werden, obwohl die Marker gleich bleiben; es bedarf hierzu nur einer neuen gesellschaftlichen Übereinkunft. Ein gutes Beispiel für einen derartigen Bedeutungswandel ist das Maastal bei Verdun (Frankreich). Seit dem Ersten Weltkrieg haben die heftig umkämpften Höhen um die Stadt eine neue Bedeutung: sie sind Teil eines (historischen) Schlachtfeldes, obwohl die tatsächlich sichtbaren Spuren sich längst nicht mehr landschaftsprägend auswirken, sondern sich erst bei näherer Betrachtung zeigen.
Kulturlandschaft ist also mehr als nur Naturlandschaft mit menschlichen Einflüssen. Sie ist immer auch ein gedankliches Konstrukt ihrer Bewohner, ihrer Nachbarn und sogar der Landschaftsarchäologen, die sich scheinbar objektiv mit ihr im Rahmen wissenschaftlicher Studien befassen.