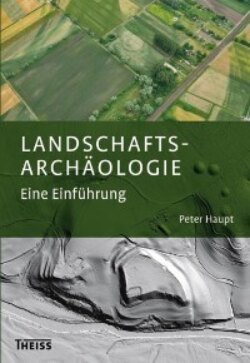Читать книгу Landschaftsarchäologie - Peter Haupt - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Einleitung 1.1 Was ist Landschaftsarchäologie?
ОглавлениеDefinition
Landschaftsarchäologie ist die von archäologischen Fragestellungen ausgehende Erforschung der Kulturlandschaftsgenese, das heißt des von Menschen beeinflussten Wandels der verschiedenen Bestandteile einer Landschaft: Vegetation, Oberflächengestalt, Böden, Besiedlung … Landschaftsarchäologie ist aber auch eine geowissenschaftlich-archäologische Forschungsrichtung, deren Interesse vornehmlich den der Kulturlandschaftsgenese zugrundeliegenden Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt gilt.
Schon frühe historisch-geographische Forschung hat sich mit den Landschaften vergangener Epochen befasst. Dabei wurde meistens das heutige Erscheinungsbild rückprojiziert, günstigenfalls konnten Beschreibungen antiker Autoren ausgewertet werden, etwa die des Tacitus zu den germanischen Wäldern. Auch im Zuge archäologischer Forschungen widmete man sich solchen Fragen, erinnert sei nur an Heinrich Schliemanns Suche nach Troja oder die Frage nach dem Ort der Varusschlacht. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Ergebnisse jedoch meistens statische Befunde. Es interessierte der Zustand der Umgebung einer archäologischen Fundstelle zur Zeit derer Entstehung. Die meist naturwissenschaftlichen Untersuchungen wurden dann als Anhänge der im Vordergrund stehenden archäologischen, oft auf Funde und Chronologie konzentrierten Auswertung publiziert. Andererseits versuchte man schon vor dem Ersten Weltkrieg, mittels Kartierungen gleichartiger Artefakte homogene Kulturen zu erkennen (Gustav Kossina), später dasselbe Ziel anhand gleichartiger Siedlungsbefunde (Herbert Jankuhn) und schließlich durch die theoretische Einbeziehung von Religion, Brauchtum, Handel und anderem mehr (Hans Jürgen Eggers) zu erreichen. Hieraus entwickelte sich eine theorielastige, raumbezogene Forschungsrichtung innerhalb der Archäologie. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde zunehmend der Blick auf die zeitliche Dimension des Wandels gelenkt, die Impulse dazu kamen vor allem aus der vegetationskundlichen und geographischen Forschung. In der jüngsten Zeit schließlich etablierte sich die neue Forschungsrichtung auch dem Namen nach – die Zahl der nach eigenem Bekunden Landschaftsarchäologie betreibenden Forscher wächst deutlich.
Landschaftsarchäologen wenden etablierte archäologische Methoden an, insbesondere die archäologische Prospektion (Luftbildarchäologie, Begehungen), Sondagen und Ausgrabungen, sowie archäologische Datierungsmethoden. Ebenso kommen aber auch in der Archäologie gängige Methoden aus den Naturwissenschaften zum Einsatz, hervorzuheben sind geophysikalische Prospektionen, bodenkundliche Untersuchungen, das weite Feld der Archäobotanik und naturwissenschaftliche Datierungsmethoden.
Erkenntnisgewinn wird besonders hinsichtlich Vorteil-Nachteil- beziehungsweise Kosten-Nutzen-Rechnungen gesucht: Das Einbringen eines neuen Faktors in die Kulturlandschaft hat für das menschliche Wirtschaften praktisch immer Vor- und Nachteile, oft wird deren Verhältnis zueinander erst im Laufe einer längeren Entwicklung erkennbar. Solche Entwicklungen sind hervorragend für eine Betrachtung mit archäologischen Methoden geeignet, jedenfalls und besonders dann, wenn sie Zeiträume oder Umstände mit wenig Information aus anders erschließbaren Quellen betreffen. So ist beispielsweise der Einfluss von Weidewirtschaft auf Besiedlung und Bewaldung der deutschen Mittelgebirge bis in die Neuzeit hinein nur sehr unzureichend aus Schriftquellen zu beschreiben. Die Epochen vor der späten Eisenzeit sind nördlich der Alpen komplett ohne schriftliche Eigenquellen.
Die Landschaftsarchäologie kann auch mit deutlicherem Schwerpunkt in den Humanwissenschaften betrieben werden – was besonders im angloamerikanischen Raum getan wird. Beispielhaft sei der soziologische Einfluss in Fragestellungen zu den Raumbezügen von Herrschaft oder zu den Sakralstrukturen von Landschaft genannt. Solche Gewichtungen sind keinesfalls müßig, sie bauen aber auf landschaftsarchäologischer Forschung auf, wie sie in dieser Einführung beschrieben wird: Ohne Kenntnis der Ressourcennutzung ist es zum Beispiel kaum möglich, sinnvoll über Herrschaftsstrukturen nachzudenken – ohne zu wissen, wo der profane Wirtschaftsraum seine Grenzen hatte, bleiben die Sakralstrukturen im Dunkeln. Landschaftsarchäologie in unserem Sinne erarbeitet erst die Grundlagen für Überlegungen auf einer Metaebene über den empirischen Wissenschaften. Dementsprechend wird Landschaftsarchäologie hier auch nicht von der wissenschaftstheoretischen Warte aus diskutiert, sondern aus der Praxis heraus beschrieben.
Der Begriff „Landschaftsarchäologie“ wird immer wieder in verschiedenen Kontexten gebraucht, wodurch die Forschungsrichtung unscharf wahrgenommen wird. Eine archäologische Grabung an einem Siedlungsplatz wird als Siedlungsarchäologie bezeichnet, während gleichzeitige Grabungen an zwei benachbarten Orten bisweilen schon als Landschaftsarchäologie gelten. Rettungsgrabungen entlang einer „landschaftsprägenden“ Schnellbahntrasse werden zur Archäologie einer Landschaft, was unschwer als Synonym für Landschaftsarchäologie verstanden werden kann. Es ist besonders die Verquickung unserer subjektiven Vorstellungen von Landschaft mit in der Archäologie oft unbewusst angewandten Definitionen, die hier Unklarheiten mit sich bringt.
Klarheit lässt sich gewinnen, wenn das Ziel der jeweiligen Untersuchungen betrachtet wird.
Forschungsrichtungen innerhalb der verschiedenen archäologischen Fächer werden nicht vom Gegenstand bestimmt, mit dem sich der einzelne Wissenschaftler befasst, sondern von den Fragestellungen, die seine Arbeit leiten. Auch wenn es die vereinfachende Darstellung tagesaktueller Berichterstattung nahelegt: Ein Archäologe, der sich mit den Mammutknochen einer altsteinzeitlichen Fundstelle befasst, ist kein Mammutforscher. Viel zutreffender und mit größerer Wahrscheinlichkeit verfolgt er Fragestellungen bezüglich des Jagdverhaltens oder der Beuteverwertung früher Menschen und ist treffender als Archäologe des Eiszeitalters zu bezeichnen.
Nicht viel anders ist es mit der Landschaftsarchäologie: Sie wird primär von einschlägigen Fragestellungen bestimmt, nicht etwa vom Arbeiten in einer definierten Landschaft. Die Verbreitung eisenzeitlicher Fibeltypen im Voralpenland mag sich kartographisch vor dem Hintergrund einer definierten Landschaft darstellen lassen, es steckt allerdings keine landschaftsarchäologische, sondern eher eine typochronologische, eine ethnographische oder eine wirtschaftsarchäologische Fragestellung hinter solchen Arbeiten. Kartierungen und der Einsatz EDV-gestützter Geographischer Informationssysteme (GIS) sind zwar aus der Landschaftsarchäologie nicht mehr wegzudenken, sie sind aber längst auch in verschiedenen anderen archäologischen Forschungsrichtungen etabliert.
Landschaftsarchäologie betreibt der, der sich mit landschaftsarchäologischen Fragestellungen auseinandersetzt – also mit noch zu beschreibenden Methoden Erkenntnisse zur Kulturlandschaftsgenese gewinnt.