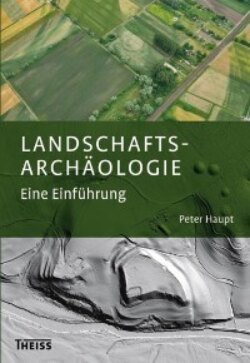Читать книгу Landschaftsarchäologie - Peter Haupt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Die Stellung der Landschaftsarchäologie zu ihren Nachbarwissenschaften
ОглавлениеMontanarchäologie
Eine Reihe von Wissenschaften und Forschungsrichtungen sind hinsichtlich Methoden und Fragestellungen eng mit der Landschaftsarchäologie verwandt. So widmet sich die Montanarchäologie in vielen Epochen gewissermaßen der Basis der Kulturlandschaftsgenese, nämlich der Nutzung von Ressourcen aus dem Bereich Steine, Tone und Erze. Montanarchäologen untersuchen auch die mittelbaren Folgen derartiger Ressourcennutzung, besonders die Verhüttung von Erzen und die Beschaffung dazu nötiger Energie aus Holz oder fossilen Brennstoffen. Damit ist die Montanarchäologie mit ihren spezifischen Methoden eine wichtige Quelle für den landschaftsarchäologischen Erkenntnisgewinn – jedenfalls in Gegenden mit entsprechender Rohstoffnutzung.
Siedlungsarchäologie
Die Siedlungsarchäologie kann man in ihrer heutigen Form quasi als älteren Bruder der Landschaftsarchäologie sehen. Ihr Fokus ist auf Entwicklung und Funktion von Siedlungen gerichtet, soziale und wirtschaftliche Gesichtspunkte stehen im Vordergrund. Landschafts- und Siedlungsarchäologie sind genauso miteinander verwoben, wie es Landschaft und Siedlung sind – der eigentliche Unterschied liegt in den gesetzten Schwerpunkten: Landschaftsarchäologische Fragestellungen sehen Siedlungen als Teil der Kulturlandschaft, siedlungsarchäologische Fragestellungen betrachten die Kulturlandschaft als Umgebung der Siedlungen.
Geoarchäologie
Jünger und hinsichtlich ihres archäologischen Anteils eher ein Ableger der Landschaftsarchäologie ist die Geoarchäologie. Die Fragestellungen sind oft deckungsgleich, als Unterschied ist ein größeres Augenmerk auf geowissenschaftliche Themen auszumachen – was vor allem an dem Umstand liegt, dass diese Fachrichtung überwiegend von Geographen und Geologen betrieben wird (so gibt es beispielsweise an der Freien Universität Berlin eine Juniorprofessur im Bereich Geoarchäologie am Fachbereich Geowissenschaften; allerdings an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg auch eine Juniorprofessur für Informationsverarbeitung in der Geoarchäologie am Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte). Man könnte den Unterschied in aller Kürze so beschreiben: Landschaftsarchäologen und Geoarchäologen erforschen die dem Wandel der Kulturlandschaft zugrundeliegenden Ursachen. Erstere bauen ihre Fragestellungen tendenziell eher auf den im Vorfeld bekannten archäologischen Artefakten und Befunden auf, letztere beginnen ihre Forschungen mit einem Blick auf das Bodenrelief. Oft ist der zeitliche Rahmen der Geoarchäologie weiter gesteckt: Glaziale Geomorphologie zum Beispiel liegt ebenso in ihrem Interesse, wie postglaziale Kolluvienbildung – der Rückschluss auf Kultureinflüsse steht nicht zwingend im Vordergrund.
Neben diesen nah verwandten und überschneidenden Disziplinen gibt es eine ganze Reihe weiterer Wissenschaften, die dem Landschaftsarchäologen (aus dessen Sicht) zuarbeiten. Es sind dies besonders die konventionellen Geschichtswissenschaften, die Geographie, die Bodenkunde, die Archäobotanik und die Archäozoologie. Deren Rolle wird beim Blick auf die Methoden und in den Fallbeispielen herausgestellt werden.
Umweltarchäologie
Schwierig ist es, Unterschiede zwischen Landschafts- und Umweltarchäologie zu beschreiben. Sie überschneiden sich in Fragestellungen und angewandten Methoden; ein spürbarer Unterschied liegt auf Seiten der Umweltarchäologie in dem stärkeren Fokus auf den Lebensbedingungen der Menschen, die nicht zwingend für das Werden der Kulturlandschaft relevant sein müssen. So können Emissionen aus einer neuzeitlichen Alaunhütte zwar Fischbestände und die Gesundheit von Menschen geschädigt haben; für die Kulturlandschaftsgenese ist dies allein jedoch ohne Bedeutung, wie auch das Vorkommen von Parasiten aufgrund schlechter hygienischer Bedingungen ganz klar ein Arbeitsfeld der Umwelt-, und nicht der Landschaftsarchäologie ist.
Der Begriff „Umwelt“ impliziert zudem eine schärfere Trennung zwischen dem Mensch und seiner Umgebung (= Umwelt). Menschliche Gesellschaften/Siedlungen/Populationen können scheinbar aus dem sie umgebenden Raum herausgelöst werden, sodass sich zwei souveräne, interagierende Teile ergeben: Der Mensch (als Synonym für eine Population) beeinflusst die Umwelt auf eine bestimmte Weise, die veränderte Umwelt beeinflusst wiederum den Menschen. Diese Gedanken haben in den 1960er- bis 1980er-Jahren Eingang in die Archäologie gefunden und sie sind im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang eng mit der Entwicklung von Ideen zu Umwelt- und Naturschutz verbunden. Obwohl sich diese simplifizierende Sichtweise eines Dualismus Mensch-Umwelt, Mensch-Natur oder Mensch-Planet bis in die früheste nachvollziehbare Zeit menschlicher Geistesentwicklung zurückverfolgen lässt und auch heute allenthalben vorhanden ist, kann sie kein ganzheitliches Modell zur Erklärung des Werdens unseres Lebensraumes sein (obwohl wir uns angesichts des anthropogen beeinflussten Klimawandels gerne selbst suggerieren, man könne durch klar umrissene Eingriffe solch hochkomplexe Systeme steuern).
Eigentlich sollten wegen der gravierenden politischen und emotionalen Aufladung des Begriffes „Umwelt“ nur solche Forschungen als Umweltarchäologie bezeichnet werden, denen die Trennung zwischen Menschen und ihrer Umgebung sowie die Interaktion beider zugrunde liegen. Landschaftsarchäologie sollte Fragestellungen zum Gesamtsystem nachgehen, bei denen Menschen nur einer von vielen agierenden Teilen sind. Damit gibt es zwar weiterhin erhebliche Überschneidungen in den Untersuchungsmethoden und Arbeitsfeldern – die Fragestellungen wären aber zu trennen. In der archäologischen Praxis wird das Wort Umwelt allerdings oft unbedacht verwendet.