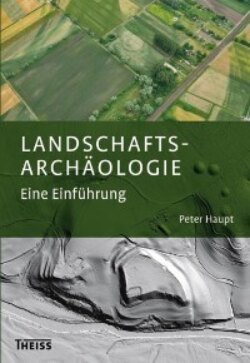Читать книгу Landschaftsarchäologie - Peter Haupt - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Wertungen wie „gut“ und „schlecht“ sind immer relativ.
ОглавлениеWertungen
Erläuterung: In der Regel ist es töricht, längst vergangenen Gesellschaften Fehler im Umgang mit ihren Ressourcen vorzuwerfen. Natürlich ist der Raubbau an Wäldern ein massiver Eingriff, der meist generationenlang Folgen hat – eine Wertung, er sei für die nachfolgenden Generationen schlecht, setzt allerdings das spekulative Wissen voraus, die nachfolgenden Generationen hätten unter dem Verzicht auf Schiffbau/Erzverhüttung/Industrialisierung nicht noch mehr gelitten. Wenn also Wertungen sein sollen, so immer mit Angabe der Relation: Raubbau am Wald war schlecht für zukünftige Projekte, die auf bestimmte Holzarten angewiesen waren, und er war schlecht für die Fruchtbarkeit der Böden, weil Erosionsphänomene hierdurch verstärkt wurden. Eine abschließende Bewertung ist das aber nicht, denn wenn durch das Abholzen der Wälder eine bahnbrechende kulturelle Entwicklung ermöglicht wurde, kann man diese nicht aus einer verklärten, romantischen Beurteilung dessen ablehnen. Ein prinzipielles und wissenschaftlich begründetes, letztlich ethisch-moralisch gemeintes Gut- oder Schlechtsein von menschlichen Eingriffen sollte es in landschaftsarchäologischen Betrachtungen nicht geben.
Hieraus entstehen der Forschung Interessenskonflikte: Öffentliche Aufmerksamkeit und Fördergelder sind leichter zu erhalten, wenn man mutmaßliches Fehlverhalten im vor- und frühgeschichtlichen Umgang mit „Natur“ benennt. Ob Menschen das Mammut ausrotteten, phönizische Schiffbauer die Küsten des Mittelmeers abholzten oder frühneuzeitliche Eisenhütten Baumsterben verursachten – solche Fragestellungen sind auf den ersten Blick attraktiv, weil sie unsere eigenen Probleme und Ängste widerspiegeln. Entgegen dem Wunsch, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen, scheint es aber Menschen in der Interaktion mit ihrer Umgebung eher darum zu gehen, das für sie Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Man hat wahrscheinlich schon im Jungpaläolithikum bedauert, dass man immer seltener ein Mammut zu sehen bekam, deswegen aber keineswegs mit der Jagd aufgehört. Ebenso sind Baumbestände heute immer auch eine wirtschaftliche Ressource – sei es als Nutzholz, für touristische Zwecke oder ganz subtil als Ausgleichsreservate für andernorts durchgeführte Bauvorhaben. Bei der Beurteilung des Wertes von Wald spielen Emotionen selbstverständlich ebenfalls eine Rolle; das Bewahren gefälliger Landschaftsbestandteile ist zumindest seit der Antike mit Heiligen Hainen gut belegbar.
Eine besondere Bedeutung kommt solchen emotionalen Aspekten bei der Anwendung des Begriffs „Heimat“ zu. Dieser ist nahezu immer mit Werten belegt – meist wird Heimat als etwas Gutes angesehen, weil sie eine dem Betrachter vertraute Umgebung oder eben Landschaft meint. Heimat ist der bewährte Lebensraum, an den man durch seine spezifische Kultur bestmöglich angepasst ist. Vor diesem Hintergrund kann eine Landschaft von ihren Bewohnern als gut bewertet werden, wie eine fremde Landschaft als schlecht empfunden werden kann. Diese Bewertungen sind ausgesprochen interessant und wichtig, zum Beispiel bei Populationsveränderungen und Migrationen. Die Landschaftsarchäologie kann und muss solche emotionsgesteuerten Faktoren in der Kulturlandschaftsgenese erforschen. Sie darf aber nicht selbst von ihnen geleitet werden.