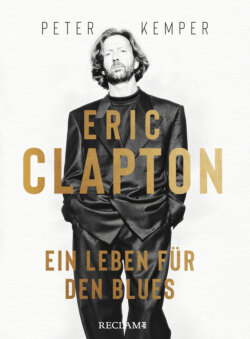Читать книгу Eric Clapton. Ein Leben für den Blues - Peter Kemper - Страница 6
Baumwollfelder an der Themse
ОглавлениеAnfang der 1960er Jahre galt der Blues in Amerika als ›toter Hund‹, während er auf der anderen Seite des Atlantiks geradezu enthusiastisch gefeiert wurde. In einem ersten Schritt eigneten sich britische Blues-Bewunderer diese schwarze Musikform an, indem sie sie so genau wie irgend möglich studierten, ihre musikalischen Strukturen anhand von Schallplatten, Radiosendungen, Büchern und Zeitschriften analysierten und nachahmten. In einem zweiten Schritt kam es zu einer produktiven Synthese aus Nachahmung und Neuerfindung: Die Rhetorik des Blues, seine Bildersprache, seine Mythen, sein Slang-Vokabular, seine musikalischen Phrasen und Wendungen wurden mit englischer Folklore, ebenso wie mit amerikanischer Rockmusik verschmolzen, vor allem aber mit Lautstärke und Aggression aufgeladen. So entstand Anfang der 1960er Jahre der typisch britische Blue-Eyed-Blues als eine Rekombination von traditionellen und aktuellen Elementen.
Dabei bedeutete Blues als kulturelles Idiom und sozialer Text für Schwarze etwas völlig anderes als für Weiße. Die britischen Blues-Liebhaber – Musiker wie Publikum – wuchsen weder mit dem institutionalisierten Rassismus in Amerika auf, noch hatten sie zunächst eine Ahnung von den oft katastrophalen Lebensumständen schwarzer Musiker in den Südstaaten der USA. In Großbritannien speiste sich die Blues-Vorliebe eher aus Außenseiter-Instinkten, jugendlicher Rebellion und Nonkonformismus-Fantasien. Aus der tristen Welt englischer Vorstädte konnte man sich mühelos in die Rückzugsorte afroamerikanischer Blues-Musiker wie dem Mississippi-Delta, Memphis oder Chicago davonträumen. Nicht zufällig grassierte unter den britischen Blues-Boomern aus dem Stockbroker Belt von Surrey, südlich von London, der selbstironische Joke vom »Surrey Delta« oder von den »Thames Valley Cotton Fields«, denn man lebte tausende Meilen vom Mississippi entfernt.
Als Brite war man überzeugt, Rassefragen und damit verbundene moralische Entscheidungen vernachlässigen und den Blues als quasi wertfreie musikalische Ausdrucksform übernehmen und weiterentwickeln zu können. Diese Haltung entsprach noch ganz der ›Shopping-Mentalität‹ des untergehenden britischen Empire, das geglaubt hatte, kulturelle Formen, Stile und Genres aus allen Teilen der Welt konsumieren, amalgamieren und nach eigenem Gutdünken verändern zu können. Selbst wenn jemand wie Clapton sich nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des britischen Empire um den Verlust von – sagen wir – Indien oder Kenia wenig gekümmert haben mag, so konnte er doch nicht der verbreiteten nationalen Stimmung von Unsicherheit und kultureller Verknöcherung entfliehen. Erst in dieser Situation des Niedergangs konstruierten britische Blues-Liebhaber ›Amerika‹ als einen Ort, an dem Abenteuer und Bewegungsfreiheit noch möglich schienen – und nach einem Wort von Keith Richards »die Mädchen ohnehin besser aussahen.«
Für Schwarze war das Leben im Mississippi-Delta in den 1920er Jahren, als der Blues entstand, eine Qual: Als Tagelöhner auf den endlos weiten Feldern wurden sie wie Geister behandelt: Bei Sonnenaufgang hatten sie lautlos zu erscheinen, mussten ohne Murren in glühender Hitze schuften und bei Sonnenuntergang möglichst geräuschlos wieder verschwinden. Auch einem einfachen ›farbigen‹ Sharecropper bzw. Pächter ging es nicht viel besser, war er doch von korrupten weißen Großgrundbesitzern abhängig, deren absurd hohe Pachtforderungen er kaum erfüllen konnte und sich deshalb immer weiter verschulden musste. Kein Wunder, dass die Schwarzen am Wochenende in sogenannten Juke Joints, von Alkohol und Sex durchtränkten Tanzveranstaltungen, Ablenkung von ihrem aufreibenden Alltag suchten. Die wüsten Partys in der Samstagnacht waren direkte Gegenveranstaltungen zum sonntäglichen Gottesdienst am nächsten Morgen. Inmitten der Massen von Prostituierten, Schaustellern und Whiskeyschmugglern hatten Blues-Musiker ihren festen Arbeitsplatz, ebenso in den zahllosen Camps der Tagelöhner, beides Brutstätten von Gewalt und Kriminalität. Hier konnte sich der Blues als Ausdruck einer erschöpften Seele und gleichermaßen als Demonstration unsterblicher Lebenslust entwickeln. Dabei ging es nicht in erster Linie um musikalische Virtuosität, sondern um innere Einstellung. Können ist zwar eine Voraussetzung, »aber die wahre Tugend des Blues-Musikers liegt darin, dass er sein Leben akzeptiert, ein Leben, für das er nur zum Teil verantwortlich ist«, so der amerikanische Rockkritiker Stanley Booth.
Schnell durchschaute der junge Robert Johnson dieses geheime Gesetz: Der Blues machte die Schrecken der Welt besser erträglich, einer brutalen Welt, »die tagtäglich auf der Lauer lag, sobald man den Fuß aus der Kirche setzte« – wie es der amerikanische Musik- und Kulturkritiker Greil Marcus formulierte. Nie war der Blues transzendent oder huldigte dem Höchsten. Anstelle göttlicher Gnade bettelte er um Erlösung durch Liebe und Sex. Das musste bei heranwachsenden, vom britischen Zeitgeist enttäuschten Jugendlichen zwangsläufig auf offene Ohren treffen. Eric Clapton und die Rolling Stones sollten deshalb in der Folgezeit viele Johnson-Songs covern, von »Love In Vain«, »Stop Breaking Down«, über »Ramblin’ On My Mind« und »From Four Until Late« bis zu Claptons lebenslanger Erkennungsmelodie »Crossroads«.
Die Bedeutung von Johnson lässt sich dennoch nicht allein an der Anzahl der Coverversionen messen, sein Einfluss reicht tiefer: Für viele Rock- und Blues-Musiker wurde er zum Spiegel und Prüfstein zugleich. Blues verkörperte für die weißen jungen Briten ungeschulte Rauheit anstelle von gekonnter Professionalität, bäuerliche Vorzeit statt städtischer Modernität und herbe Männlichkeit anstelle von zarter Weiblichkeit. Doch der Hauptgrund, warum weiße britische Mittelschichtsjugendliche sich für den Delta-Blues begeisterten, war ihre Suche nach den Wurzeln, nach den historischen Vorläufern des Rock ’n’ Roll. Wo kam Elvis eigentlich her? Aus welchen Quellen schöpfte Carl Perkins? Woher nahm Chuck Berry seinen Rhythmus? Und wie kam Little Richard zu seiner Rock-Röhre? Wurzeln galten den jungen Briten als das Wahre, die Quelle garantierte für sie Authentizität, noch unverdorben durch modernes Stadtleben und Kommerz.
Den ersehnten Ursprungsmythos fanden sie schließlich im Mississippi-Delta-Blues, in den Songs von Robert Johnson, Charlie Patton, Son House oder Skip James, so dass sich die aufmüpfigen Jugendlichen – so Mick Jagger – vorkamen wie »großartige musikalische Historiker«. Clapton und seine Mitstreiter stöberten in kleinen Jazz-Läden nach obskuren Platten oder bestellten wie Jagger die exotischen Alben per Mailorder direkt in den USA. So lernten sie in einer Art Secondhand-Studium das Blues-Vokabular, das Personal der Songs, ihre Charaktere, Ausdrucksformen und Ideen kennen. Obwohl in diesem Aneignungsprozess in Wahrheit keine reale Verbindung zu schwarzen, ja zumeist bitterarmen und ausgegrenzten Amerikanern bestand, konnten die britischen Blues-Musiker für sich immerhin emotionale Verarmung und eine Art Inhaftierung im britischen Klassensystem geltend machen, aus dem man sich mit aller Macht befreien wollte. Clapton präzisierte in einem Interview mit David Fricke vom Rolling Stone im Jahr 2014:
Wenn man es in einen sozialen Kontext stellen möchte, könnte man sagen, dass England im Zweiten Weltkrieg kurz davor war, besiegt zu werden. Aber wir sind aufgestanden und haben uns gewehrt. Die Blues-Sänger repräsentierten genau diese Haltung aus Widerstand und Trotz. Robert Johnson war ein Kerl gegen den Rest der Welt und die Jugendlichen aus meiner Generation haben dieses Gefühl übernommen – wir waren unschlagbar.
Projektion und Überhöhung gehen hier Hand in Hand.
Robert Johnson verarbeitete seine lebenslange Flucht vor der Heimatlosigkeit in einer Musik, die von immer neuen Verwundungen erzählt. Von zahllosen Höllenhunden gehetzt – er fühlte sich zeitlebens wie ein verstoßenes Kind, war von ständiger Unruhe erfüllt und wurde von seiner Gier nach Sex ins Verderben getrieben –, gelang es ihm dennoch, durch seine Musik der bedrückenden Realität zu entfliehen. Mit durchdringender, hoher Stimme forderte er in seinen Songs Erlösung ohne Rücksicht auf sein Seelenheil. Geht es im Gospel um die Huldigung des Höchsten, dann geht es Johnson um den Zusammenhang von Gewalt und Zärtlichkeit. Mal erzeugt sein Gesang Laute eines höhnischen Gelächters, dann dumpfes Donnergrollen, während sein Gitarrenspiel wie ausgedörrt klingt oder mit dem Slide gefährlich glitzernde Einzelnoten produziert. Die Musik, die er uns hinterlassen hat, in Verbindung mit dem Mysterienspiel seines Lebens und Sterbens, all das hat dazu geführt, dass er bis heute unvergessen geblieben ist. Peter Guralnick, einer seiner Biografen, ist überzeugt: »Johnson ist nie wirklich gestorben, er lebt als Idee weiter.« Doch was verbirgt sich hinter dieser Idee?
Das Mysterium, das Johnsons kurzes, aber heftiges Leben umgibt, sein rätselhafter Tod: Keiner der Blues-Musiker, die England in den 1960er Jahren besuchten, weder Muddy Waters, Big Bill Broonzy noch Howlin’ Wolf, konnte es mit dieser schillernden Figur aufnehmen, keiner verfügte über einen ähnlich verlockenden Mythos: Sein »walking with the devil« funktionierte als verführerische Metapher für die düstere Seite seines Charakters, seiner inneren Abgründe und führte damit direkt ins dunkle Herz der Rockmusik. Zugleich konnte Johnsons vermeintlicher Teufels-Pakt vom jungen britischen Blues-Netzwerk als eine Geste des Widerstands, des Ausstiegs aus bürgerlichen Konventionen gedeutet werden. Als er die Johnson-Platte King Of The Delta Blues Singers hörte, wurde Clapton, wie er sich im Gespräch mit Andrew Franklin erinnert, schlagartig klar:
Ich konnte seine Musik nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn er war ja in gewisser Weise ein Rebell. Er regte jede Menge Fantasien in mir an, und ich sah in ihm einen echten einsamen Wolf, der einfach zu kraftvoll war, um ihn mit anderen Musikern zu vermischen.
Es sind vor allem vier Songs, denen Johnson sein ›teuflisches‹ Image verdankt. Dabei beklagt der Sänger in »Hellhound On My Trail« lediglich, dass er von Höllenhunden gejagt werde und deshalb immer weiterziehen müsse. In »Me And The Devil Blues« wacht der Sänger eines Morgens davon auf, dass Satan an seine Tür klopft und ihn warnt, »dass die Zeit gekommen sei, zu gehen«. Er geht daraufhin mit dem Teufel Seite an Seite fort und versucht, sich dabei Mut zuzusprechen. Der »Preachin’ Blues« nennt dagegen ausdrücklich keinen Bewohner der Unterwelt und spricht nur vage vom »walkin’ like a man«, was man in Anlehnung an den »Me And The Devil Blues« mit einigem guten Willen auf den Weggang mit dem Teufel beziehen könnte.
In Johnsons »Cross Road Blues« sehen die meisten Kommentatoren die deutlichste Anspielung auf einen Deal mit dem Teufel. Obwohl die abergläubische Verbindung ›Straßenkreuzung – Teufel‹ in der Folklore der Südstaaten stark verbreitet war, erzählt Johnson in seinem berühmtesten Lied vom glatten Gegenteil: Hier geht der Sänger zu einer Straßenkreuzung, um Gott anzuflehen. Er fällt auf die Knie und bittet an der Kreuzung um dessen Gnade. Anschließend sucht er eine Mitfahrgelegenheit, doch keines der vorbeifahrenden Autos hält an. Dunkelheit senkt sich über die Straßenkreuzung, und der Sänger ist allein, voller Furcht, zusammenzubrechen. Wahrscheinlich im Jahr 1932 geschrieben, zählte der »Cross Road Blues« bald zu Johnsons Standardrepertoire. Obwohl in dem Lied an keiner Stelle explizit vom Teufel die Rede ist, gilt er unter Blues-Fans als derjenige Song, der die satanische Symbolik am plausibelsten ausdrückt. Wahrscheinlich liegt das an der düsteren Atmosphäre des Stücks, die leicht als unmittelbarer Ausdruck der Seelenlage des Sängers interpretiert werden kann. Allein die Tatsache, dass in Johnsons »Cross Road Blues« der Sänger die Kreuzung aufsucht, als die Sonne schon untergeht, widerspricht dem üblichen Ritual des Teufelspakts, das ja um Mitternacht stattfinden muss.
Der Song beschreibt eine typische Situation im Leben eines umherstreifenden Musikers: Sobald er einen seiner sicheren Stützpunkte verlässt, kommt er am Ortsrand unweigerlich zu einer Straßenkreuzung. Hier muss er sich entscheiden, welche Richtung er einschlagen soll. Der Sänger steht an einem schicksalhaften Scheideweg. Zunächst versucht er zu trampen, aber niemand nimmt von ihm Notiz. So geht das bis zum späten Abend, als ihn der Mut verlässt (»Poor Bob is sinkin’ down«.)
Man kann diesen Text so deuten, als handele er von der mentalen Verfassung einer Person, die Angst hat, ihre Seele an einen an der Kreuzung vorbeikommenden Teufel zu verlieren – vielleicht auch als Versuchung, die eigene Seele gegen musikalisches Talent einzutauschen. Wahrscheinlich aber erzählen Johnsons Zeilen von seiner Ruhelosigkeit, seiner selbstzerstörerischen Innenwelt, angefüllt mit Furcht und namenlosen Ängsten. In eine ähnliche Richtung geht auch Claptons Deutung, die er im Gespräch mit Andrew Franklin 1991 präzisiert hat:
In seiner Musik kommt eine Angst zum Ausdruck, die ich in meinem eigenen Leben auch erfahren habe. Ich kann mich mit seiner Furcht und seinem Schrecken vorbehaltlos identifizieren. Johnson hat in seiner Jugend einige schwerwiegende Fehler gemacht, deshalb wurde er ein Getriebener, immer auf Achse, weil er in der Klemme saß.
In immer neuen Versionen hat Clapton sich am »Crossroads«-Song mit den verschiedensten Bands abgearbeitet – als ginge es im Blues »nicht so sehr darum, was mit der Gitarre gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Deshalb wollte ich auch den ›spirit‹ und weniger die Form oder die Technik aus den Johnson-Songs herausziehen.«
Seit 1961 sucht Clapton beharrlich nach einem Weg, die rohe Emotionalität von Johnsons Musik in den modernen Sound eines elektrisch verstärkten Bluesrock zu integrieren. Im Booklet zu den Complete Recordings von Robert Johnson schreibt er:
Für mich war die Frage wichtig: Gibt es so etwas wie ein Riff, eine Form, die auch in einem Bandformat funktionieren kann? Der einfachste Ausgangspunkt schien mir in den Songs zu liegen, in denen er diese Jimmy-Reed-Figur in den Basslinien benutzt. Dann fand ich in seinem »Cross Road Blues« ein eingängiges Riff, das mehr oder weniger aus dem Song »Terraplane« stammt. Er spielte es als ganzen Akkord mit einem Slide. Ich übertrug es auf eine oder zwei Saiten und schmückte es dann noch etwas aus. Aus all seinen Songs schien mir dieses Riff am einfachsten zu reproduzieren zu sein.
Schon im März 1966, bevor er sein erstes Album mit John Mayall & The Bluesbreakers einspielen sollte, entstand eine erste Aufnahme des Stücks mit der Studio-Band Eric Clapton And The Powerhouse. Am 28. November 1966, bevor Cream ihr erstes Album Fresh Cream herausbrachten, unternahm Eric im Londoner BBC-Studio 2 einen weiteren »Crossroads«-Versuch. Doch die Verbreitung der Robert-Johnson-Legende begann eigentlich erst mit der Veröffentlichung der Cream-Live-Version von »Crossroads« vom Album Wheels Of Fire (1968). Ihr kommerzieller Erfolg übertraf nicht nur den aller Johnson-Aufnahmen, sondern wahrscheinlich auch die Verkaufszahlen aller Delta-Blues-Aufnahmen zusammen, die vor dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht worden waren.
Lokales Markenzeichen: Die Crossroads-Skulptur von Vic Barbieri in Clarksdale, Mississippi
Gerade die ›Crossroads‹-Metapher weist eine reiche Geschichte auf: In der afrikanischen Volksmythologie steht die Kreuzung für einen Ort zwischen den Welten des Natürlichen und Übernatürlichen. Hier kann eine außerweltliche Macht kontaktiert werden, es gilt ein »weder hier noch dort.« Überall in Europa war der Aberglaube verbreitet, eine Kreuzung sei der Treffpunkt von Hexen und bösen Geistern. Deshalb haben Christen gern an solchen Stellen Kapellen für Heilige und Madonnen-Statuen aufgestellt.
Psychologisch betrachtet symbolisiert die Kreuzung den Brennpunkt von Entscheidungen und den Ursprungsort von Kreativität. Sie gilt als Treffpunkt, wo Ideen und Gedanken zusammenfließen, bevor sie sich in einer Entscheidung manifestieren. In dieser Perspektive ist die Kreuzung auch ein Symbol von Unentschlossenheit und Entscheidungsschwäche. An der ›Crossroad‹ stellt man sich die Frage, ob es an der Zeit ist, seinem Leben eine neue Richtung zu geben. Sie ist die Wegmarke, an der sich eine schicksalhafte Veränderung zum Guten oder Schlechten ergibt. Entsprechend oft steht die Kreuzung auch für innere Widersprüche, die ein Mensch auflösen muss.
Die ›Crossroads‹-Metapher drängt sich neben der Black-and-White-Problematik als Leitmotiv von Claptons Leben geradezu auf, das voll von Abstürzen und Neuerfindungen ist. Mit Hilfe des Kreuzungssymbols lassen sich entscheidende Wegmarken in seinem bisweilen widersprüchlichen Werdegang enträtseln, wie Clapton selbst im Interview mit Andrew Franklin erklärt:
Ich identifiziere mich mit Robert Johnson, und ich sehe mich ebenfalls oft an einer Kreuzung stehen. Ich durchlaufe dann immer einen Veränderungsprozess –, wenn ich in einer Situation bin, in der ich nicht mehr weiterweiß, nicht sicher bin, in welche Richtung ich gehen soll. Ich fühle mich nie in einer stabilen Verfassung. Ich bin nie wirklich mit mir zufrieden, halte immer nach mehr Ausschau. Ich bin mir auch nie sicher, wohin meine Reise geht. Wissen Sie, ich fühle mich wirklich richtungslos. Das ist schon ein komisches Dilemma, und es begann wohl, als ich Johnson zum ersten Mal hörte –, ohne dass ich ihm dafür die Schuld geben würde.