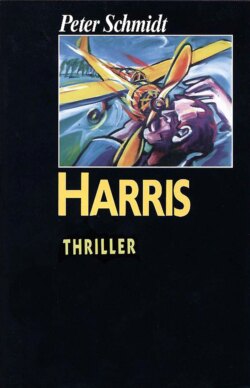Читать книгу Harris - Peter Schmidt - Страница 12
8
ОглавлениеBertram gehörte nicht zu jener Sorte von Fanatikern, die den Wert der Kriminalpsychologie höher veranschlagten als die übrigen Ermittlungsmethoden. Aber sie war sein Lieblingsgebiet, ein wissenschaftlicher Spleen, wie er sich manchmal eingestand.
Er verbrachte ganze Nächte in seiner Bibliothek, um sich mit einem einzigen Persönlichkeitsbild zu befassen, es aus winzigen Mosaikstücken aufbauen. Es war faszinierend, zu sehen, wie aussagekräftig selbst kleinste Details für die Beurteilung eines Täters waren, wenn man es verstand, sie in den richtigen Zusammenhang zu bringen.
Dann machte er es sich mit seinen Unterlagen im Wintergarten bequem und kombinierte die einzelnen Punkte so lange, bis ein Bild daraus wurde. Es erinnerte ihn immer daran, wie ein Phantombild entstand.
Am Anfang hatte man nur eine Nase, ein Stück Stirn, die Augen. Und plötzlich war daraus ein Gesicht geworden.
Manchmal schlief er mit seinen Papieren auf den Knien ein und wurde erst wieder wach, wenn die Scheinwerfer von Marias Wagen durch den Garten heraufkamen. Oder wenn seine Katze draußen in der Dunkelheit ein Opfer gefunden hatte. Und oft erwachte er am nächsten Morgen mit steifem Hals und kalten Beinen, und seine Notizen und die Berichte aus der Abteilung lagen verstreut auf dem Boden um seinen Lehnstuhl …
An diesem Nachmittag war er etwas früher nach Hause gefahren, um sich die Analyse eines Verbrechens anzusehen, das an einem sechsjährigen Jungen begangen worden war. Er war weder gefoltert noch missbraucht worden, was die Frage aufwarf, ob man es überhaupt als Verbrechen bezeichnen sollte. Der Täter hatte ihm lediglich vorgespiegelt, er müsse sterben.
Das schien dem armen Burschen schlecht bekommen zu sein, denn seitdem befand er sich in psychiatrischer Behandlung. Es war immer wieder interessant zu sehen, was Worte anrichten konnten. Man musste jemandem nur vollkommen glaubhaft versichern, er litte an Krebs oder an einer unheilbaren Krankheit, dann reagierte er darauf genauso, als sei er tatsächlich erkrankt.
Ein paar simple Worte konnten Schweißausbruch, Herzjagen und Kreislaufkollaps auslösen.
Im Fall des Jungen hatte der Täter sein Opfer bei Nacht auf den großen See nördlich der Stadt hinausgefahren und ihm erklärt, das Ufer sei viele Kilometer entfernt, er müsse entweder sterben oder um sein Leben schwimmen, weil er kein so guter Junge gewesen sei, wie seine Eltern von ihm verlangten. Dann hatte er ihn gezwungen ins Wasser zu springen und war mit seinem Motorboot in der Dunkelheit verschwunden.
Zum Glück gab es auf halber Strecke eine kleine Insel, und zwischen ihr und dem Ufer war der Wasserspiegel bis auf sechzig Zentimeter gesunken. Der arme kleine Kerl hatte von der Insel aus ohne sonderliche Mühe – wenn auch mit einer gehörigen Portion Angst in den Knochen, dass sein Peiniger wieder auftauchen könnte – das rettende Ufer erreicht.
Für Bertram gehörten solche Täter nicht schon von vornherein zu den Geisteskranken. Sie waren krank, kein Zweifel, aber nicht unbedingt geisteskrank.
Und meist waren sie nicht krank wegen ihrer Veranlagung, sondern weil irgendein Erlebnis in der Vergangenheit, wahrscheinlich in der Kindheit, sie dazu gebracht hatte, sich solche teuflischen Spiele auszudenken.
Sie mochten sogar gute Familienväter sein und Zuneigung zu ihren Kindern und ihrer Frau empfinden oder Weihnachten Skrupel haben, ihren Karpfen in der Wanne mit dem Hammer zu erschlagen. Sie wiederholten einfach zwanghaft, was ihnen selber widerfahren war, wie um dieses Erlebnis endlich zu verarbeiten oder sich davon distanzieren zu können.
Es gab kein Phantombild des Täters, weil der Junge nicht in der Lage gewesen war, Angaben über ihn zu machen. Er phantasierte von einer „großen Gestalt“, die ihn überwältigt und in die Kajüte des Motorboots gesperrt habe. Irgend jemand, der in seiner Erinnerung zu einer Mischung aus Superman und Killer aus Hollywood-Filmen geworden war. Aber Bertram hatte sich eine Liste aller Bootsbesitzer des Sees zusammenstellen lassen. Er war gerade dabei, die Namen zu studieren, als ihn ein Geräusch im Garten aufhorchen ließ.
Bertram blickte prüfend durch die Scheibe des Wintergartens, doch wegen der Dunkelheit konnte er nicht erkennen, ob es nur seine Katze oder ein Mensch war.
Er erhob sich, um nachzusehen, und als er die Glastür aufschloss, sah er für den Bruchteil einer Sekunde eine menschliche Gestalt zwischen den Bäumen stehen – zu kurz, um genug erkennen zu können. Gleich darauf zersplitterte die große Außenscheibe des Wintergartens, und ein, zwei Meter vor seinen Füßen landete ein schwerer, metallener Gegenstand.
Als er näher trat, sah er, dass es der rostige Eisenhaken eines Krans war …
Cilli parkte den schwarzen Rover am Ende der Straße, weil Harris sie sonst vielleicht durch eines der Fenster entdecken würde, bevor sie ihm erklären konnte, wie sie an den Wagen gelangt war. Sie passierte die großen Tonnen, die er zum Sammeln von Laub aufgestellt hatte, und in der Dunkelheit versuchte sie sich vorzustellen, wie es wohl war, irgendwo bei Sonnenuntergang mit dem Rover eine Landstraße entlangzufahren, gemächlich, ohne ein bestimmtes Ziel.
Der Motor schnurrte so gleichmäßig und leise, dass ihn die Windgeräusche übertönten. Ein Schloss, ein See glitten vorüber, von dessen Wasser Enten aufstiegen.
Es war, als säße sie immer noch im Wagen. Dort drüben standen ziegelgedeckte Häuser aus Felsstein, vielleicht in Irland oder in der Normandie. Und weiter hinten endeten die sanften grünen Hügel am Meer …
Sie hatte Harris nicht um Erlaubnis gefragt, ob sie den Wagen ihrer Mutter fahren durfte, denn schließlich war sie die rechtmäßige Erbin. Es gab zwar noch keinen offiziellen Bescheid darüber, dazu hätte Katrin erst von den Behörden für tot erklärt werden müssen. Aber wer wollte ihr das verweigern, gleichgültig, ob sie sich nur aus dem Staube gemacht oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen war?
Sie fand, es war noch kein Zeichen besonderer Habgier oder Gefühlskälte ihrer Mutter gegenüber, wenn sie sich den Rover aneignete.
Es wäre ihr ziemlich gleichgültig gewesen, was mit dem Wagen passierte. Totalschaden, explodiert, abgebrannt?
Na, gut, dann besorgte man sich eben einen neuen. War sowieso überfällig, weil die Zündkerzen gewechselt werden mussten. Katrins Verhältnis zum Geld unterschied sich wohltuend von dem des Spießers. Man brauchte zwar möglichst viel davon, aber wenn man es erst einmal besaß, dann verlor man fast jegliches Interesse daran und machte nicht mehr viel Wort darum.
Als sie durch den Garten ging, sah sie, dass sich diese Frau, die Harris vor einiger Zeit im Viertel aufgegabelt hatte, in ihren aufreizenden schwarzen Hosen auf der Couch des Salons lümmelte. Cilli hatte noch kein Wort mit Tea gewechselt. Aber vielleicht war ja jetzt die passende Gelegenheit, das nachzuholen – und Harris wegen des Wagens den Wind aus den Segeln zu nehmen?
Harris brachte Tea gerade etwas zu essen aus der Küche, als sie die Tür zum Salon öffnete. Er stellte das Tablett mit Lachs und Wein auf halber Strecke ab und sah Cilli fragend an.
„Schönen Tag gehabt, Kleines?“
„Und ob, ich bekomme nämlich den Job als studentische Hilfskraft ...“
„Was denn, doch nicht bei deinem schrecklichen Professor?“
„Doch, bei dem im Lichtschacht.“
„Und woher der plötzliche Sinneswandel?“
„Es war alles nur ein Missverständnis. Wir haben nicht die gleiche Studienausgabe für die Vorbereitung zur Klausur benutzt. Unsere Ausgabe war eine billige Raubkopie mit Kürzungen.“
„Was es nicht alles gibt …“, sagte Harris. Er nahm das Tablett und setzte es vor Tea auf dem Couchtisch ab. „Hab’ ich euch eigentlich schon miteinander bekannt gemacht?“
Tea schüttelte den Kopf. Sie hatte ein offenes, sympathisches Gesicht und sah gar nicht aus wie eine Nutte, fand Cilli. Vom hautengen Leder und dem albernen Handtäschchen mal abgesehen. Aber ihre Lippen waren auch nicht aufdringlicher geschminkt als bei einer nicht mehr ganz jungen Frau, die am Wochenende die Diskos unsicher machte.
„Oh, freut mich“, sagte Tea, als Cilli ihre Hand ausstreckte.
„Herzlich willkommen bei uns. Bleiben Sie länger? Ich meine, ist es was Ernstes mit Ihnen und Harris?“
„Kommt ganz darauf an, was Ihr Onkel mit mir vorhat.“
„Bei Tea ist es immer ernst“, sagte Harris und versuchte vergeblich, milde zu lächeln. Bei ihm sah es immer so aus, als arbeite er daran, mit der Zungenspitze eine lästige Zahnspange zu lösen. „Für die nächsten Tage hab’ ich sie erst mal bei uns in Sicherheit gebracht, weil ein paar Burschen im Viertel glauben, sie müssten ihre getürkte Krankenhausrechnung von einem Spezialisten eintreiben lassen.“
„Getürkte Rechnungen?“, fragte Cilli.
„Foller aus dem Monopoly und ein paar Hintermänner, für die er Geschäfte macht.“
„Ich dachte, du hättest den Stall längst ausgeräuchert?“, sagte Cilli. „Kein Mensch ist dreißig Jahre lang erfolgreich Polizist, ohne seine Stadt im Griff zu haben, es sei denn, er hätte sich seine Erfolge nur eingebildet …“
Tea lachte verhalten, wurde aber sofort wieder still, als sie Harris’ todernstes Gesicht sah.
„Man kann niemanden zwingen, ein Leben nach den Regeln des Gesetzes zu führen, nicht mal mit den überzeugendsten Argumenten“, sagte Harris missmutig. „Für viele dieser Burschen gilt immer noch: Alle halten sich an die Spielregeln. Mit einer Ausnahme, und das bin ich selbst.“
„Könnte auch aus einem Seminar über Moralphilosophie stammen“, sagte Cilli. „Ihr schwarzer Sheriff hat nämlich eine philosophische Ader, Tea. Es darf bloß keiner wissen, weil Intellektuelle so schrecklich kompliziert sind und so wenig erreichen. Aber wenn Sie ihn mal in einer schwachen Stunde erwischen, müssen Sie sich unbedingt anhören, was er über die Verbrecher und das Verbrechen denkt.“
„Ernsthaft?“, fragte Tea.
„Unsinn, ich versuche bloß meinen Verstand zu gebrauchen“, sagte Harris. „Und da reicht’s nun mal nicht, immer nur das übliche Alltagsgewäsch nachzubeten.“
„Ich bin gar nicht dafür, zuviel über alle möglichen Probleme nachzudenken“, gestand Tea. „Ob ihr mich nun für blöd haltet oder nicht: Es gibt auch so etwas wie eine Krankheit durch Denken. ‘Lasst uns eine Welt von Männern und Frauen mit Dynamos zwischen den Beinen schaffen’ – wisst ihr, wer das geschrieben hat? Henry Miller. Bloß nicht in dauerndes Grübeln versinken.“
„Kommen Sie, ich zeig Ihnen mal, wo dieser Verrückte – der Mädchenfänger – im Keller seine Opfer gepeinigt hat“, sagte Cilli und nahm Teas Hand. „Ich schreibe nämlich gerade eine Arbeit über den Kerl. Da unten gibt’s sogar einen Gynäkologenstuhl, auf dem sie angeschnallt wurden.“
„Und er hat seine Opfer wirklich eingemauert?“
„Na ja, wohl nur ein einziges Mal. Vor seiner Flucht, um nicht erwischt zu werden.“
„Sind die Männer denn alle verrückt?“, erkundigte sich Tea.
„Nach Harris’ Meinung sind wir alle verrückt, und nicht nur die Männer. Was heißt ‘Verrücktsein’ denn? Dass man von seinen wahren Interessen abgerückt ist. Man hält etwas anderes für vernünftig, liegt aber völlig falsch damit.
Harris sagt immer, die gefährlichsten Irren leben gar nicht in den Irrenhäusern. Die sehen nämlich bloß grüne Männchen, wo gar keine sind, oder halten sich für Napoleon. Die gefährlichen Irren sind unter uns, weil sie von ihren fixen Ideen verfolgt werden und dann andere damit tyrannisieren. Wie die Politiker, wenn sie die Atombombe bauen lassen oder den Krieg im Weltraum planen.“
„Sie sind gefährlich, weil sie für jede Verrücktheit plausible Gründe finden“, rief Harris ihnen nach.
„Ich find’s irre, dass Sie Ihren Onkel immer beim Nachnamen nennen“, sagte Tea, als sie die Kellertreppe hinuntergingen. „Huch, hier unten ist es aber unheimlich …“
„Nicht unheimlicher als in anderen Kellern. Das Haus ist nur etwas verbauter. Da drüben hing die ausgemusterte Flurgarderobe, hinter der ein geheimer Durchgang war. Die Vorbesitzer wussten gar nichts mehr vom Keller im Anbau. Quant hat das Mädchen in einem kleinen Apartment festgehalten. Er wollte sie nicht wirklich quälen, sondern ihr nur zeigen, dass sie ein genauso armseliges Stück Mensch war wie er selbst.“
„Und wozu?“, fragte Tea.
„Um sich von ihrer Schönheit zu befreien. Und um ihr zu demonstrieren, er sei nicht der einzige Verrückte auf der Welt. Weil er sich einsam fühlte.“
„Armer Kerl …“
„Na ja, ob man Mitleid mit ihm haben muss, weiß ich nicht. Der junge Quant war ganz schön rabiat.“
„Sind wir das denn nicht alle?“ Tea legte bedeutungsvoll ihren Finger vor den Mund und zeigte zur Decke. „Ihr Onkel ist auch ziemlich rabiat …“
„Als Mann, meinen Sie? Im Bett?“
„Bei welcher Gelegenheit sollte ein Kerl sonst rabiat werden? Doch wohl nicht, wenn es darum geht, fürs Rote Kreuz zu spenden? Er hat ein Gewehr zwischen den Beinen – und falls er Soldat oder Jäger ist, auch noch eins, um auf andere Lebewesen zu schießen, und die meisten Männer haben keine Skrupel, beides zu gebrauchen.“
„Hört sich ziemlich martialisch an. Ist Harris im Bett denn gewalttätig?“, erkundigte sich Cilli.
Tea schüttelte wortlos den Kopf, als habe sie schon zuviel gesagt. „Ich dachte immer, er sei ein lieber netter Kerl, der sich nur manchmal etwas eigenwillig gebärdet?“
„Also, ein harmloser Schluffen ist er nicht. Aber das erzähl’ ich Ihnen lieber ein andermal“, sagte Tea und bearbeitete vorgebeugt ihre Schläfen mit den Fingerspitzen.