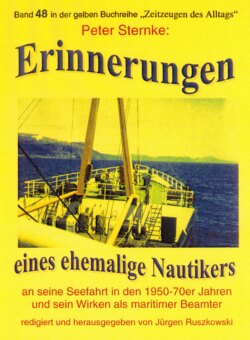Читать книгу Erinnerungen eines Nautikers an seine Seefahrt in den 1950-70er Jahren und sein Wirken als maritimer Beamter - Peter Sternke - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Flucht im Januar 1945
ОглавлениеKurz nach meinem 5. Geburtstag, zu dem ich ein rotes Schuco-Aufziehauto bekam, mussten wir uns vor den anrückenden Russen auf die Flucht begeben. Nach Erzählung oder nach vager Erinnerung war es ein sonniger, aber eiskalter Tag. Wir hatten das Nötigste, besonders die dicken Federbetten, auf das holzgasgetriebene Lastauto unseres Hauswirtes geladen, der uns nach Berlin mitnehmen wollte. Wegen der Kälte sprang das Auto jedoch nicht an, und wir stiegen mit allerkleinstem Handgepäck, in meinem Kinderköfferchen war das rote Schuco-Auto, in ein vorbeikommendes Wehrmachtsauto, weil die Soldaten uns drängten, unbedingt mitzukommen. Ursprünglich wollte meine Mutter mich wegen der Kälte in den Federbetten auf dem anderen Auto lassen. Wer weiß, ob meine Geschichte dann weitergegangen wäre.
In Schneidemühl haben uns die Soldaten abgesetzt, und wir blieben dort ein paar Tage lang in der verlassenen Wohnung von Bekannten, die schon geflüchtet waren, bis wir in einem der letzten, mit Flüchtlingen überfüllten, Züge weiter nach Berlin fuhren. Wir wollten zu Verwandten, die wir aber nicht finden konnten, weil sie ausgebombt worden waren. Nach langem Herumirren in der zerstörten Stadt und bei den Behörden fanden wir sie in einem kleinen Behelfsheim in Falkensee bei Berlin und blieben eine Zeitlang bei ihnen in dem kleinen Häuschen. Dort lebte auch noch meine Großmutter väterlicherseits. Sie war 84 Jahre alt, saß meistens unbeweglich in ihrem Lehnstuhl am Fenster und redete nicht viel. Ich hatte Angst vor der schwarz gekleideten hageren Frau, weil ich dachte, sie wäre eine Hexe.
Wegen der beengten Verhältnisse zogen wir weiter nach Lutherstadt Wittenberg zu einer anderen Schwester meines Vaters. Auf der Bahnfahrt durch das Industriegebiet von Leuna wurde der Zug mehrmals auf offener Strecke wegen Tieffliegeralarms angehalten. Wir mussten aussteigen und uns am Bahndamm verstecken, bis der Alarm vorbei war. In der Ferne konnte man brennende Fabrikanlagen sehen. In Wittenberg fand uns mein Vater wieder, der mit den Postleuten gesondert aus Bromberg flüchten musste.
Die Tante hatte gerade die Nachricht erhalten, dass einer ihrer Söhne gefallen war und befand sich in großer Trauer. Sie schimpfte verständlicherweise auf das Regime. Mein Vater erzürnte sich deswegen mit ihr. Er war zu der Zeit noch ein treuer Gefolgsmann und glaubte wohl auch an den versprochenen Endsieg durch Wunderwaffen. Mit seinen 52 Jahren und als Halbinvalide meldete er sich noch freiwillig zu einer paramilitärischen Landesschützeneinheit. Vermutlich befand er sich in einer Art Weltuntergangsstimmung, und ihm war alles egal, weil er ringsherum alles zerfallen sah, an das er geglaubt hatte. Später erzählte er mir, dass er bei der Bewachung von Kriegsgefangenen eingesetzt gewesen war. Kurz danach geriet er im Westen in amerikanische Gefangenschaft. Wir hörten bis zu seiner Entlassung im Hochsommer 1945 nichts mehr von ihm.
Meine Mutter hatte in Erfahrung gebracht, dass ihre beiden unverheirateten Schwestern nach ihrer Flucht aus Fraustadt in Drübeck bei Ilsenburg am Harz untergekommen wären, und sie wollte zu ihnen. Für einige Zeit krochen wir bei den beiden Tanten unter und wohnten mit ihnen zusammen in einem winzigen Zimmerchen in einem Gasthaus am Waldrand. Für mich war das eine schöne Zeit, weil ich mit anderen Kindern aus dem Haus ungefährdet herumstrolchen und spielen konnte. Die Idylle, die eigentlich gar keine war, endete, als die Organisation Todt das Gasthaus für sich beschlagnahmte. Die Organisation Todt war eine nach militärischem Vorbild organisierte Bautruppe, die u. a. Bunker und Befestigungen baute.
Zum Glück erinnerte sich meine Mutter, dass ganz in der Nähe in Wernigerode die wiederverheiratete Frau eines im 1. Weltkrieg gefallenen Bruders meines Vaters lebte. In ihrem Haus war gerade ein Zimmer freigeworden, und wir konnten bei ihr einziehen. Die Tanten fanden auch eine Unterkunft in Wernigerode. So endete Anfang April 1945 erst einmal unsere Odyssee. Alle Lasten lagen während der ganzen Zeit nur auf den Schultern meiner Mutter und meiner 23jährigen Schwester, und man fragt sich jetzt, wie sie es eigentlich geschafft haben.
Im Haus wohnten noch die verheiratete Tochter (meine Cousine) mit Mann und zwei Söhnen. Der ältere war so alt wie ich. Sein Bruder lag noch in den Windeln. Wir lebten in dem kleinen Haus in der Großen Dammstraße in einem Zimmer. Die Küche war unten im Keller. Dort saßen wir oft alle zusammen bei Kerzenlicht am Herd, weil mal wieder Stromsperre war und aßen frisch gedünstete Schweinekartoffeln mit Salz, für uns damals eine Delikatesse.
Tantes Mann konnte spannende und lustige Geschichten erzählen, über die die Erwachsenen oft lachten, was wir Kinder manchmal nicht so richtig verstanden.
In besonderer Erinnerung sind mir die jährliche Hausschweineschlachtung und das Zuckerrüben-Sirupkochen geblieben. Wir Jungens hatten für das Feuer im Waschkessel zu sorgen, in dem entweder das Schwein abgebrüht oder der ausgepresste Zuckerrübensaft so lange gekocht wurde, bis sich der braune, zähflüssige Sirup bildete.
Gegenüber dem Haus lag ein großes Getreidefeld, auf dem wir nach der Ernte stoppeln durften. Die Erträge waren aber gering, weil noch viele andere Leute auf dem Feld waren.
Im Hochsommer 1945 kam mein Vater krank und verhungert aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft nach Hause. Er war über drei Monate lang bei Sinzig am Rhein in einem der berüchtigten Gefangenenlager in den Rheinwiesen interniert gewesen. Zigtausende deutsche Gefangene mussten dort monatelang in stacheldrahtumzäunten Pferchen unter freiem Himmel vegetieren. Sie hatten sich mit bloßen Händen Erdlöcher gegraben, um vor dem kalten Wind etwas Schutz zu finden. Die Verpflegung war so gering, dass mein Vater rohe Brennnesseln gegessen hat, um seinen Hunger etwas zu betäuben. Die Menschen waren so entkräftet, dass einige bei Regen in ihren voll gelaufenen Erdlöchern ertranken. In einer darauf folgenden Trockenperiode litten die Menschen unter Durst, weil sie nicht an die wenigen Wasserbehälter herankamen. In den langen Schlangen, die sich vor den mit Rheinwasser gefüllten Tanks bildeten, kippten die verdursteten Männer oftmals einfach tot um. Über diese Gräuel findet man in den gleichgeschalteten Medien natürlich nichts.
Nun lebte noch ein Mensch mehr in dem kleinen Zimmer und musste ernährt werden.