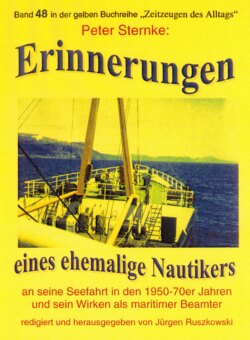Читать книгу Erinnerungen eines Nautikers an seine Seefahrt in den 1950-70er Jahren und sein Wirken als maritimer Beamter - Peter Sternke - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1954 bis 1956
ОглавлениеHamburg, Neuß, Wevelinghoven
Mein Vater hatte die DDR aus wirtschaftlichen, aber auch aus sicherheitsmäßigen Gründen gerade noch rechtzeitig verlassen. Bei der Verschärfung der Überwachung und Bespitzelung der Bürger in den folgenden Jahren vor und nach dem Mauerbau wäre er wegen seiner nationalistischen Gesinnung bestimmt in Schwierigkeiten geraten. Meine Mutter und meine Schwester blieben noch so lange in Wernigerode, bis sich die ganze Lage geklärt hatte. Ich hätte die Oberschule in Wernigerode besuchen dürfen, wollte meine Schulausbildung aber lieber im Westen fortsetzen.
An einem Tag im Juli 1954 setzte ich mich also auf mein Fahrrad und machte mich auf den Weg in den Westen. Als Gepäck hatte ich einen alten Rucksack mit ein paar Sachen und Proviant auf den Gepäckträger geschnallt. Mein erspartes Geld, vielleicht 50 Ostmark, hatte ich an einem Faden hängend im Fahrradrahmen unter dem Sattel versteckt. Der Umtauschsatz im Westen war 1:4. Die Grenze passierte ich unbehelligt an der Grenzübergangsstelle Helmstedt. Mein Ziel war an dem Tag das kleine Dörfchen Örrel bei Hankensbüttel in der Lüneburger Heide, in dem mein Onkel Ernst, ein Bruder meiner Mutter, nach seiner Flucht aus Ilsenburg eine Anstellung als Lehrer an einer winzigen Einklassenschule gefunden hatte. Ich hatte Mühe, das kleine Dorf in der Heide zu finden und war heilfroh, als ich spätabends kaputt und müde ankam.
Ich wurde von Onkel und seiner Frau liebevoll versorgt. Nach etwa einer Woche setzte ich meine Reise nach Hamburg fort. Es war ein stürmischer und regnerischer Tag. Deshalb fuhr ich nur bis zum Bahnhof Uelzen und löste mir dort für die fünf Westmark, die ich als Notgroschen vom Onkel bekommen hatte, eine Fahrkarte nach Hamburg.
Die große Hamburger Bahnhofshalle imponierte mir bei meiner Ankunft gewaltig. Das Lager, in dem mein Vater lebte, lag im Stadtteil Wandsbek, und es war noch ein weiter Weg dorthin durch die noch sehr zerstörte Stadt.
Das Auffanglager für die DDR-Flüchtlinge befand sich in der Lettow-Vorbeck-Kaserne. Ich wurde als achter Bewohner im selben Zimmer untergebracht, in dem mein Vater zusammen mit anderen Männern unter menschenunwürdigen Umständen hauste. Eine Privatsphäre oder irgendeine Rückzugsmöglichkeit bestand nicht. Man bekam von allen Mitbewohnern alles mit. Und das war ein zusammengewürfelter Haufen Strandgut aus Krieg und Vertreibung! Gemeinschaftswaschräume und Küchen lagen auf dem Flur. Jeder musste für seine Verpflegung selbst sorgen. Den Familien ging es auch nicht besser. Zwei oder drei Familien hausten in einem Zimmer, nur durch aufgehängte Decken voneinander getrennt.
Mein Vater hatte keine Arbeit und musste mit dem wenigen Überbrückungsgeld sehr haushalten. Oft gab es Heringe, die damals noch sehr billig waren – Hering gebraten, Hering gekocht, Hering in Gelee und Hering in Sauer. Seitdem esse ich Hering immer noch gerne. Seltsamerweise konnte ich abends in meinem oberen Bett trotz Lärm, Zigarettenrauch und Bierdunst sofort einschlafen. Das habe ich später nie mehr geschafft.
Ich brauchte nicht zur Schule gehen und lungerte tagsüber auf dem Kasernengelände herum oder fuhr mit meinem Vater mit der Straßenbahn nach Hamburg. Erinnern kann ich mich an die Gartenbauausstellung in den Wallanlagen, an das Bismarck- Denkmal und an die Elbe.
Damit die Jugendlichen im Lager nicht total verlotterten, kümmerte sich die evangelische Kirche vorbildlich um sie. Ein Diakon Dietrich führte mit den Kindern 14tägige Ausflugsfahrten durch. Ich konnte an drei Freizeiten in die Görde, in den Harz nach Lautental und an die Ostsee nach Heiligenhafen teilnehmen.
Schülerheim in Neuß
Mein Vater hatte über die Kirche erreicht, dass ich zukünftig weiter zur Oberschule gehen sollte. Ende Oktober 1954 wurde ich in ein evangelisches Schülerheim in Neuß am Rhein geschickt. Das Heim befand sich in einem großen umgebauten Einfamilienhaus und beherbergte etwa 25 Jungen aus der sowjetischen Besatzungszone, die am Neußer Gymnasium auf das Abitur vorbereitet werden sollten. Wir waren zu fünft in einem Zimmer untergebracht. Es war beengt, aber viel angenehmer als im Lager. Mein Zimmer war an der einen Längswand mit Spanholzplatten in vier Boxen ohne Türen aufgeteilt, in der je ein Bett und ein schmaler Schrank standen. An der anderen Längswand stand noch ein freistehendes Bett in der Ecke am Fenster, das von allen Seiten eingesehen werden konnte. Das war in den ersten Wochen meine Schlafstatt. Später konnte ich in eine Box umziehen. Schularbeiten wurden gemeinsam an einem Tisch gemacht. Es war schon sehr beengt, und man fiel sich manchmal gegenseitig auf den Wecker.
Da wir in der DDR außer Russisch keine anderen Fremdsprachen gelernt hatten, mussten wir Heimkinder erst einmal vom 3.11.1954 bis zum 22.09.1956 in einem SBZ-Sonderkurs auf den Wissenstand unserer westlichen Altersgenossen gebracht werden. In der Zeit hatten wir mit den normalen Schülern wenig Kontakt. In knapp zwei Jahren holten wir den sechsjährigen Vorsprung unserer Altersgenossen in Latein und Englisch auf. Dabei blieben etwa 20 Mitschüler auf der Strecke, die das große Lernpensum nicht schafften.
Die Schule ließ uns nicht viel Zeit für Vergnügungen. Manchmal durften wir abends bis 22:00 Uhr in ein nahe gelegenes Lehrlingsheim gehen, um dort eine Fernsehsendung anzusehen. Im Hause hatten wir eine Tischtennisplatte.
1956 absolvierte ich mit noch einigen Mitbewohnern einen Tanzkursus. Das gehörte mit zur Erziehung. In der ersten Stunde saßen sich Jungen und Mädchen gegenüber. Auf ein Signal des Tanzlehrers sollten wir Jungen uns in Bewegung setzen und uns unsere Tanzpartnerin aussuchen. Leider schnappte mir ein anderer das Mädchen weg, das ich mir ausgeguckt hatte. In meiner Not nahm ich die nächstbeste andere. Es war eine Bauerntochter aus Wevelinghoven, die in Neuß Goldschmiedin lernte. Sie war ganz nett, aber es entwickelte sich nichts weiter. Tanzen lernte ich auch nicht gut. Bei unserem Tanzlehrer hatten schon die Mütter unserer Tanzdamen dieselben Schritte gelernt wie wir.
Da wir in einer streng katholischen Gegend lebten, mussten wir als Evangelische auch Flagge zeigen. Das bedeutete, dass wir jeden Sonntag zur Kirche gehen mussten. Später, wenn wir wussten, dass unser Heimleiter nicht in der Kirche war, umgingen wir diese Pflicht. Wir zogen uns unsere Badehosen an, banden uns ein Handtuch unters Hemd und gingen statt in die Kirche in das Hallenbad.
Unser Heimleiterpaar kam wie wir alle aus dem Osten. Es waren nette Leute, die ihre liebe Not mit uns pubertierenden Jungen hatten. Der Mann hatte wenig Autorität bei uns. Da war seine Frau schon ein anders Kaliber. Man legte sich mit ihr besser nicht an. Sie sorgte dafür, dass wir als praktisch Elternlose im Leben zurechtkamen. Sie brachte uns das Wäschewaschen und Hemdenbügeln bei und versuchte, uns mit Kultur in Berührung zu bringen. Wir mussten uns von unseren 20,- DM Taschengeld im Monat ein Theaterabonnement kaufen. Jetzt weiß ich, dass wir damals in Düsseldorf bedeutende Aufführungen mit berühmten Schauspielern, wie Gustav Gründgens und W. Quadflig zu sehen bekamen.
Nachdem wir etwas tanzen und uns zu benehmen gelernt hatten, wurden im Heim manchmal unter strenger Aufsicht eines Pastors und unseres Heimleiters Tanztees mit Schülerinnen aus dem Mädchengymnasium veranstaltet. Das war immer ganz lustig und führte auch zu Verabredungen.
Mein Freund und ich hatten uns für den folgenden Sonntag mit einem Geschwisterpaar in der Kirche verabredet. Wir Jugendlichen saßen in der Kirche auf den seitlichen Emporen, fein säuberlich nach Geschlecht getrennt, die Jungs auf der einen und die Mädchen auf der anderen Seite. Unsere Auserwählten bestanden stur darauf, dass wir uns, wenn uns etwas an ihnen läge, auf der Mädchenseite neben sie setzen müssten. Es war eine große Herausforderung für uns, und mit großer Überwindung gingen wir auf die andere Seite und saßen vor Scham erstarrt unter den Blicken des Pastors und der Kirchenbesucher neben den Mädchen, deren Oberweite vor Stolz zu platzen schien. Zu allem Überfluss setzte meine Dame auch noch eine Sonnenbrille auf. Das schlug dem Fass den Boden aus und beendete erst einmal mein Bedürfnis nach Nähe zum anderen Geschlecht. Ich glaube, der Vorfall hat auch meinen Freund fürs Leben geprägt, denn er wurde später schwul.
1955 wurde mein Vater aus Hamburg auch in das Rheinland geschickt. Da keine Wohnung zu bekommen war, musste er in dem kleinen Dorf Gohr bei Neuß wieder in einem Lager leben. Es war ein Gasthaussaal, in dem etwa zehn Familien in mit Pappwänden abgeteilten Boxen wohnten. Mein Vater hatte das Glück, in seinem Kabuff wenigstens ein Fenster zu haben. Manche Zimmerchen waren ohne. Wenigstens konnte man eine Tür hinter sich zumachen. Gekocht wurde auf einem großen Gemeinschaftsherd, der im Saal auch als Heizung diente.
Mein Vater hatte in einem Postamt Arbeit als Postfacharbeiter gefunden, das ganz in der Nähe meines Heimes lag. So konnte ich ihn nach der Schule oft besuchen und im warmen ruhigen Postkeller ungestört Vokabeln büffeln. Meistens fuhr ich am Sonntag mit dem Fahrrad 15 km weit nach Gohr und besuchte ihn.
In den Herbst- und Winterferien verdienten sich einige von uns etwas Geld dazu. Ich jobbte in einer Sauerkrautfabrik und in einem Werk, das Fensterbänke aus Kunststein herstellte. In den großen Ferien fuhr ich 1955 mit dem Fahrrad in drei Tagen zu meinem Cousin Helmut Sternke nach Bremen-Vegesack. Er war dort selbständiger Malermeister und 18 Jahre älter als ich. Bei ihm lernte ich etwas Tapezieren und Malen, was mir später von Nutzen war. Wir haben uns über die Jahre immer wieder mal getroffen.
1956 in den Sommerferien blieb ich im Heim in Neuß und arbeitete sechs Wochen lang als Hilfsarbeiter auf einem Bau, während die anderen Mitschüler zu ihren Familien nach Hause fuhren. Auf dem Bau musste ich die Aufenthaltsbaracke der Bauarbeiter sauber machen, Bier und Essen einkaufen, tagelang Nägel aus Schalbrettern klopfen und zwischendurch andere Hilfsarbeiten verrichten.
Für das verdiente Geld kaufte ich mir ein neues Fahrrad, das mir nach einem halben Jahr bei einem gemeinsamen Ausflug am 1. Mai gestohlen wurde. Darauf spendeten alle Heiminsassen Geld, mit dem ich mir ein anderes Fahrrad kaufen konnte. Man muss wissen, dass wir damals 20,- DM Taschengeld im Monat bekamen. Das klingt zwar viel, aber wir mussten davon alle Ausgaben für unseren Schulbedarf bezahlen. Da blieb nach Abzug von ein paar Mark für Süßigkeiten und Kinokarten kaum etwas übrig. Ich rechnete meinen Kameraden ihre Großzügigkeit hoch an. Zum Glück bekam ich einige Wochen später das gestohlene Rad von der Polizei zurück. Ich verkaufte es und zahlte das gespendete Geld mit Dank wieder zurück.
Im Herbst 1956 wurden wir auf verschiedene Gymnasien in Köln, Düsseldorf und Umgebung aufgeteilt. Ich kam mit vier anderen Mitschülern auf das Lessing-Gymnasium in Düsseldorf in eine reguläre Klasse. Das bedeutete, dass wir jeden Tag stundenlang mit der Straßenbahn zwischen Neuß und Düsseldorf pendeln mussten. Da wir in der Zeit davor hauptsächlich Sprachen nachzuholen hatten, war unser anfangs vorhandener Wissensvorsprung in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Biologie verloren gegangen. Ich fühlte mich an dem Gymnasium nicht besonders wohl und bekam hauptsächlich in Mathematik Probleme.
Anfang 1957 bekam mein Vater endlich eine Wohnung in Wevelinghoven zugeteilt, und Mutter und Schwester konnten nach drei Jahren Trennung aus Wernigerode nachkommen. Der Ort lag am Flüsschen Erft, etwa 20 km von Neuß entfernt in der Nähe der Stadt Grevenbroich.
Den Anordnungen der Kirchenbehörde gemäß musste ich jetzt das Heim in Neuß verlassen. Von Wevelinghoven aus bestand keine Möglichkeit, in akzeptabler Zeit nach Düsseldorf zu kommen. Das Gymnasium in Grevenbroich war altsprachlich und für mich nicht geeignet. Ich wollte auch nicht mehr weiter zur Schule gehen und lieber einen Beruf erlernen, aber welchen? Mein Vater hätte wohl gerne gesehen, wenn ich wie er eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen hätte. Auf dem Arbeitsamt versuchte man mir den Bergmannsberuf schmackhaft zu machen, weil zu der Zeit gerade Bergleute gebraucht wurden. Zu allem hatte ich keine Lust. Ich wollte nicht im Büro sitzen und auch nicht unter Tage ohne Licht und Sonne arbeiten. Da fiel mir eine Broschüre in die Hände, in welcher der Weg zum Seemannsberuf beschrieben wurde. Dafür hatte ich mich durch meine Leserei schon immer interessiert und ich bildete mir ein, mir ein objektives Urteil über den Beruf machen zu können. So entschloss ich mich, Seemann zu werden. Meine Eltern stimmten notgedrungen und schweren Herzens zu.
Ostern 1957 verließ ich das Gymnasium mit der Versetzung in die Unterprima, zwei Jahre vor dem Abitur und mit einer Fünf in Mathematik im Zeugnis. In der Rückschau war dieser Entschluss einer der wichtigsten in meinem Leben. Alles, was danach geschah, hing mit ihm zusammen und von ihm ab. Mein Leben wäre sonst völlig anders verlaufen.
In den Pfingstferien 1957 machte ich mit zwei Freunden noch ein schöne Fahrradtour über Koblenz, an der Mosel entlang bis Trier und durch die Eifel zurück.
Meine Heimkameraden brachten die Schule zu Ende. Zwei von ihnen studierten auf Lehramt und wurden Studienräte, einer wurde Mathematiker, einer Arzt, einer Chemieingenieur, einer Bauingenieur und einer folgte mir zur Handelsschifffahrt nach. Später wechselte er zur Bundesmarine und machte dort seine Karriere. Wir halten alle immer noch Kontakt untereinander. 2004 hatten wir in Neuß unser 50jähriges Heimjubiläum.
Wer zur See fahren wollte, konnte entweder sofort auf einem Schiff anmustern oder nach einer neueren Bestimmung erst eine dreimonatige Seemannsschule besuchen, um die Grundlagen des Berufes kennenzulernen. Ich meldete mich in Hamburg an. Wegen Überfüllung erhielt ich erst zum Oktober 1957 eine Zusage. In der Zwischenzeit arbeitete ich als städtischer Arbeiter bei der Stadt Grevenbroich, um mir die 350 DM Schulgeld zu verdienen. Hauptsächlich war ich zusammen mit einem älteren Gärtner in einem verwilderten Privatpark eines ehemaligen Webereibesitzers eingesetzt, den die Stadt übernommen hatte. Wir machten ihn begehbar, indem wir Wege und Rasenflächen anlegten. Der Rasen wurde noch mit einem Handrasenmäher gemäht, was Tage dauerte. Manchmal wurde ich auch zum Mähen und Papiersammeln im Schwimmbad, zum Fähnchenaufhängen zur Kirmes und zum Ausheben von Gräbern auf dem Friedhof eingesetzt. Dabei gruben wir einmal die Knochen eines ehemaligen Bekannten des alten Gärtners aus, die ich zu einem vollständigen Skelett zusammensetzte. Das fand er gar nicht lustig. Der Gartenbaumeister der Stadt fand, dass ich Begabung als Gärtner hätte und bot mir an, eine Lehre anzufangen. Hätte ich annehmen sollen? Die Spuren meines Wirkens sind in dem Park in Grevenbroich noch zu sehen.