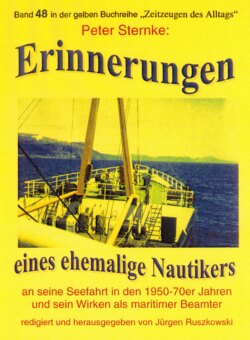Читать книгу Erinnerungen eines Nautikers an seine Seefahrt in den 1950-70er Jahren und sein Wirken als maritimer Beamter - Peter Sternke - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schulzeit in Wernigerode
ОглавлениеIm Sommer 1946 wurde ich in die Diesterweg-Schule eingeschult, die ich gemäß dem damaligen DDR-Schulsystem acht Jahre lang besuchte.
Mein Lehrer in der 1. Klasse war ein schon lange pensionierter, strenger Lehrer, der den Schülern schon mal mit dem Lineal auf die Finger schlug. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das auch geschehen ist. Eigentlich war ich die ganze achtjährige Schulzeit lang ein wiss- und lernbegieriger Junge, der sehr gerne zur Schule ging.
Das änderte sich erst später im Westen auf dem Gymnasium. Besonders die ersten Schuljahre waren von der allgemeinen Not und Armut überschattet. Es fehlte an allem, an Kohle zum Heizen, an Schulheften und Büchern, Schreibpapier, Bleistiften, warmer Kleidung und an Schuhzeug. Über zwei, drei Jahre lang hatten wir wegen mangelnder Klassenräume und Lehrer abwechselnd eine Woche vormittags und eine Woche nachmittags Unterricht.
Irgendwann wurde im Schulkeller eine Schulspeisung eingerichtet, an der ich von Anfang an bis zum Ende der Schulzeit 1954 teilnahm. Meistens gab es Suppe. Besonders erinnere ich mich in den ersten Jahren an die dunkelbraune süße Belotinsuppe mit Bestandteilen aus Eichelmehl. Mein Essgeschirr bestand aus einer umgearbeiteten Granathülse.
1948 zogen wir in eine eigene Wohnung in der Straße Sandbrink im Ortsteil Hasserode. Sie lag im Haus eines ehemaligen Schuldirektors und war auch nicht groß genug für uns alle. In der Zeit entwickelten sich die ersten festen Freundschaften. Mein bester Freund im Sandbrink wurde ein Junge aus dem Sudetenland. Er hatte einen tollen Märklinbaukasten gerettet, und wir betrieben einen ausgedehnten Tausch- und Leihhandel mit den Teilen. Manchmal hatte ich mehr Bauteile bei mir zu Hause als Jürgen. Das änderte sich erst nach Intervention seiner Eltern. In einem Jahr bekam ich zu Weihnachten ein großes handgearbeitetes Lastautomodell mit Anhänger geschenkt. Meine Mutter hatte es einem im Hause wohnenden Feinmechaniker für einen Sack Mehl abgetauscht. Leider ist das Auto nicht mehr in meinem Besitz. Es landete nach einigen Jahren als Tauschobjekt bei einem meiner Freunde. Heute wäre es eine wertvolle Rarität.
Damals spielten die Kinder aus einer Straße viel draußen zusammen. Es bildeten sich Straßenbanden, die auch mal gegeneinander kämpften. Schlecht war es, wenn man alleine durch feindliches Gebiet durch musste. Da wurden schon mal lange Umwege in Kauf genommen. Besonders erinnere ich mich an die Versteckspiele in den Nachbargrundstücken bis in die Dunkelheit hinein. Als Kind kamen einem die Grundstücke sehr groß und die Wegstrecken sehr lang vor. Bei späteren Besuchen wunderte man sich wie klein alles war.
In den warmen Sommerwochen verbrachten wir unsere Freizeit im Freibad, und ich lernte dort alleine das Schwimmen. Als kleine Jungen mussten wir das Bad um 18:00 Uhr verlassen. Wir machten uns einen Sport daraus, die Zeit so lange wie möglich zu überziehen. Um die paar Pfennige Eintritt zu sparen, kletterten wir an einer uneinsehbaren Stelle über den Zaun. Dabei wurden wir schon mal vom Bademeister erwischt und aus dem Bad gejagt.
Ich habe damals schon viel Zeit mit Lesen verbracht, war Mitglied in allen Büchereien im Ort, sogar in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, in der es eine kleine Bibliothek gab und verschlang alles Lesbare, das mir in die Finger kam, ob ich es verstand oder nicht. Außerdem sammelten wir schon Briefmarken.
Das führte zu meiner ersten „Straftat“. Im Nachbarhaus wohnten zwei Brüder, deren Onkel ein Schreibwarengeschäft mit Leihbücherei betrieb, in der ich auch Mitglied war. Die Brüder erzählten uns, dass beim Onkel auf dem Hinterhof ein Schuppen stände, in dem viel altes Papier und Briefe lägen. Das wollten wir untersuchen und zogen mit einem Leiterwagen los. Leider war der Schuppen verschlossen. Wir brachen das Schloss auf und luden unseren Leiterwagen mit alter Geschäftspost voll. Zu Hause teilten wir die Beute. Es waren wirklich schöne Briefmarken dabei, bis aus der Kaiserzeit. Einige Tage später bekamen meine Eltern vom Amtsgericht eine Vorladung. Der Onkel hatte Anzeige erstattet. Meine Mutter und ich gingen zum Gericht, an dem gleich das Gefängnis angebaut war. An den Fenstern sah man die Gefangenen stehen, und ich sah mich auch schon dort. Nach dem Verhör, in dem ich kleinlaut und reuig die Schuld auf die Brüder schob, die ich sowieso nicht leiden konnte, bekam ich die Auflage, mich bei dem Onkel zu entschuldigen. Das fiel mir sehr schwer. Aber weil ich weiter seine Bücher lesen wollte, entschuldigte ich mich doch, und mir wurde verziehen. Was meine arme Mutter mitgemacht hat, kann ich nur ahnen. Meine erste Briefmarkensammlung verkaufte ich vor meinem Weggang in den Westen an einen Händler, der mich bei dem Geschäft ordentlich übers Ohr gehauen hat. Wie gewonnen, so zerronnen.
Weil meine Schwester aus einem Dorf bei Magdeburg als Lehrerin an die Thomas-Müntzer-Schule in Wenigerode versetzt worden war und bei uns wohnen wollte, zogen wir 1950 in den ersten Stock eines kleinen alten Fachwerkhauses in der nicht weit entfernten Straße Unter dem Ratskopf 50. Damit ging für mich eine schöne Zeit zu Ende, weil in der Straße nicht so viele gleichaltrige Kinder wohnten. Außerdem war ich ja schon 10 Jahre alt, die Schule stellte höhere Anforderungen, und meine Schwerpunkte verlagerten sich.
Die Wohnung lag im Obergeschoss und bestand aus lauter schrägen Zimmern. Nur das kleine Wohnzimmer hatte gerade Wände mit zwei normalen Fenstern und einem kleinen Kachelofen. Die Küche in der Dachabseite war mit einem alten schwarzen Kleiderschrank als Küchenschrank, einem Tisch, dahinter einer Liege und einem kleinen flachen Aluminiumkochofen, einer so genannten „Kochhexe" möbliert. Kaltwasser bekamen wir aus einem Wasserhahn über einer gusseisernen Spüle. Die beiden kleinen und dunklen Schlafzimmer lagen auch in der Dachabseite und hatten je ein eine kleine, bis auf den Fußboden reichende Fensterluke wie in der Küche.
Unsere Matratzen bestanden aus mit Holzwolle gefüllten Säcken, die nach einiger Zeit steinhart wurden. Im Winter war manchmal morgens Eis an den Schlafzimmerwänden. Abends nahmen wir angewärmte Ziegelsteine mit ins Bett. Das Familienleben spielte sich meistens in der Küche ab, weil es da noch am wärmsten war. Mein bevorzugter Platz war die Liege, auf der ich abends, wenn mein Vater zu seiner Nachtarbeit war, bis spät rumlag und las. Das Wohnzimmer wurde von meiner Schwester als Arbeitszimmer benutzt. Später konnte ich dort auch meine Schularbeiten machen.
Die Küche diente auch als Badezimmer. Die Katzenwäsche wurde unter dem Kaltwasserhahn erledigt. Am Wochenende wurde manchmal in einer Zinkwanne gebadet. Später gab es im Ort eine Badeanstalt, wo man für 50 Pfennige ein Wannenbad nehmen konnte.
Es gab auf dem Hof zwei Toiletten, so genannte Plumpsklos, mit einer Grube unter dem Holzsitz, natürlich ohne Licht. Im Dunkeln mussten wir eine brennende Kerze mitnehmen, die auf dem Weg zum Örtchen oft genug ausging. Dann saß man im Dunkeln und graulte sich. Klopapier gab es auch nicht. Man benutzte zerrissenes Zeitungspapier, das geknüllt und gerubbelt wurde, damit es etwas weicher wurde.
Für mich waren Haus, Hof und Garten ein schönes, wenn auch verbotenes Spielrevier. Der alte Hauswirt war Postbeamter gewesen und hatte noch viele alte Bücher aus der Kaiserzeit auf dem Boden liegen. Heimlich stöberte ich oft auf dem Boden in den alten Sachen und Büchern herum. Ich konnte auch die verschlossene Tür einer kleinen Kammer neben unserer Wohnung mit einem selbst gebastelten Dietrich öffnen. Darin lagen auch viele interessante Sachen, unter anderem ein dickes Bündel mit Inflationsgeld. Ich habe aber immer alles wieder an seinen Platz gelegt und nichts mitgenommen.
Der Hauswirt hatte als Soldat schon an dem 1871er Krieg gegen die Franzosen als Lanzenreiter (Ulan) teilgenommen.
In einer Ecke im Hof standen noch die Lanzen mit den langen eisernen Spitzen. Ich attackierte damit die Obstbäume im Garten hinter dem Haus. Die Löcher müssen jetzt noch in den Bäumen sein.
Um die Ernährung etwas aufzubessern, hielt mein Vater im Hof bis zu 30 Kaninchen. Hühner hatten wir auch, so dass wir genug Fleisch und Eier hatten. Wenn mein Vater schlachtete, machte sich meine Mutter immer aus dem Staub. Sie bereitete die Kaninchen in allen Variationen zu, aß selbst aber keinen Happen davon. Ich weiß nicht, ob sie sie verabscheute, oder ob sie ihr Leid taten. Meine Schwester ließ die Karnickel manchmal frei im Hof herumlaufen. Es dauerte oft sehr lange, bis wir sie wieder einfangen konnten. Die Futtersuche war ein Problem, weil wir keine Wiese zum Gras- und Heumachen hatten. Mein Vater holte mit dem Leiterwagen auf langen und mühsamen Wegen Brennnesseln aus dem Wald, die von den Karnickeln frisch und getrocknet gerne gefressen wurden. Ich half meinem Vater dabei so gut ich konnte. Meine Aufgabe war es auch, von meinen Tanten, die etwa fünf Kilometer von uns entfernt wohnten, die Kartoffelschalen als Futter zu holen. Für meine kurzen Beine war das ein ganz schön weiter Weg.
Die Kaninchenfelle konnte man für Zuckermarken und 50 Pfennige zu einer Sammelstelle bringen. Das Geld durfte ich als Taschengeld behalten. Meistens gab ich es für meine zweite Leidenschaft neben dem Lesen, dem Kinobesuch aus. Es gab zwei Kinos im Ort. Am Sonntagnachmittag gab es für 50 Pfennig Eintritt eine Kindervorstellung, die ich sehr oft besuchte. Die Kinos waren meistens voll besetzt und dienten auch als Treffpunkt mit den Freunden. Mädchen spielten noch keine Rolle bei uns.
Sehr schön waren die russischen Märchenfilme und später auch die von der DEFA, z. B. „Der kleine Muck“, „Das steinerne Herz“ und andere. Oft wurden auch patriotische russische Kriegsfilme gezeigt.
Als ich so 12, 13 Jahre alt war, gelang es mir manchmal, mit Erwachsenenbegleitung in eine Abendvorstellung zu kommen. Das war immer besonders aufregend, weil es vor dem Film eine Bühnenschau mit Künstlern gab. In den Filmen gab es schon mal Sachen zu sehen, von denen man andeutungsweise etwas ahnte, aber konkret noch nichts wusste. Aufklärungsunterricht gab es damals an den Schulen nicht.
An meine Schulzeit erinnere ich mich gerne. Ich hatte nach meinem Verständnis gute Lehrer und war ein guter Schüler, obwohl ich durch mein konservatives Elternhaus mit dem ganzen sozialistischen Kram nicht viel anzufangen wusste. Zu meiner Zeit wurde das alles auch noch nicht so verbissen durchgezogen.
Irgendwann bin ich auch bei den Jungen Pionieren eingetreten, weil alle drin waren und man dadurch viele Vorteile hatte. Hinter unserem Haus war ein Park mit einer alten Villa drin, die als Pionierhaus diente. Dort gab es eine Bibliothek, und es wurden Kurse abgehalten. Ich lernte dort das Fotografieren und das Entwickeln von Filmen und Abziehen von Bildern.
Damals gab es im Harz noch Schneewinter. Ich konnte schon etwas Ski fahren. Die Ausrüstung war natürlich nicht mit der heutigen vergleichbar. Ich hatte ein Paar Holzskier, deren Kanten ganz abgerundet waren, so dass man kaum eine Kurve fahren konnte. Die Lederriemenbindung hielt nicht, und man verlor oft einen Ski. Ordentliche Skischuhe hatten wir auch nicht. Wir fuhren mit unseren normalen Winterschuhen.
Im Winter 1952 wurde ich von der Pionierorganisation zu einem Skikursus ins weit entfernte Vogtland geschickt. Ich sollte danach an den Landespioniermeisterschaften von Sachsen-Anhalt in Schierke am Brocken teilnehmen. Es war das erste mal, dass ich alleine so weit von zu Hause weg war, und ich hatte fürchterliches Heimweh.
Um wieder nach Hause zu kommen, ließ ich nacheinander fast meine ganze Familie sterben, bis sie mich tatsächlich nach Hause schicken wollten. Am Abreisetag ging es mir besonders gut, und ich beschloss, nun doch dort zu bleiben. Seitdem habe ich nie wieder Heimweh gehabt. Die Meisterschaft war kein großer Erfolg für mich. Mein bester Rang war der 21. Platz im Abfahrtslauf.
Bei den Jungen Pionieren war ich zum Wanderwart ernannt worden, weil ich mich in der Gegend von Wernigerode gut auskannte.
In der Gruppe der Jungen Pioniere
Mit den Freunden trieben wir uns oft in den Wäldern und Bergen rum. Die längste Wanderung machte ich so als 10- oder 11jähriger mit meinem Vater von Wernigerode zu Fuß auf den Brocken und zurück.
Die erste von mir organisierte Wanderung führte zum 16 km entfernten Regenstein bei Thale. Leider verspätete ich mich. Als ich zum Treffpunkt kam, war die Gruppe schon weg. Ich machte mich per Anhalter (damals gab es noch nicht viele Autos auf den Landstraßen) auf die Verfolgung und fand die Gruppe erschöpft an der Burgruine Regenstein wieder. Es regnete in Strömen, die Mädchen weinten vor Kälte und Erschöpfung, mussten aber noch die 16 km wieder zurück laufen. Am nächsten Tag wurde ich vom Pionierleiter der Schule als Wanderwart abgesetzt und bekam auch in der Organisation keinen Posten mehr.
Wegen der Versorgungsengpässe in der DDR gab es lange keine Fahrräder zu kaufen. Wer von uns Kindern noch eins aus der Vorkriegszeit hatte, konnte sich glücklich schätzen, obwohl es auch keine Luftreifen gab. Man fuhr auf Vollgummireifen oder auf anderen Behelfen wie alten Gartenschläuchen. Mein Vater hatte mir ein uraltes Fahrrad mit einem altmodischen Gesundheitslenker und einer Karbidlampe besorgt. Leider konnte ich mehrere Monate nicht damit fahren, weil das Rad keine Reifen hatte. Es stand auf dem Treppenabsatz zu unserer Wohnung, und ich saß jeden Tag darauf, konnte aber nicht fahren, bis mir mein Onkel Ernst aus dem Westen neue Luftreifen schenkte. Durch das Rad erweiterte sich mein Aktionsradius erheblich. Einmal fuhren wir mit Freunden 80 km bis Magdeburg, übernachteten bei einem Bauern in der Scheune und fuhren am nächsten Tag wieder nach Hause, nachdem wir uns aus den zur Abholung an die Straße gestellten Milchkannen satt getrunken hatten.
Unser bevorzugtes Nahziel am Wochenende wurde die 16 km entfernte Burgruine Regenstein bei Thale.
Mit etwa 13 Jahren fuhr ich per Rad alleine zu meiner Tante nach Wittenberg und 200 km nach Berlin zur jüngsten Schwester meines Vaters. Das war damals alles noch möglich, weil es auf den Landstraßen wenig Autoverkehr gab. Die allgemeine Sicherheitslage war trotz verlorenem Krieg und dem ganzen damit zusammenhängenden Elend besser als heute. Im Sommer 1954 nach meiner Schulzeit bin ich mit diesem Fahrrad als normaler Urlauber über die Grenze nach Hamburg zu meinem Vater gefahren, aber diese Geschichte folgt später.
1953 wurde mein damaliger Freund und Klassenkamerad und ich für acht Wochen in das Pionierlager „Wilhelm Piek“ am Fehrbellinsee bei Berlin geschickt. Es war eine Auszeichnung für uns, nicht so sehr wegen unserer Leistungen als Pionier, sondern wegen unserer guten schulischen Leistungen. Wir wohnten direkt am See in festen zweigeschossigen Häusern und hatten dort auch Schulunterricht. Wie ich später erfuhr, wurden die Häuser aus den Resten des Jagdschlosses Kari Hall von Hermann Göring in der Schorfheide gebaut. Wir hatten dort eine schöne, unbeschwerte Zeit und viel Spaß. Ich legte dort die Prüfung für das Fahrtenschwimmerzeugnis ab.
Als wir wieder nach Hause fahren sollten, wurden wir in Berlin aus dem Zug geholt und für mehrere Tage in ein Zeltlager gebracht. Wir wussten nicht, was los war, bis wir erfuhren, dass es wegen des Arbeiteraufstandes am 17. Juni war. Die Anlage wird heute noch als Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte betrieben.
Dieser Schulfreund ist später der Stasi-Chef vom Kreis Wernigerode geworden. Eigentlich hatte er Holzkaufmann gelernt. Irgendwie hatte er aber oft eine hinterhältige Art an sich. Wie er zur Stasi gekommen ist, weiß ich nicht. Er wohnt noch in Wernigerode in einer bevorzugten guten Wohngegend. Ich habe ihn nicht mehr gesehen.
Ich besuchte in der Sylvestri-Kirchengemeinde in Wernigerode den Konfirmandenunterricht. Wir mussten damals noch den Katechismus auswendig lernen und hatten zum Abschluss vor der ganzen Gemeinde in der Kirche eine Abschlussprüfung abzulegen. Davor mussten wir jeden Sonntagmorgen zum Gottesdienst kommen und uns den Besuch bescheinigen lassen. Außerdem war ich Mitglied in einer Jugendgruppe, die sich regelmäßig im Pfarrgebäude traf. Wir wussten, dass das schulseitig nicht so gerne gesehen war und fühlten uns etwas wie geheime Verschwörer. Es gab aber keinerlei Benachteiligungen für uns.
-
Als Konfirmand zwischen meinen Eltern
Am 11. April 1954 wurde ich konfirmiert. Meine Mutter hatte mir einen graublauen Anzug schneidern lassen. Der Stoff bestand wohl aus Holzfasern und war fürchterlich kratzig. Ich konnte die Hose nur mit langen Unterhosen tragen, weil ich sonst vor Kratzen verrückt geworden wäre. Im Westen in Neuß bin ich mit dem Anzug noch zur Tanzstunde gegangen, auch mit langen Unterhosen drunter.
Fünfzig Jahre später habe ich die Sylvestri-Kirche zur Goldenen Konfirmation wieder besucht. Leider war mein Jahrgang schon ein Jahr vorher dran gewesen, aber sie konnten mir die Einladung wegen fehlender Adresse nicht schicken. Es waren keine Bekannten mehr bei dem Treffen. Trotzdem war es ein nettes Erlebnis. Ich wurde von einer Frau angesprochen, die damals von meiner Schwester unterrichtet worden war, und die nun an derselben Schule selbst Lehrerin war.
Kurz nach der Konfirmation ging mein Vater über die Grenze in den Westen. Ich beendete am 4. Juli 1954 die Schule und folgte ihm wenig später nach. Damit war ein wichtiges Kapitel meines Lebens abgeschlossen. Rückblickend kann ich sagen, dass es für mich eine schöne, prägende Zeit war, trotz der ärmlichen Umstände, in denen wir lebten. Ich empfand es nicht so. Wernigerode war meine Heimat geworden.