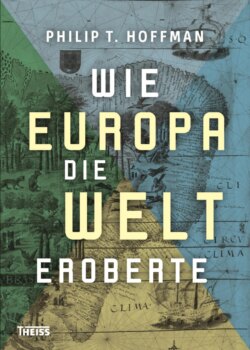Читать книгу Wie Europa die Welt eroberte - Philip Hoffman - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auf welche Weise sorgte das militärische Turnier für technologische Fortschritte?
ОглавлениеNun verfügen wir also über ein Modell, das erklärt, wann es Krieg gibt (oder zumindest wann ein Krieg das wahrscheinliche Ergebnis bestimmter Entwicklungen ist), wann die Rüstungsausgaben in die Höhe schnellen und wann wahrscheinlich Frieden herrscht – nämlich dann, wenn ein Herrscher den Gewinn ohne Gegenwehr einstreicht und keine Ressourcen dafür aufwenden muss, tatsächlich zu kämpfen. Doch bislang sagt unser Modell über einen wichtigen Punkt noch nichts aus: Wie kommt es bei alldem zu Verbesserungen in der Militärtechnologie?
Welche Technologie in einem Krieg verwendet wird, bestimmen die Gegner eines Herrschers. In Westeuropa war das die Schießpulvertechnologie, die sowohl auf dem Land als auch auf dem Meer gut funktionierte. Aber es war nicht die einzige Rüstungstechnologie in der frühneuzeitlichen Welt, und gegen einige Feinde war sie gar nicht besonders hilfreich. Mindestens bis zum 17. Jahrhundert beispielsweise waren Feuerwaffen gegen die Nomaden, die China, Teile Südasiens, den Nahen Osten und sogar die an die eurasische Steppe grenzenden Gebiete Osteuropas bedrohten, relativ wirkungslos. Diese Reiternomaden hatten keine Städte, die man belagern konnte, und sie waren zu beweglich, um Ziele für die Artillerie abzugeben, außer man verschanzte sich mit seinen Kanonen hinter Befestigungsanlagen, um auf die Reiter zu feuern. Ihnen die eigene Infanterie hinterherzuschicken, verschlang zu viele Vorräte, denn die Nomaden ritten einfach fort in die Steppe, von der sie sich ohnehin ernährten. Musketen kamen dabei ebenfalls kaum infrage, da man sie nicht leicht vom Pferderücken aus feuern konnte; mit Pistolen ging das etwas besser, doch die Reichweite ließ zu wünschen übrig.41 Die beste Option im Kampf gegen Reiternomaden waren lange Zeit berittene Bogenschützen – man versuchte sie also mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, einer Technologie, die sich bis ca. 800 v. Chr. zurückdatieren lässt. Artillerie und Feuerwaffen, die viel jünger waren, nützten gegen diesen Feind wenig.42 Und wie wir sehen werden, waren Pfeil und Bogen nicht die einzigen militärischen Technologien, die man in der Frühen Neuzeit noch verwendete.
Bevor wir die Fortschritte in der Militärtechnologie in unser Modell integrieren können, sollten wir uns etwas genauer ansehen, wie sie überhaupt zustande kamen. Vor dem 19. Jahrhundert waren die meisten Innovationen in Sachen Schießpulver – wie auch in anderen Bereichen des Militärwesens – das Ergebnis von „learning by doing“. Herrscher führten Kriege, und dabei verwendeten sie eben jene Waffen, mit denen sie ihre Feinde am wirkungsvollsten bekämpfen konnten.43 Der entsprechende Erkenntnisgewinn fand entweder direkt während eines Krieges statt oder aber später, wenn der Verlierer den Sieger kopierte und beide Seiten das Kriegsgeschehen analysierten.
In Westeuropa beispielsweise sorgten die bewaffneten Konflikte Ende des 15. Jahrhunderts dafür, dass leichtere und mobilere Kanonen auf den Markt kamen, die auf Lafetten montiert und von diesen fahrbaren Gestellen aus auch abgefeuert werden konnten. Die Feuerkraft dieser neuartigen Kanonen war trotzdem recht stark. Auf Grundlage dessen entwickelten die Armeen des französischen Königs Karl VII. (1422–1461) während des Hundertjährigen Kriegs eine hoch effektive Artillerie, mithilfe derer sie die Burgen befreiten, die die Engländer in Frankreich besetzt hatten. Und der technische Fortschritt kam mit Kriegsende nicht etwa zum Stillstand: Während die Franzosen während des Krieges in erster Linie in der Logistik und in der Organisation von Belagerungen Fortschritte machten, erfanden sie hinterher (oder doch zumindest erst gegen Ende des Krieges) ein besseres Schießpulver und begannen damit, gusseiserne Kanonenkugeln und Lafetten zu verwenden, von denen man die Kanonen nicht erst aufwendig abmontieren und auf einer separaten Halterung befestigen musste, bevor man sie abfeuern konnte. Einige Impulse für die Innovationen nach dem Hundertjährigen Krieg entstanden aus der militärischen Rivalität mit einer weiteren Macht: Burgund. Die Franzosen besaßen daher eine extrem starke Artillerie, als sie 1494 in Italien einmarschierten. Der Schock, den diese Invasion dort auslöste, führte wiederum zu einer Gegenreaktion seitens der Italiener, deren Militärarchitekten eilends neuartige Befestigungsanlagen entwarfen, die dem Artilleriefeuer der Franzosen widerstehen konnten und es zugleich den Verteidigern ermöglichten, ihrerseits die Kanonen auf die Invasoren zu richten.44
Abbildung 2.2. Preis und Gewicht früher Feuerwaffen in Frankfurt am Main, 1399–1431. Quelle: Rathgen 1928.
Als die Franzosen im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) eine verheerende Niederlage erfuhren, feilten sie weiter an ihrer Feldartillerie und machten sie leichter, mobiler, effektiver. Waffen leichter zu machen, war ein langsamer Prozess, bei dem man viel experimentieren musste. Dabei war das Gewicht an sich gar nicht unbedingt das Entscheidende: Die mobile Artillerie erreichte ihre Blütezeit erst während der Französischen Revolution, als neue Heerführer wie Napoleon sie mit neuartigen Taktiken und Strategien kombinierten.45
Auch in der Organisation und Herstellung von Waffen lernte man dazu, und die entsprechenden Verbesserungen verbreiteten sich von den Offizieren über die Soldaten und Heeresverwaltern bis hin zu den Handwerkern und Kaufleuten. Französische und britische Kommandanten zum Beispiel, die im 16. Jahrhundert gegen die Spanier kämpften, lernten die Disziplin der gut ausgebildeten spanischen Infanteristen schätzen – und ihre Organisation in kleinen Gruppen. Und sie forderten, dass man sich bei ihnen zu Hause daran orientierte.46 Die Geschützgießer in Frankfurt, die Anfang des 15. Jahrhunderts einige der frühesten Feuerwaffen Europas herstellten, entdeckten eine Möglichkeit, bei ihren Waffen (die eigentlich nichts anderes waren als winzige Kanonen, die man in der Hand hielt) das Gewicht zu reduzieren und sie zugleich billiger machen: Sie verwendeten einfach weniger Metall (Abbildung 2.2). Diese Innovation erscheint recht naheliegend, aber in einer Zeit, in der Kanonen regelmäßig explodierten, wenn man sie testete (was auch der Grund dafür war, dass man sie immer erst testete, bevor man sie verwendete; Abbildung 2.3), müssen die Geschützgießer ziemlich viel herumexperimentiert haben.47 Schließlich gab es noch keine theoretischen Grundlagen, an denen sie sich hätten orientieren können – wie sonst als durch ständiges Ausprobieren konnten sie sicherstellen, dass ihre Feuerwaffen sicher waren und nicht in den Händen ihrer Kunden explodieren würden?
Abbildung 2.3. Explodierende Kanone, ca. 1411. Das Manuskript empfiehlt dem Schützen, nicht neben der Kanone, sondern möglichst zehn oder zwanzig Schritte dahinter zu stehen. Quelle: Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Codex 3069, folio 10r. Für weitere Informationen zum Manuskript siehe Leng 2002, Bd. 1: 172–178, 195–197, Bd. 2: 439.
Es gab auch ein paar Erfindungen, die das Militär nicht dem Krieg, sondern der zivilen Wirtschaft verdankte. Das beste Beispiel sind sicherlich die Glockengießer, die die Technologie entwickelt hatten, mit der man auch Kanonen goss.48 Daneben gab es aber auch bereits Experimente, die wir als „bewusste Forschung“ bezeichnen können. Ein Produkt solcher Forschung war die Kupferummantelung von Schiffsrümpfen, wie sie die britische Marine im 18. Jahrhundert verwendete. Anlass zu dieser Innovation gaben Beschädigungen durch sogenannte Schiffsbohrwürmer (Teredinidae) – Muscheln, die sich in tropischen Gewässern, vor allem in der Karibik, in die Rümpfe der Schiffe fraßen. Im 16. Jahrhundert begann man damit, an den Rumpf eine zusätzliche Schicht Bohlen zu nageln, aber die gefräßigen Muscheln bohrten sich auch durch diese Bretter hindurch. Man versuchte es auch mit einer Bleiummantelung, aber die Bleiplatten hielten der rauen See nicht stand, und vor allem lösten sie eine chemische Reaktion aus, die die Eisenbeschläge und Nägel an Rumpf und Ruder zerfraß. Vor allem auf See waren die Folgen mitunter katastrophal: „Mein Ruder löste sich vom Heck, und die Eisen am Achtersteven zerbrachen“, beklagte sich 1675 der Kommandeur eines mit Blei ummantelten Schiffs. „Ich musste das Ruder an Bord holen, um es zu retten, und segelte drei Tage lang auf dem Meer herum, während mein Ruder an Deck lag.“ Mitte des 18. Jahrhunderts begann man schließlich, mit einer Rumpfummantelung aus Kupfer zu experimentieren. Schnell stellte sich heraus, dass sie nicht nur Schiffsbohrwürmer abhielt, sondern noch zahlreiche weitere Vorteile bot: Sie hielt den Rumpf frei von Tang und Seepocken, und sie machte die Schiffe schneller. Leider ließ auch das Kupfer die Eisenbeschläge rosten, und dieses Problem war nicht einfach zu beheben, denn von der Chemie dahinter hatte man bislang wenig Ahnung. Zunächst versuchte man den Rumpf mit mehreren Lagen Papier und auch ein paar anderen Stoffen vom Kupferbeschlag zu trennen, doch der Durchbruch kam erst in den 1780er-Jahren, als die britische Marine das Eisen durch eine Kupferlegierung ersetzte, die nicht mit der Ummantelung reagierte, aber stabil genug war, dass man daraus Beschläge herstellen konnte.49
Aber auch wenn in gewissem Rahmen bereits aktiv geforscht wurde, entstanden die meisten Innovationen doch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein durch die Learning-by-Doing-Methode. Erst für die Zeit ab etwa 1800 können wir von einer militärischen Forschung im heutigen Sinne sprechen. Wenn wir uns mit dem technischen Fortschritt im frühneuzeitlichen Europa beschäftigen, sollten wir unser Augenmerk also vor allem auf das „learning by doing“ richten. Einiges spricht dafür, dass die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse direkt davon abhängen, wie viele Ressourcen für einen Krieg aufgewendet werden. Derjenige Herrscher, der mehr fürs Militär ausgibt, hat größere Chancen, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dieses Prinzip gilt für Herrscher überall auf der Welt, und es beschränkt sich auch nicht auf eine bestimmte Rüstungstechnologie – selbst die amerikanischen Ureinwohner in Mittelamerika hatten ihre steinzeitlichen Waffen stetig weiterentwickelt, bevor die Spanier bei ihnen einfielen.50
Für unsere Zwecke nehmen wir an dieser Stelle einmal an, dass jede Einheit, die ein Herrscher für einen Krieg ausgibt, ihm die Chance auf eine neue militärische Innovation an die Hand gibt. Technisch ausgedrückt bedeutet das, dass der Prozess in der zufälligen Auswahl einer oder mehrerer Innovationen aus einer bestimmten Verteilung vorhandener Innovationen besteht. Um es auch Lesern verständlich zu machen, die sich nicht mit Statistik auskennen: Es ist ein wenig, als versuche man aus einer Handvoll Strohhalme unterschiedlicher Länge einen bestimmten Strohhalm zu ziehen. (An dieser Stelle können mit Ökonomietheorie vertraute Leser gerne wieder zu Anhang A blättern.) Ziel ist es, den längsten Strohhalm zu erwischen – in unserer Analogie entspricht dann der längste Strohhalm, den jemand zieht, der besten Innovation. Für jede Einheit an Ressourcen, die ein Herrscher für das Militär ausgibt, darf er einen weiteren Strohhalm ziehen – sprich: erhält er eine weitere Chance auf technische Verbesserungen. Selbstverständlich gibt es eine Obergrenze, was die Länge der Strohhalme betrifft. Von dieser Maximallänge reicht die Palette an Strohhalmen bis hin zu extrem kurzen (sogar einen mit der angenommenen „Länge“ null). Mehr Rüstungsausgaben bedeutet, dass man mehr Strohhalme ziehen darf und es wahrscheinlicher wird, dass ein besonders langer darunter ist – sprich: eine besonders fortschrittliche Innovation. Mathematisch ausgedrückt, rangiert die Länge der einzelnen Strohhalme zwischen null und der maximalen Strohhalmlänge; in unserer Analogie heißt das: Je größer die Zahl, desto wichtiger die Innovation. Jede Einheit der Rüstungsausgaben bedeutet eine neue, unabhängige Chance darauf, zufällig einen besonders langen Strohhalm zu erwischen bzw. für eine besonders wichtige Innovation zu sorgen, und je mehr Geld ein Herrscher für das Militär ausgibt, desto wahrscheinlicher wird es, dass er beim Ziehen der Strohhalme Glück hat.51 Daher bedeuten höhere Rüstungsausgaben automatisch mehr bzw. fortschrittlichere Innovationen.
Damit es zu einem Krieg kommt, müssen mindestens zwei Herrscher gegeneinander kämpfen; wenn sie einander mit der gleichen Militärtechnologie bekämpfen, dürfen wir voraussetzen, dass beide Herrscher ihre Strohhalme aus ein und derselben Anzahl an Strohhalmen ziehen (genauer gesagt: Zahlen aus derselben Verteilung). Wenn dem so ist, dann hängt die bestmögliche Innovation in Hinsicht auf den Krieg – also der längste Strohhalm, den einer von beiden zieht – von der Gesamtsumme ab, den beide für das Militär ausgeben.52 Wie wir bereits festgestellt haben, steigt die Gesamtsumme dieser Ausgaben mit dem Wert des in Aussicht stehenden Gewinns, und sie steigt selbst dann noch, wenn die Summe ihrer Kosten für die Mobilisierung von Ressourcen (die Gesamtkosten) sinkt. Während die Gesamtmilitärausgaben steigen, steigt mithin auch der Wert der bestmöglichen Innovation, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, denn es gibt schließlich eine Obergrenze – die maximale Länge der Strohhalme –, und diese können wir als die Obergrenze des verfügbaren Wissens interpretieren.53 Insofern generiert ein umfassenderes Wissen also mehr Innovationen, da es die Chance erhöht, einen längeren Strohhalm zu ziehen. Und wenn es nicht zum Krieg kommt, gibt es auch keine Ausgaben und folglich keinen Erkenntnisgewinn – in diesem Fall bleibt für beide Herrscher nur ein Strohhalm zum Ziehen übrig: nämlich der kürzeste, derjenige mit der (theoretischen) Länge null.
Innovationen sind also ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt der Kriegführung. Doch was ist, wenn die Herrscher vorsätzlich versuchen, ihre Rüstungstechnologie zu verbessern? Falls Innovationen nur per Learning by Doing entstehen, indem für einen Krieg bestimmte Ausgaben getätigt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer der beiden Herrscher die bestmögliche Innovation tätigt, genau die gleiche wie die Wahrscheinlichkeit, den Krieg zu gewinnen (gemäß unserem Turniermodell).54 Das Rennen um die beste Innovation für sich zu entscheiden, ist gleichbedeutend damit, den Krieg zu gewinnen; die Anreize sind ebenfalls die gleichen, daher gibt es hier keinerlei Unterschied – immer vorausgesetzt, dass Innovationen durch Learning by Doing entstehen.
Nun wissen wir also schon ein wenig mehr darüber, wie es zu Innovationen kommt. Während eines Krieges gibt es immer neue technologische Verbesserungen durch Learning by Doing, und die beste davon (also der längste Strohhalm, den einer der verfeindeten Herrscher zieht, oder mathematisch ausgedrückt, die höchste Zahl, die einer der beiden Herrscher wählt) bildet den aktuellen Stand der Technologie. Aber wie beeinflusst die beste Innovation innerhalb eines Krieges die Militärtechnologie der Zukunft? Wie verbreitet sich der militärische Fortschritt, und wie erlangt jemand die technologische Vorherrschaft? Mit anderen Worten: Wie sieht der Weg aus, der von den bereits getätigten Rüstungsausgaben zur späteren militärischen Dominanz führt, wie wir sie für die Europäer und die Schießpulvertechnologie beobachten können?
Dazu müssen wir unser Modell noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Beginnen wir mit der Annahme, dass aufeinanderfolgende Paare unterschiedlicher Herrscher der jeweils gleichen Länder immer wieder gegeneinander antreten, nämlich einmal pro Herrschaft. Nehmen wir des Weiteren an (zugegeben, hier wird es ziemlich theoretisch), dass die jeweiligen zwei Herrscher die jeweils beste Innovation aus dem letzten Konflikt kopieren können. Mit anderen Worten: Sie können frühere militärische Fortschritte ungehindert übernehmen, egal auf welcher Seite diese erfolgt sind. Auch wenn wir diese Annahme später ein wenig relativieren werden, wenn es darum gehen wird, auf welche Weise sich technologische Neuentwicklungen ausbreiten, so scheint sie auf das Europa der Frühen Neuzeit doch recht gut zu passen: Dort verbreiteten sich militärische Innovationen erstens durch Spionage, zweitens durch Bemühungen, die Erfolgskonzepte anderer zu kopieren, und drittens über Europas längst etablierten Markt für Waffen und militärisches Fachwissen. Und professionelle Soldaten waren immer darauf aus, die jeweils effektivsten Taktiken, Geräte und Organisationsformen zu übernehmen.
Wenn zwei Herrscher die beste Innovation der vorangegangenen Runde ihrer Auseinandersetzung übernehmen, macht dies ihre Streitkräfte effizienter. Die einfachste Möglichkeit, wie wir dies in unserem Modell abbilden können (mit Ökonomie vertraute Leser sollten hier wieder zu Anhang A blättern), ist, dass die Innovation den Effekt dessen vergrößert, was die Herrscher ausgeben: Jede Einheit der Ausgaben verhält sich dann so, als wäre sie plötzlich multipliziert worden. Grob gesagt war es das auch, wofür die Verbesserungen in der Schießpulvertechnologie tatsächlich sorgten. Nehmen wir nur die Erfindung des Bajonetts: Auf einmal erledigte ein Infanterist mit einem Bajonett an der Muskete den Job, für den man vorher zwei Infanteristen gebraucht hatte – einen Musketier und einen Pikenier. Da die beste Innovation aus der letzten Runde in unserem Modell einfach eine Zahl ist (die Länge des längsten Strohhalms in der vorherigen Runde, falls die Herrscher jeder einen Strohhalm gezogen haben), können wir diese Zahl nehmen, um die prozentuale Steigerung der Effektivität der militärischen Ressourcen, die die Herrscher mobilisieren, zu definieren.55 Eine hohe Zahl – also eine besonders wichtige Innovation in der vorherigen Runde – funktioniert dann als hoher prozentualer Anstieg in der Effektivität militärischer Mittel; eine Null in der vorherigen Runde bedeutet keine Innovation, mithin keine Steigerung der Effektivität.
Aus dieser Erweiterung unseres Modells lassen sich mehrere wichtige Aussagen über militärische Innovationen ableiten (Einzelheiten hierzu finden sich in Anhang A):
• Eine neue Technologie (eine, die man noch nicht lange nutzt, wie die Schießpulvertechnologie in der Frühen Neuzeit) hat ein enormes Potenzial, durch Learning by Doing verbessert zu werden. Bei älteren Technologien (wie den berittenen Bogenschützen im Kampf gegen die Nomaden) gibt es automatisch weniger Innovationen; dafür sorgen die natürlichen Grenzen des verfügbaren Wissens.56
• Ein Herrscher, der seine Ausgaben zwischen einer alten und einer neuen Technologie (z.B. zwischen der Schießpulvertechnologie und berittenen Bogenschützen) aufteilen muss, bringt die neue Technologie weniger voran, da es weniger Chancen gibt, diese neue Technologie durch Learning by Doing zu verbessern.
• Ein umfangreicheres Wissen erweitert nicht nur die Grenze des Learning by Doing, sondern sorgt auch dafür, dass diese Methode einen größeren Effekt hat. Mit dem Wissen ist es wie mit den Innovationen: Ist es größer, werden die militärischen Ressourcen effektiver. Und wächst das Wissen, so lässt auch das Learning by Doing nicht nach. Die Technologie bleibt, wenn man so will, „jung“.
• Innovationen haben die gleiche Wirkung wie niedrigere Kosten für die Mobilisierung von Ressourcen. Deshalb kann ein Herrscher mit fortschrittlicherer Technologie einen Gegner herausfordern, der viel größere Armeen befehligt als er selbst, so wie es bei Cortés und den Azteken bzw. Pizarro und den Inka der Fall war – mit effektiveren Soldaten und Waffen kann der Herausforderer gewinnen, auch wenn er massiv in Unterzahl ist. Trotzdem sind dem, was man mit der Technologie anstellen kann, auch hier Grenzen gesetzt, vor allem wenn man sich weit weg von zu Hause befindet.
Diese Prognosen ergänzen unsere bisherigen Erkenntnisse aus dem Modell: Die Voraussetzung für militärische Innovationen (zumindest solche, die per Learning by Doing zustande kommen) ist der Krieg, aber Krieg allein reicht nicht aus – es müssen auch genug Ressourcen dafür aufgewendet werden, den Krieg zu kämpfen, und das wiederum setzt einen wertvollen Gewinn und niedrige Gesamtkosten für das Mobilisieren von Ressourcen voraus.
Aber das sind noch längst nicht alle Implikationen des Modells. Bisher haben wir angenommen, dass die beiden Herrscher kurzerhand die beste Innovation der vorherigen Runde übernehmen, aber oftmals war das gar nicht so einfach: Ein großes Hindernis dafür war, zumindest in der Frühen Neuzeit, die Distanz zwischen den einzelnen Ländern. Denn um die neuesten Fortschritte zu übernehmen, musste man entweder verbesserte Rüstungsgüter kaufen, beispielsweise bessere Musketen, oder – was noch häufiger vorkam – Experten rekrutieren, von erfahrenen Soldaten und besonders innovativen Militärarchitekten über Schiffbauer bis hin zu Büchsenmachern oder Geschützgießern. Die rudimentären Transportwege machten es ziemlich schwierig und kostspielig, militärisches Gerät oder Experten von außerhalb ins Land zu holen. Und sie waren auch nicht das einzige Hindernis, aber mit den anderen (wie Handelsverboten, kulturellen Hindernissen, Organisation des Handwerks, Mangel an Handwerkern mit komplementären Fähigkeiten) werden wir uns später beschäftigen. Wenn nun eines dieser Hindernisse einen Herrscher davon abhält, die neuesten militärischen Erkenntnisse umzusetzen, sind zwei Ergebnisse möglich:
• Es entsteht ein einseitiger technologischer Vorsprung. Der Herrscher, der durch bestimmte Barrieren in seiner Innovationskraft behindert wird, gerät ins Hintertreffen, da er einfach weniger dazulernen kann, vor allem von den Gegnern seiner Vorgänger.
• Dieser Vorsprung kann geringer werden, wenn ein Herrscher, der technologisch hinterherhinkt, Experten vom Gegner abwirbt oder gegen einen Technologieführer kämpft, aber er wird nicht komplett verschwinden, zumindest nicht über Nacht – es sei denn, die Hindernisse, die den Erkenntnisgewinn oder die Übernahme der neuesten Innovationen bislang verhindert haben, werden plötzlich aus dem Weg geräumt. Wenn ein Herrscher keinen Zugang zum neuesten Wissen hat oder sich kein qualifiziertes Militär- und Zivilpersonal besorgen kann, das die neue Technik bedient, wird der Abstand sogar noch größer.
Uns geht es nun vor allem darum, die Verbesserungen in der Schießpulvertechnologie zu erklären und nachzuvollziehen, warum die Europäer es hier weiter brachten als der Rest der Welt. Wenn wir untersuchen, was unser Wettbewerbsmodell dazu sagt, können wir vier wichtige Bedingungen dafür herausarbeiten, wie sich die Schießpulvertechnologie über Learning by Doing verbessern ließ:
1. Es muss häufig Krieg geben. Dazu müssen Herrscher mit ähnlichen politischen Kosten für die Mobilisierung von Ressourcen konfrontiert sein, und dem Sieger muss ein Gewinn winken, der verglichen mit den Fixkosten für Steuersystem und Militärapparat relativ wertvoll ist. Es darf keine großen Unterschiede geben, was die Größe der beiden Länder und der beiden Volkswirtschaften betrifft, und sie müssen sich beide in ähnlicher Höhe Geld leihen können. (Allerdings kann sich mithilfe der nötigen Kredite auch der Herrscher eines kleineren Landes erlauben, gegen einen größeren Gegner zu kämpfen.)
2. Allein die Tatsache, dass oft Krieg geführt wird, reicht allein jedoch nicht aus; die Herrscher müssen auch ungeheure Summen für ihre Kriege ausgeben. Deshalb muss der Gewinn so wertvoll sein, aber darüber hinaus müssen die jeweiligen politischen Kosten der Herrscher für die Mobilisierung ihrer Ressourcen nicht nur ähnlich sein, sondern auch möglichst niedrig.
3. Die Herrscher müssen vor allem die Schießpulvertechnologie nutzen und nicht auf ältere Militärtechnologien setzen.
4. Die Herrscher müssen in der Lage sein, ohne große Hindernisse militärische Innovationen zu übernehmen, auch und gerade vom Gegner.
Wird nur eine dieser vier Bedingungen nicht erfüllt, so wird sich die Schießpulvertechnologie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht weiterentwickeln. Zusammen reichen die vier Bedingungen jedoch dafür aus, dass die Schießpulvertechnologie per Learning by Doing verbessert wird. Ein umfassenderes relevantes Wissen – auch dies impliziert das Modell – beflügelt die Innovationskraft und stellt sicher, dass sie zumindest mittelfristig nicht nachlässt.