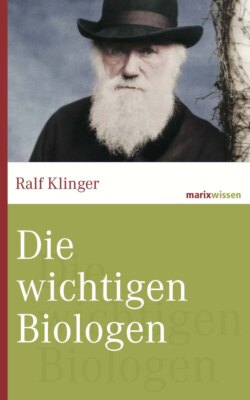Читать книгу Die wichtigsten Biologen - Ralf Klinger - Страница 10
Maria Sibylla Merian
Оглавление(2.4.1647–13.1.1717)
Die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau wurde von Martin Luther im 16. Jahrhundert eingeleitet und setzte sich als bürgerliches Ideal bis zum 18. Jahrhundert allmählich durch. Maria Sibylla Merian wuchs noch nach dem aus dem Mittelalter überlieferten Frauenbild auf, das selbständige Kauffrauen anerkannte und auch in die Zünfte aufnahm. So war es ihr als Frau gestattet, sich bei ihrem Stiefvater und dessen Gesellen in den Techniken des Malens, Aquarellierens und Kupferstechens ausbilden zu lassen. Außerdem lernte sie Lesen, Schreiben und Rechnen. Dies bildete die Grundlage für ihr künstlerisches und wissenschaftliches Wirken. Mit ihrer Arbeit als Malerin, Kupferstecherin, Naturforscherin, Lehrerin, Autorin und Kauffrau war sie ihrer Zeit weit voraus. Sie widerlegte die klassische Vorstellung der Urzeugung und widersprach dem mittelalterlichen Glauben, dass Insekten eine gottgesandte Strafe seien. Durch ihre eigenständige, wissenschaftliche Arbeitsweise gehört sie zum Kreis derjenigen, die die Insektenkunde (Entomologie) begründet haben.
Ihr Vater war der bekannte Kupferstecher und Kartenzeichner Matthäus Merian d.Ä. Die gebildete Handwerkerfamilie Merian lebte in Basel und übersiedelte 1624, mitten im Dreißigjährigen Krieg, in die Freie Reichsstadt Frankfurt am Main. Es gelang dem Vater, den Verlag für theologische, medizinische und geographische Werke trotz des herrschenden Krieges zu erhalten und aufzubauen. Dabei war seine geschäftstüchtige und strenge Frau eine wertvolle Stütze. Maria Sibylla wurde im Jahr 1647, kurz vor dem Ende des langen Krieges, geboren. Schon drei Jahre später starb der Vater. Die Mutter heiratete noch im selben Jahr den niederländischen Maler und Kunsthändler Jacob Marrell. In der Werkstatt ihres Stiefvaters lernte Maria Sibylla, wie die Farben zubereitet werden und wie man damit malt. Auch das Stechen in Kupfer wurde ihr beigebracht. Oft betrachtete sie die Werke, die in der Werkstatt entstanden, Bilder mit Blumen- und Tierdarstellungen. Bald schon besaß sie, versteckt unter dem Dach des Hauses, ihr eigenes kleines Atelier. Heimlich entstanden hier ihre ersten Bilder. Eines Tages, sie war gerade 13 Jahre alt, nahm sie der Stiefvater mit zu den niederländischen Seidenraupenzüchtern, die sich als Kriegsflüchtlinge in Frankfurt niedergelassen hatten. Sie durfte sich einige Raupen mitnehmen und erlebte zum ersten Mal, wie sich die Raupe in einen Kokon einspinnt und dann als Schmetterling schlüpft. Das Wunder der Insektenverwandlung ließ sie von da an nicht mehr los. Sie begann, alle möglichen »Würmer« einzusammeln, um ihre Verwandlung in Schachteln und Gläsern zu verfolgen. Dass etwa zur gleichen Zeit im fernen Messina auf Sizilien der italienische Naturforscher und Arzt Marcello Malpighi (1628–1694) die gleichen Beobachtungen machte, ahnte sie nicht. Auch seine daraufhin im Jahr 1669 erschienene Schrift über die Metamorphose der Seidenspinnerraupe bekam Maria Sibylla nicht zu lesen.
Mit 18 heiratete sie Andreas Graff, den sie in der Werkstatt ihres Stiefvaters kennengelernt hatte. 1668 kam ihre erste Tochter, Johanna Helena, zur Welt. Die junge Familie zog nach Nürnberg, in die Geburtsstadt Graffs. Unabhängig von ihrem Mann, dessen Geschäfte nicht genügend Ertrag abwarfen, begann Merian, sich auf eigene Füße zu stellen. Sie scharte Frauen um sich, die sie gegen Bezahlung im Zeichnen, Malen und Sticken unterrichtete. Der erste Teil ihres Werkes Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung erschien 1679. Es sind 50 in Kupfer gestochene Protokolle ihrer in fünf Jahren durchgeführten Insektenzuchten. Sie berichten, wie sich die von Maria Sibylla eingetragenen Raupen und Maden schließlich in Fliegen, Käfer und Schmetterlinge verwandelten. Zum ersten Mal erschienen die Entwicklungsstadien verschiedener Insekten, vor allem der Schmetterlinge, nebst ihren Futterpflanzen auf herrlich kolorierten Bildtafeln, so lebendig dargestellt, wie Merian sie in ihren Zuchtgefäßen gesehen hatte. Die Bilder bewiesen, dass Insekten und »Würmer« keineswegs durch Urzeugung entstehen, wie man bis dahin zu glauben bereit war, sondern aus Eier hervorgehen, heranwachsen, sich häuten und schließlich verwandeln.
Ebenfalls noch in Nürnberg erschien ihr Neues Blumenbuch, das dreimal 12 Blütenpflanzen abbildet, die auch als Vorlagen für Stickmotive dienen sollten. Außerdem belieferte sie ihren Frauenkreis mit Farben. Schließlich begann Merian, Latein, die Sprache der Gelehrten und Gebildeten, zu lernen. Längst war sie nicht mehr nur die Frau an der Seite ihres Mannes. Sie war eine eigenständige Geschäftsfrau geworden. 1677 brachte sie ihre zweite Tochter, Dorothea Maria, zur Welt. Die Ehe begann zu kriseln. Nachdem ihr Schwiegervater 1681 gestorben war, verließ Merian ihren Mann und kehrte mit ihren beiden Töchtern nach Frankfurt zurück, wo sie sich um ihre alleinstehende Mutter kümmerte. Ihr Mann versuchte ihr nach Frankfurt zu folgen, pendelte mehrfach zwischen Nürnberg und Frankfurt, doch Maria Sibylla entzog sich ihm und ging mit ihren beiden Töchtern und ihrer Mutter nach Holland, wo sie sich auf Schloss Waltha einer christlichen Glaubensgemeinschaft anschloss. Im Kreise der Gemeinschaft, die sich nach ihrem Gründer Jean de Labadie Labadistengemeinde nannte und etwa 350 Mitglieder aus Frankreich, Deutschland und Holland umfasste, fand sie Schutz, materielle Sicherheit und religiöse Geborgenheit. Dennoch war es kein leichter Gang, denn sie musste sich von all ihrem Besitz trennen und nach den Regeln der Gemeinde leben. Zuvor war allerdings 1683 in Frankfurt Teil 2 ihrer Verwandlungen erschienen.
Das glückliche Zusammenleben auf Schloss Waltha währte nur wenige Jahre. Wieder musste Maria Sibylla einen neuen Anfang finden. Ihr Entschluss stand fest, sie würde in die neue niederländische Kolonie Suriname reisen und tropische Insekten malen. Der Weg dahin führte sie über Amsterdam, dem blühenden Zentrum der Kunst, der Wissenschaften und des Handels. Dort traf sie Antonio van Leeuwenhoek (1632–1723), bestaunte dessen selbst gebaute Mikroskope und studierte das in lateinischer Sprache abgefasste Werk Historia Insectorum Generalis des 1680 verstorbenen Insektenkundlers Jan Swammerdam (1637–1680).
Im Juni 1699 war sie an Bord des Schiffes, das sie nach Panamaribo, der Hauptstadt Surinames brachte. Von der Malaria angegriffen kehrte sie schon zwei Jahre später wieder nach Amsterdam zurück und arbeitete sofort an der Herausgabe ihres vielleicht bedeutendsten Werkes, der Metamorphosis Insectorum Surinamensis – 60 großformatige Kupferplatten mit den prächtigsten Insekten Surinames. Wieder wurden alle Entwicklungsstadien und im Zentrum der Tafeln die jeweiligen Futterpflanzen lebensnah abgebildet und die Entwicklungsgeschichte dieser tropischen Insekten dargestellt. Darunter befindet sich auch der mit 15 cm Körperlänge größte Käfer der Welt, der Riesenbockkäfer Titaneus giganteus.
Nach vier Jahren waren die gelungenen Tafeln fertiggestellt und koloriert. Maria Sibylla Merian starb am 13. Januar 1717 und wurde auf dem Amsterdamer Kerkhof beigesetzt.
Bis 1771 erschienen noch zwei weitere Auflagen dieses dreibändigen Insektenwerks.
Werke
Merian, M. S., 1675: Neues Blumenbuch allen kunstverständigen Liebhabern zu Lust, Nutz, und Dienst mit Fleiß verfertiget. Nürnberg, Teil 1, 12 Tafeln
Merian, M. S., 1677: Neues Blumenbuch allen kunstverständigen Liebhabern zu Lust, Nutz, und Dienst mit Fleiß verfertiget. Nürnberg, Teil 2, 12 Tafeln
Merian, M. S., 1677: Neues Blumenbuch allen kunstverständigen Liebhabern zu Lust, Nutz, und Dienst mit Fleiß verfertiget. Nürnberg, Teil 3, 12 Tafeln
Merian, M. S., 1679: Der Raupen wunderbare Verwandlung, und sonderbare Blumennahrung. Nürnberg, Bd. 1, 50 Tafeln
Merian, M. S., 1683: Der Raupen wunderbare Verwandlung, und sonderbare Blumennahrung. Frankfurt, Leipzig, Bd. 2, 50 Tafeln
Merian, M. S., 1705: Metamorphosis Insectorum Surinamensis. Amsterdam, 60 Tafeln.
Merian, M. S., 1726: Dissertation de generatione et metamorphosibus insectorum surinamensium. Den Haag, 72 Tafeln.