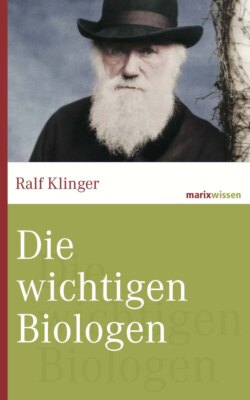Читать книгу Die wichtigsten Biologen - Ralf Klinger - Страница 7
Aristoteles
Оглавление(384–322 v. Chr.)
Der griechische Arzt, Philosoph und Universalgelehrte setzte sich, im Gegensatz zu seinem Lehrer Platon, mit der realen Welt auseinander. Er beobachtete die ihn umgebende Natur genau und schuf ein Erklärungsmodell, das in Europa rund 1.500 Jahre, bis zum Ende des Mittelalters, unangefochten galt.
Aristoteles wurde 384 v. Chr. in dem unscheinbaren Ort Stagira in Makedonien geboren. Sein Vater Nichomachos war Leibarzt am Hof von König Amyntas von Makedonien. Da Aristoteles’ Eltern früh starben, wuchs er bei Verwandten auf. Mit 18 Jahren ging er nach Athen und wurde Schüler Platons. Nach dessen Tod verließ der nunmehr 37-Jährige Griechenland und reiste nach Assos in Kleinasien zu seinem Freund, dem Tyrannen Hermeias. Er heiratete dessen Nichte Pythias. Als Hermeias knapp drei Jahre später gestürzt wurde, floh Aristoteles nach Mythilene auf Lesbos.
342 v. Chr. wurde er von König Philipp von Makedonien an dessen Hof gerufen. Aristoteles übernahm die Ausbildung des 13-jährigen Prinzen Alexander, der später als Alexander der Große in die Geschichte eingehen sollte. Nach der Ermordung Philipps 336 v. Chr. wurde Prinz Alexander neuer Herrscher von Makedonien. Aristoteles verließ den jungen König, ließ sich in Athen nieder und gründete mit Unterstützung des Makedonischen Königshauses das Lyzeum. Es war Schule, Forschungsinstitut und Bibliothek zugleich. Aristoteles sammelte Tiere, Pflanzen und Mineralien, befasste sich mit Physik, Politik und Ethik und entwickelte seine naturphilosophische Lehre. 12 Jahre später starb Alexander und Aristoteles musste nach formeller Anklage seiner Gegner 324 v. Chr. Athen fluchtartig verlassen. Die beiden letzten Jahre seines Lebens verbrachte er auf dem mütterlichen Landgut in Chalkis auf Euböa. Hier erlag er 322 v. Chr. im Alter von 62 Jahren einem Magenleiden.
Keines der Werke von Aristoteles ist im Originaltext erhalten geblieben. Bei den überlieferten Texten handelt es sich wahrscheinlich um Mitschriften, die seine Schüler bei seinen Vorlesungen verfassten.
Das naturphilosophische Weltbild des Aristoteles ist streng hierarchisch nach dem Grad der Vollkommenheit gegliedert und unterscheidet vier Stufen. Auf der untersten Stufe stehen die Mineralien. Sie dienen der nächsthöheren Stufe, den Pflanzen, diese wiederum den Tieren und die Tiere dem vollkommensten Wesen, dem Menschen, der auf der höchsten Stufe steht.
Aus dem Blickwinkel der heutigen biologischen Wissenschaft ist die Lehre des Aristoteles allenfalls noch wissenschaftshistorisch von Bedeutung. Aristoteles war zweifelsohne ein guter Beobachter, beispielsweise wenn er beschrieb, dass neues Leben von Insekten, Schalentieren und Fischen im Schlamm oder bei der Zersetzung von Tier- und Pflanzenresten entstünde. Die aus heutiger Sicht richtige Deutung konnte er für seine Beobachtungen allerdings nicht liefern, da ihm die Möglichkeiten fehlten, die Eiablage dieser meist sehr kleinen und oft auch sehr flüchtigen Tiere direkt zu beobachten. Dies gelang ihm erst bei Reptilien und Vögeln, deren Fortpflanzung er sehr wohl vom Gebären lebender Jungtiere bei Säugetieren unterschied. Es glückte ihm sogar, die Entwicklung eines Hühnerembryos im Ei zu verfolgen. Auch unterschied er die ihm bekannten Tiere danach, ob ihr Körper mit Haaren, Federn oder Schuppen bedeckt ist, ob sie warmblütig sind und ob sie rotes Blut besitzen. Als genauer Beobachter erwies er sich ferner, wenn er die Form der Organe mit ihrer Funktion in Verbindung brachte und von zweckmäßiger Anpassung sprach. Eine Evolution im Sinne von Darwin und Wallace kannte Aristoteles freilich nicht. Seiner Meinung nach verändern sich Arten im Laufe der Zeit nicht.
Er erklärte dies alles mit dem Zusammenwirken verschiedener Prinzipien, die er als causa formalis (Formprinzip bzw. Konstruktionsentwurf), causa efficiens (Wirkprinzip oder Entwicklungskraft) und causa finalis (Zweckprinzip oder Funktion) unterschied. Die causa formalis wurde später von der Kirche zum göttlichen Schöpfungsplan umgedeutet, obwohl dies so bei Aristoteles nicht angelegt war. Aus der Verteilung dieser Wirkprinzipien auf ein oder zwei Individuen konnte er weiterhin erklären, warum sich manche Arten zweigeschlechtlich fortpflanzen. In diesem Fall seien die Wirkprinzipien auf ein männliches und ein weibliches Geschlecht verteilt. Sich ungeschlechtlich vermehrende Arten vereinten alle Prinzipien in einem Körper.
Die Methodik des Aristoteles, durch dichotome Teilung zu einer immer feineren Unterteilung zu gelangen, hat Carl von Linné im 18. Jahrhundert für sein binominales System im Prinzip unverändert übernommen. Das Ergebnis ist die heutige Systematik, die einen Stamm in Klassen, Klassen wiederum in Ordnungen, Ordnungen in Familien, Familien in Gattungen und Gattungen in Arten gliedert. Im Unterschied zu Aristoteles wird heute jedoch nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben gegliedert. Das heißt, es werden mehrere Arten zu einer Gattung zusammengefasst, mehrere Gattungen zu einer Familie und so weiter. Auch wenn die Lesrichtung umgekehrt wurde, lebt das methodische Konzept des Aristoteles in der modernen Systematik im Grundsatz unverändert fort.
Werke
Physik
Metaphysik