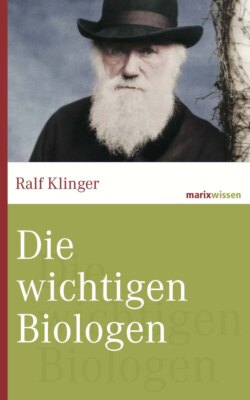Читать книгу Die wichtigsten Biologen - Ralf Klinger - Страница 12
Carl von Linné
Оглавление(23.5.1707–10.1.1778)
Linné schrieb über sich selbst, er sei Doktor, Professor, Ritter und Adelsherr geworden. Kein Naturwissenschaftler habe mehr Beobachtungen in der Natur angestellt als er, keiner sei ein größerer Botaniker oder Zoologe gewesen. Er habe eine ganze Wissenschaft reformiert und eine neue Epoche eingeleitet.
Der schwedische Naturforscher, der über 30 Jahre als Professor für Botanik an der Universität in Uppsala forschte und lehrte, war zweifelsohne ein herausragender Botaniker, der alle damals bekannten Pflanzenarten aufgrund eigener Untersuchungen über den Aufbau der Blüten und Früchte zu Verwandtschaftsgruppen zusammenfasste und ihnen durch seine binominale Nomenklatur eindeutige wissenschaftliche Namen zuwies. Ganz auf dem Fundament der kirchlichen Schöpfungslehre stehend, glaubte er, mit seinem Vorgehen den göttlichen Schöpfungsplan, oder – wie er sich ausdrückte – das Wunderwerk des Schöpfers, entdecken und schauen zu können. Mit dem gleichen Ziel klassifizierte er alle ihm bekannten Tiere und Steine. Am Ende seines Schaffens stand ein für die damalige Zeit umfassendes System der Natur, das zwar an die Lehre des antiken Naturphilosophen Aristoteles (384–322 v. Chr.) anknüpft, aber durch die wissenschaftliche Methodik der heutigen Lehrmeinung wesentlich näher gekommen ist. So ordnete er beispielsweise die Wale bereits bei den Säugetieren ein und scheute sich nicht, den Menschen zusammen mit den Affen in die Ordnung der Herrentiere (Primates) zu platzieren.
Die Grundlagen für diese bahnbrechende Leistung wurden bereits in Linnés früher Jugend im Elternhaus gelegt. Sein Vater Nils entstammte einer Bauernfamilie. Als er in den geistlichen Stand übertrat und Pfarrer in Småland in der kleinen Landgemeinde Stenbrohult wurde, legte er seinen elterlichen Namen Ingemarsson ab und nannte sich nach den Linden am Hof seiner Eltern Linnaeus. Er war ein leidenschaftlicher Gärtner und legte um das Pfarrhaus herum einen herrlichen Garten an. Der kleine Carl lernte die Namen der Pflanzen kennen und konnte bald die einzelnen Arten voneinander unterscheiden. In dieser Zeit reifte, sehr zum Missfallen des Vaters, sein Entschluss, sich auch zukünftig mit der Pflanzenkunde zu beschäftigen. Seine schulischen Leistungen waren eher mittelmäßig und nur durch Fürsprache seines Schwagers und ehemaligen Hauslehrers Hoek schaffte er es an die Universität in Lund, wo er mit dem Medizinstudium begann, das damals wegen ihrer medizinischen Bedeutung die Pflanzenkunde einschloss. Schon nach einem Jahr wechselte er nach Uppsala. Hier wurde man wegen seines Fleißes und seiner Pflanzenkenntnisse auf den jungen Carl aufmerksam und gewährte ihm Zutritt zu Bibliothek und Herbar. Kurze Zeit später erschien seine erste Schrift über die Hochzeit der Pflanzen, in der er immer wieder das Wunder der Schöpfung hervorhebt und seine Beobachtungen in sehr poetische Worte kleidet. Das Jahr 1735 dürfte das ereignisreichste seines Lebens gewesen sein. Der 28-jährige Linné reiste über Hamburg nach Amsterdam, seine Dissertation im Gepäck, wurde dort zum Doktor der Medizin promoviert und konnte kurz darauf mit finanzieller Hilfe eines holländischen Sponsors sein Hauptwerk, die Systema naturae, in Leiden in der ersten Auflage herausbringen. In dieses Jahr fiel auch seine Verlobung mit Sara Elisabeth Moraea, die er nach seiner Rückkehr nach Schweden 1739 heiraten konnte, nachdem sich seine finanzielle Situation durch eine Festanstellung am Marinekrankenhaus in Stockholm stabilisiert hatte. Fünf Töchter und zwei Söhne wurden zwischen 1741 und 1757 geboren.
Im Alter von 34 Jahren wurde Linné 1741 auf den Lehrstuhl für praktische Medizin der Universität Uppsala berufen. Seine besondere pädagogische Begabung und der lebendige Unterricht führten einige hundert Studenten in seine Veranstaltungen. Zahlreiche kleinere und größere Arbeiten entstanden in dieser Zeit, unter anderem das dreibändige Lehrbuch über die Heilmittel aus dem Reich der Pflanzen, der Tiere und der Mineralien mit dem Titel Materia medica. 1758 erschien der erste Band der zehnten Auflage seiner Systema naturae, der 4.326 Tierarten in stringent durchgehaltener binominaler Nomenklatur aufführt. Diese Ausgabe fixiert den Beginn der allgemeinen Anwendung der binominalen Nomenklatur in der Zoologie. Der botanische Teil erschien als Band 2 ein Jahr später.
Gleichzeitig glaubte Linné, in seinem System eine vom Schöpfer gewollte Rangordnung entdecken zu können. Auf der niedrigsten Stufe sah er die Moose. Wie einfache Häusler müssten sie sich mit den ärmsten Böden begnügen, diese urbar machen und überhaupt allen höher gestellten Pflanzen zunutze sein. Auf der nächsten Stufe stünden die Gräser. Ihr Platz sei vergleichbar mit dem der Bauern. Sie machten die Stärke des Pflanzenreiches aus. Der Adel werde durch die bunte Vielfalt der Kräuter repräsentiert. Sie verdienten es, wegen ihrer Farbenpracht, ihres Duftes und ihres Geschmackes hoch geschätzt und bewundert zu werden. Über allen Gewächsen aber stünden, den Fürsten gleichzusetzen, die Bäume. Sie böten ihren Untertanen mancherlei Schutz und Fürsorge.
In gleicher Weise verfuhr er mit dem Tierreich. Natürlich nahm der Mensch in der von Linné erkannten Stufenleiter den obersten Platz ein. Er sei der Mächtigste von allen, könne die gierigsten Raubtiere bändigen und verstünde es, alle untergeordneten Tiere und Pflanzen für sich dienstbar zu machen. Wie alle Lebewesen sei auch der Mensch ein Teil der Natur und würde in den ihm gebührenden Grenzen gehalten. Das göttliche Naturgesetz ließe Kriege und Krankheiten überall dort entstehen, wo sich die Menschen im Übermaß vermehrt hätten.
Der Schlüssel zum Erfolg seiner Arbeit war die klare und praktikable Darstellung seiner Erkenntnisse. Linné verwendete vier Kategorien: Die unterste Stufe bildete die Art. Arten wurden zu Gattungen gruppiert, diese wiederum den Ordnungen zugeteilt und die Ordnungen schließlich zu Klassen zusammengefasst. Mit der Nennung der beiden niedrigsten Kategorien – der Gattung und der Art – konnte jedes Tier und jede Pflanze von nun an genau und unverwechselbar bezeichnet werden. Genial ist dabei nicht nur die leicht überschaubare Stufenleiter, genial ist die Methode vor allem deshalb, weil hierbei Benennung und Beschreibung erstmals voneinander getrennt wurden. Aus einem Scarabaeus thorace inermi, capite tuberculato, elytris rubris, corpore nigro (Käfer mit unbewaffnetem Thorax, gekörneltem Kopf, roten Flügeldecken und schwarzem Körper) machte Linné einen Scarabaeus fimentarius mit nachfolgender Charakterisierung. Das bedeutete eine erhebliche Vereinfachung. Der Name war kurz und gut zu merken, zudem musste die Beschreibung lediglich die Merkmale zur Erkennung der Art enthalten, da alle übrigen Kennzeichen bereits mit Zuordnung zu den höheren Kategorien gegeben worden waren. Jetzt wurde es möglich, jede Art in der erforderlichen Ausführlichkeit zu beschreiben und dem System auf allen Ebenen beliebig viele neue Taxa anzugliedern.
Dieses Vorgehen wird als binominale Nomenklatur bezeichnet und ist zu einer weltweit gültigen Wissenschaftsnorm in der Biologie geworden. Alle heute bekannten 1,85 Millionen Lebewesen sind nach diesem von Linné eingeführten Prinzip unter Nennung von Gattung und Art mit einem eindeutigen wissenschaftlichen Namen belegt worden. Natürlich wurde das Prinzip im Laufe der Jahre durch Einfügen weiterer Kategorien verfeinert und teilweise durch eine trinominale Nomenklatur (Gattung, Art und Unterart bzw. Rasse) ersetzt. Zudem wird heute der Name des Autors, der die erste Beschreibung der Art veröffentlicht hat, angefügt (z.B. Scarabaeus fimentarius LINNÉ). Auch wenn viele seiner Neuerungen wenigstens ansatzweise in den zuvor erschienenen Arbeiten seiner Berufskollegen enthalten waren, setzte sich allein Linné mit seiner Art der Darstellung durch und erwarb sich damit bleibenden Ruhm.
Zwei Schlaganfälle in den Jahren 1772 und 1774 führten schließlich zur fast vollständigen Lähmung seines Körpers. Am 10. Januar 1778 wurde der bedeutendste Naturforscher des 18. Jahrhunderts von seinen Leiden erlöst. Linné wurde in der Domkirche zu Uppsala beigesetzt. Sein ältester Sohn Carl hatte bereits 1777 seinen Lehrstuhl in Uppsala übernommen, sein Nachlass aber wurde nach Erbstreitigkeiten nach England verkauft und wird von der Linnean Society of London verwaltet.
Werke
Linné, C. v., 1737: Flora Lapponica: Exhibens Plantas per Lapponiam Crescentes, secundum Systema Sexuale Collectas in Itinere Impensis. Amsterdam, 372 S.
Linné, C. v., 1746: Fauna Suecica. Stockholm, 411 S.
Linné, C. v., 1758: Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus differentiis, synonymis, locis. 10. Auflage von Linné umgearbeitet und sehr stark vermehrt. Holmiae, 829 S.
Linné, C. v., 1770: Philosophia Botanica. In qua explicantur fundamenta botanica cum definitonibus partium, exemplis terminorum, obersavationibus ratiorum, adjectis figuris Aeneis. Wien, 364 S.