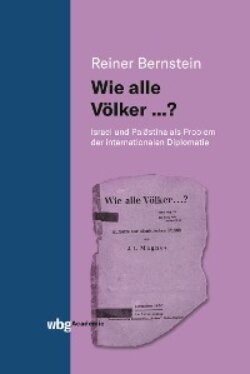Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Berliner Bekenntnisse
ОглавлениеDer israelisch-palästinensische Brandherd ist international an den Rand gedrängt oder gar abgeschrieben worden, obwohl von ihm eine Destabilisierung im gesamten Nahen Osten ausgeht. Die ausführlichen Jahresberichte der europäischen „Heads of Missions“ in Jerusalem finden in den Hauptstädten keine hinreichende Aufmerksamkeit. Stattdessen haben sich zum 70. Jahrestag der Gründung Israels deutsche Politiker und solche, die sich zur Verantwortung berufen fühlen, zu Lobeshymnen veranlasst gesehen. Schon ein Jahr zuvor luden die Fraktionen des Bundestages zwei israelische Referenten, aber keinen palästinensischen Gast ein und stellten ihrem Fragenkatalog das Bekenntnis voran:
„Israel ist als jüdischer und demokratischer Staat sowohl aufgrund seiner Geschichte sowie seiner geographischen Gegebenheiten innerhalb der Region in einer besonderen Situation.“
Im Februar 2018 distanzierte sich der Koalitionsvertrag von Union und SPD von der Siedlungspolitik, zu deren auswärtiger Akzeptanz die israelische Exekutive erhebliche Mittel einsetzt, und wiederholte die besondere Verantwortung gegenüber Israel als einen jüdischen und demokratischen Staat. Zwei Monate später würdigten die Fraktionen von Bündnis90/Die Grünen und DIE LINKE Israels demokratische und rechtsstaatliche Strukturen, erinnerten an die Flucht und Vertreibung der 750.000 Palästinenser 1947/48, rügten die Siedlungspolitik, verwahrten sich gegen „Israelfeindschaft“ und bekannten sich zur Existenz und zu den Sicherheitsinteressen Israels als einem zentralen Prinzip der deutschen Politik. Für die Palästinenser blieb nur der Sarkasmus über die Uneinigkeit zwischen der PLO und „Hamas“ sowie „die Unbeweglichkeit und schlechte Regierungsführung“ in Ramallah übrig.
Legislative und Exekutive beharren auf ihren präfixierten Sackgassen. Dabei hatten schon 2008 zwei mit der Arbeit der US-Administration vertraute Autoren der Behauptung widersprochen, die Thematisierung der politischen Asymmetrien bedeute den Abschied von Israel. Vielmehr komme die rücksichtslose Solidarität einem strategischen Eskapismus gleich und könne sich für Israel als lebensgefährlich erweisen. Die „obszönen Schemata der Annexion großer Teile der Westbank oder die Vertreibung von Arabern aus Israel selbst“, mit denen die Nebelschwaden Netanjahus auf die „Kein-Staat-Lösung“ (Roger Cohen) zusteuern, waren höchst verdächtig. Dass pflichtschuldig vorgetragene Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser geht entgegen allen Erfahrungen von der Erwartung aus, mit dem Aufbau ihrer Institutionen sei das Ziel eines Staates Palästina vorgezeichnet.
„Es gab eine Zeit, wo das Wort ‚deutscher Zionismus‘ in der zionistischen Welt einen bestimmten qualitativen Sinn hatte. Es war nicht nur eine geographische Bezeichnung. Die Wortzusammenstellung wird vielen nicht gefallen, sie ist plump und unangemessen, aber es steckt darin ein richtiger Kern“, hat Robert Weltsch (1891 – 1982), Chefredakteur der bis 1939 in Berlin erschienenen Wochenzeitung „Jüdische Rundschau“, herausgegeben von der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, in der Rückschau konstatiert: Es ging um Warnungen vor nationaler Selbstgerechtigkeit. Vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum gebürtige Frühzionisten – der in Berlin praktizierende Kinderarzt Siegfried Kanowitz (1900 – 1961) bezeichnete die Einwanderer aufgrund ihrer pazifistischen Gesinnung als „schwierigen Exportartikel“ – kannten am ehesten den ungezähmten Extremismus.
(Courtesy of the Hebrew University in Jerusalem)
Akiva Ernst Simon (1899 – 1988). „In meinem wohlhabenden, gebildeten musikfreudigen Elternhaus [in Berlin] hatte ich vom Judentum nichts gehört, gesehen und erlebt: kein Wort hebräisch, kein Fest (außer Weihnachten!), keine Synagoge, keine Barmizwa. Aber Vater war streng gegen die Taufe: ‚Ein anständiger Mensch verlässt keine belagerte Festung wegen eines Vorteils.“ Guy Miron hat an Simons Satz zur Eröffnung des „Leo Baeck Institut“ in Jerusalem am 31. Mai 1955 erinnert: „Das deutsche Judentum ist ein Toter, der nicht bestattet und beklagt wurde. Es liegt uns ob, diese Pflichten [in Israel] nachzuholen.“ Gershom Scholem hat berichtet, dass er im Gegensatz zu Simon nicht „ganz zum Judentum zurückkehren“ wollte.
1928 erhielt Ernst Simon eine Anstellung als Lehrer und Seminarleiter an der Hebräischen Universität, aus der sich eine Professur für Philosophie und Erziehungswissenschaften ergab. Drei Wochen vor dem Junikrieg 1967 wurde ihm der Staatspreis zugesprochen. Auf seiner Grabplatte in Jerusalem ist dem religiösen Humanisten ein Denkmal als „Lehrer in Israel“ gesetzt worden. Im Geleitwort zu Simons Briefsammlung hat Rabbiner Yehoschua Amir daran erinnert:
„Wer einmal die Inbrunst gehört hat, mit der er in unserer nicht-orthodoxen Synagoge zur Thora aufgerufen, den Segensspruch über die Thora sprach, der wußte, dass Simon den ihm gemäßen Platz im Judentum gefunden hatte. Aber wiederum: so packend er seiner Glaubensgewißheit Glaubensgewißheit in seinen Predigten Ausdruck zu geben wußte, so war ihm jede Gedankenverbindung zwischen Glauben und Macht in tiefster Seele fremd. Fanatisch war er höchstens in seinem bedingungslosen Eintreten für Toleranz.“
Im Gegensatz zu Stefan Heym (1913 – 2001), Fritz Kortner (1892 – 1970), Ernst Deutsch (1890 – 1969), Anna Seghers (1900 – 1983) und Arnold Zweig (1887 – 1968) – er war als einziger nach Palästina ausgewandert – war es für Simon ausgeschlossen, nach Deutschland zurückzukehren. Es blieb bei Visiten.
Wir leben nicht im Elfenbeinturm intellektueller Debatten. Die Bereitschaft zur Auseinandersetzung bedeutet einen Gewinn an Freiheit im Denken und Handeln. 1957 schrieb Weltsch, der nach den Worten der Tel Aviver Historikerin Anita Shapiras einen „dominanten Einfluss“ auf die deutschen Zionisten ausübte, dass „die Erkenntnisse und Erlebnisse, die den deutschen Zionismus geformt haben, auch unter den nun veränderten Verhältnissen wirksam sind. Es wäre eine interessante Aufgabe, unter diesem Gesichtspunkt die Außenpolitik des Staates Israel einer objektiven kritischen Betrachtung – außerhalb der Arena tagespolitischen Streites – zu unterziehen. Zu einer solchen Untersuchung, sagen viele, ist die Zeit nicht reif …“ Ist sie gekommen, gar überfällig? Aus seiner Korrespondentenzeit in Beirut und Jerusalem hat Thomas L. Friedman überliefert, „dass die Wirklichkeit kaum Ähnlichkeit mit den blutleeren, logischen und antiseptischen Darstellungen in den Lehrbüchern hat“. Kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2018 plädierte Sigmar Gabriel für „die offene Debatte … als Zeichen unserer Stärke“.
Vom Blick nach innen erschließen sich in Längs- und Querschnitten Einschätzungen zur intimen Dialektik von Ideologie und Geschichte, so dass neue Achsen für das Urteil erkennbar werden. Denn es fällt auf, dass sich Regierende, Parlamentarier und um Einfluss ringende Honoratioren im westlichen Ausland in innerjüdischen und -israelischen Zusammenhängen, Kontroversen und Aporien hilflos verfangen, während gleichzeitig die historische und politologische Literatur israelischer Autoren vielfach durch interpretatorische Offenheit dem Material gegenüber ausgewiesen ist, wenn es nicht um die Begleiterscheinungen im Vorfeld und im Gründungsjahr 1948 geht; hier werden ideologische Barrieren gegen den Verdacht ins Feld geführt, dass die Legitimität Israels in Zweifel gezogen wird. Vor allem, wenn sie im Ausland arbeiten, ist die Freimütigkeit auch unter arabischen Wissenschaftlern eingezogen. Nach den Epochen der Mantra-artigen Beschuldigungen und Anklagen ist die selbstkritische Befassung mit der arabischen Politik auf dem Vormarsch.
Ben-Gurion hat den Zionismus gern mit dem amerikanischen Traum der Eroberung des Mittleren Westens verglichen. Mag man Donald Trump politische Berechenbarkeit absprechen, so springt bei Netanjahu das Gegenteil ins Auge: ein durchtrainiertes, in sich ruhendes Kalkül mit autistisch-leidenschaftlichen Zügen, die Argumenten kaum zugänglich sind. Dazu hat Bob Woodward aus den Gesprächen mit Ministern und hohen Beamten deren fortwährenden Eindruck geschildert, dass Trumps Improvisation seine große Stärke sei, dass er „mit einem Blick eine Situation oder einen Raum erfassen könne“ und dass er „nicht durch umsichtiges Vorausdenken vom Gleis abgebracht werden“ wolle. Strategisches Denken liege ihm fern. Nur seine Erinnerungsschwäche, die an den vermeintlichen oder tatsächlichen Belastungen des Staatshaushaltes endete, verhinderte unter dem vorsorglichen Einsatz seiner Berater manche schwerwiegenden Entscheidungen oder verwässerten sie, um seiner „krankhafte(n) Unabhängigkeit und Irrationalität“, verstärkt durch die unablässige Aufmerksamkeit für die Fernsehnachrichten besonders in „Fox News“ und die Presseberichte über ihn, einen Riegel vorzuschieben. „Es bringt überhaupt nichts, dem Präsidenten eine durchdachte, substanzielle Vorlage zu erstellen, durchorganisiert und mit Folien versehen. Man weiß ja, dass er sowieso nicht zuhört“, beschwerte sich Trumps demokratischer Wirtschafts- und finanzpolitischer Berater Gary Cohn.
Im Gegensatz dazu ist auf Netanjahus Kurs berechenbarer Verlass: Er spielt weder Vabanque, noch hat er mit dem „Nationalstaatsgesetz“ den „Weg der totalen Dummheit oder der moralischen Einfalt“ (Eric H. Yoffie) eingeschlagen. Da beiden Selbstzweifel fremd sind, ist Israel der „Staat der Trumpisten“ ein moralisches Chaos repräsentieren, genannt worden, beide werden von großen Teilen ihrer Bevölkerung getragen. Indem sie auf der Welle des polulistischen „national interest“ reiten, stehen sie an der Spitze des Zerfalls der liberalen Demokratie, die keinen Relativismus kennt, wie Yascha Mounk für die USA belegt hat. Nationale Souveränität ist ihnen wichtiger als globale Abhängigkeiten. Sehen sie die Welt als Parias? Während das Motto „America first“ auf die Unabhängigkeitserklärung vom 04. Juli 1776 zurückgreift, hat das Jahr 1967 der Formel „Israel alone“ die endgültige Schubkraft verliehen. Mit ihm beginnt das koloniale Projekt, das auf Begründungen und Rücksichtnahmen verzichtet, die aus dem politischen Streit während der britischen Mandatszeit nicht wegzudenken sind.
Das von mir herangezogen Material ist im Allgemeinen in der Ursprungssprache ausgewertet worden. Zitate wurden in der originalen Schreibweise übernommen. Bei hebräischen und arabischen Namen und Begriffen folge ich der dortigen Zitierung, so dass es zu Mehrfachschreibweisen kommen kann.
Sehr zu danken habe ich Margret Greiner, Autorin zu jüdischen, palästinensischen und israelischen Frauen, und ihrem Ehemann Dr. Bernhard Greiner, Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte in Tübingen, für die liebevolle und kompetente Begleitung sowie Wolfgang Z. Keller (Pehl am Ammersee) für die Durchsicht erster Entwürfe. Der Münchner Fotograf Fritz Mastnak hat mir zu den Aufnahmen aus der Farm von Daoud Nasser und aus „Neve Shalom/Wahat As-Salam“ verholfen, Darlene Dunham (Seattle) hat mir das Foto vom Checkpoint vor Bethlehem überlassen. Dr. Stefan Litt von der Nationalbibliothek der Hebräischen Universität hat zwei Aufnahmen beigesteuert. Dr. Roni Hammermann (Jerusalem), die seit Jahren mit den Frauen von „Machsom Watch“ das Verhalten israelischer Soldaten gegenüber Palästinensern an den „Checkpoints“ beobachtet, hat mir bei der Suche nach Materialien zu Magnes geholfen. Georg Nacke (Blaichach) macht mich seit langem auf interessante Beiträge aufmerksam. Jochi Weil (Zürich) hat mich auf das „Eidgenössische Department für auswärtige Angelegenheiten“ zugunsten der „Genfer Initiative“ aufmerksam gemacht. Mein großer Dank gilt Privatdozent Dr. Thomas Meyer (München/Berlin) als vorzüglichem Kenner der jüdischen Philosophie, Dr. Tilman Spengler, Mitglied im Pen-Zentrum Deutschland (Ambach am Starnberger See), für seine Begleitung sowie Anja Neiss-Regnier (München) für sachdienliche Hinweise.
Mein besonderer Gruß für das Geleitwort geht an Prof. Dr. Moshe Zimmermann, bis zu seiner Emeritierung 2012 Direktor des „Richard Koebner Minerva Center for German History“ an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Ohne die Ermutigungen und Hilfen meiner in Jerusalem geborenen Frau Judith Bernstein sowie unserer Töchter Sharon Blumenthal mit Ehemann Eric und ihren Kindern Talja und Edna (Köln) sowie Shelly Steinberg (Tel Aviv) wäre das Buch nicht entstanden.
Als Plädoyer in der nahöstlichen Debattenkultur fühle ich mich als Begleiter und Autor jenen Menschen auf beiden Seiten der Konfliktlinien verbunden, die sich unter erheblichen persönlichen Beeinträchtigungen für den politischen Ausgleich nach innen und außen einsetzen. Statt den Anschein von wissenschaftlicher Ojektivität vorzuspiegeln, geht es mir um die Aufmerksamkeit für geradezu zwingende Kontinuitäten aus theoretischen und politischen Narrativen sowie aus biographischen Determinanten. Ihre Details konstituieren die große Agendafülle, hinter der sich Völker verschanzen, zu ihren Gefangenen werden und Klischees produzieren, hat David Grossman ausgeführt. John Kerry hat seiner politischen Autobiographie „Every Day Is Extra“ die Anmerkung vorausgeschickt, dass sie „eine Haltung gegenüber dem Leben“ sei. Auch wenn mich die Interaktionen zwischen Theologie und Politik seit langem beschäftigen, war ich erstaunt, in welcher Fülle die öffentlichen Debatten in Israel auf biblischen Quellen zurückgreifen, welche die Doppelidentität von Religion und Nation bestätigen und dem einstigen Schmelztigel-Ideakl ein Ende bereiten sollen. Der Koran hat nichts vergleichbares aufzuweisen.
1 Martin Buber und Franz Rosenzweig übersetzten den Vers in Num. 23,9 so: „Da, ein Volk, einsam wohnt es, unter die Erdstämme rechnet sich’s nicht“. Der Historiker Amos Funkenstein (1937 – 1995) hat auf die tägliche Danksagung in der Liturgie aufmerksam gemacht, dass der Schöpfer „uns nicht gleich den Völkern der Länder erschaffen und uns nicht den anderen Geschlechtern der Erde gleichgestaltet hat“.
2 Antwort des Auswärtigen Amtes auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kerstin Müller (Köln), Marieluise Beck (Bremen), Agnes Brugger u.a. und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 13. Mai 2013. BT-Drucksache Nr. 17-13339 vom 29.04.2013.
3 Deut. 30,4-5. Dazu Jer. 31,7-8: „Denn so spricht der Herr: Jauchzet Jakob zu und brecht in Jubel aus über das erste der Völker! Tut es laut unter Lobgesang kund: Der Herr hat Sein Volk gerettet, den Rest Israels! Ja, Ich bringe sie herbei aus dem Lande im Norden und hole sie zusammen aus den Winkeln der Erde.“
4 Ex. 3,7-9.
5 Israels Knesset verabschiedete am 19. Juli 2018 das „Nationalstaatsgesetz für das jüdische Volk“ mit 62 gegen 55 Stimmen.
1. Grundprinzipien
Das Land Israel ist die historische Heimat des jüdischen Volkes, die der Staat Israel geschaffen hat. Der Staat Israel ist die nationale Heimat des jüdischen Volkes, in dem es sein natürliches, kulturelles, religiöses und historisches Recht auf Selbstbestimmung erfüllt. Das Recht, die nationale Selbstbestimmung im Staat Israel zu erfüllen, ist allein dem jüdischen Volk vorbehalten („is unique to the Jewish people“).
2. Symbole des Staates
Der Name des Staates ist „Israel“.
Die Staatsflagge ist weiß mit zwei blauen Streifen an den Seiten und einem blauen Davidsstern in der Mitte. Das Staatsemblem ist ein siebenarmiger Leuchter mit Olivenblättern auf beiden Seiten und dem Wort „Israel“ darunter. Die Staatshymne ist „Die Hoffnung“ („Ha-Tiqva“). Details bezüglich der Staatssymbole wird ein Gesetz regeln.
3. Hauptstadt des Staates
Jerusalem in Gänze und vereinigt ist die Hauptstadt Israels.
4. Sprache
Die Sprache des Staates ist Hebräisch. Die arabische Sprache hat einen speziellen Status im Staat. Regulierungen zum Gebrauch des Arabischen in staatlichen Einrichtungen oder durch sie wird ein Gesetz regeln. Diese Klausel beeinträchtigt nicht den Status, der der arabischen Sprache gegeben wurde, bevor dieses Gesetz in Kraft trat.
5. Einsammlung der Zerstreuten
Der Staat steht der jüdischen Einwanderung und der Einsammlung der Zerstreuten offen.
6. Bindungen an das jüdische Volk
Der Staat will sich bemühen, die Angehörigen des jüdischen Volkes abzusichern, die in Schwierigkeiten oder gefangen sind, [und zwar] aufgrund der Tatsache ihrer Zugehörigkeit zum Judentum („Jewishness“) oder ihrer Staatsbürgerschaft. Der Staat handelt in der Diaspora, um die Bindungen („affinity“) zwischen dem Staat und den Angehörigen des jüdischen Volkes zu stärken. Der Staat wird tätig, um das kulturelle, historische und religiöse Erbe des jüdischen Volkes in der Diaspora zu stärken.
7. Jüdische Ansiedlung
Der Staat betrachtet die Entwicklung der jüdischen Ansiedlung („settlement“) als einen nationalen Wert und wird tätig, um ihre Schaffung und ihre Konsolidierung zu ermutigen und zu fördern.
8. Offizieller Kalender
Der hebräische Kalender ist der offizielle Kalender des Staates, daneben wird der Gregorianische Kalender als ein offizieller Kalender verwendet. Der Gebrauch des jüdischen Kalenders und des Gregorianischen Kalenders wird ein Gesetz regeln.
9. Unabhängigkeitstag und Tage des Gedenkens
Der Unabhängigkeitstag ist der offizielle nationale Feiertag des Staates. Der Tag des Erinnerns an die Gefallenen in Israels Kriegen sowie der Tag des Gedenkens an den Holocaust und an das Heldentum („Holocaust und Heroism Remembrance Day“) sind die offiziellen Gedenktage des Staates.
10. Ruhetag und Shabbat
Der Shabbat und der Feierlichkeiten Israels sind die Ruhetage im Staat; Nichtjuden haben das Recht, ihren Shabbat und ihre Feierlichkeiten als Ruhetage zu pflegen. Details in diesen Angelegenheiten wird ein Gesetz regeln.
11. Unveränderlichkeit
Das Grundgesetz darf nicht ergänzt werden, bis ein anderes Grundgesetz von der Mehrheit der Mitglieder der Knesset verabschiedet ist.
6 Absolvent der Princeton University, Promotion über Ostasien an der „Rutgers University“, Rückkehrer zur Religion („Ba’al T’shuvá“), Anhänger Meir Kahanes, Mitglied der staatlichen Bildungskommission, Gründer des „Shalem Center“ zur Förderung von biblischen, talmudischen und mittelalterlich-jüdischen Studien sowie Präsident des „Herzl Institute“ in Jerusalem. Sein jüngstes Buch „The Virtue of Nationalism“ (New York 2018) hat er den „Mitgliedern meines Stammes“ gewidmet.
7 2. Sam. 7,23.
8 Ex. 20,3: „Du sollst keine anderen Götter haben als Mich.“
9 Zum Bundesschluss zwischen Gott und den Israeliten sowie zur wiederholten Verheißung des Landes Gen. 12,7; Gen. 17; Gen. 26,2; Gen. 28,13.
10 Gen. 27,39f.
11 Jes. 1,27.
12 Klammer im Original.
13 1. Könige 19,9ff.
14 Psalm 29,11.
15 Mein Interview mit Uriel Simon in den Anlagen.
16 Martin Bauschke hat für die Nennung Moses‘ 36 Stellen in den 114 Suren und für Abraham 25 Stellen gezählt.