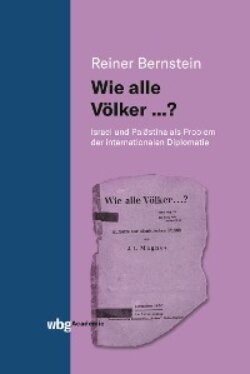Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel IV
Das Schwert des Krieges als Rechtsstandpunkt
Оглавление„Sicherheit steht über allem anderen28.“
Kurz nach dem Sechs-Tage-Krieg – Jakob Hessing hat darauf aufmerksam gemacht, dass die israelische Übernahme auf die sechs Tage des biblischen Schöpfungsberichts verweist – hatte der zur Arbeitspartei gehörige Verkehrsminister Moshe Carmel (1911 bis 2003) die Hoffnung geäußert, dass sich die Welt nach 20 Jahren an die Besetzung der Westbank gewöhnt haben werde – „Wir haben mehr Rechte und können uns mehr mit diesen Territorien identifizieren als er [König Hussein]“ –, während Finanzminister Pinchas Sapir (1906 – 1975) „ein Desaster“ befürchtete, weil Israel mit weiteren 600.000 Arabern zu einem arabischen Staat werde. Dieselbe Sorge äußerte Erziehungsminister Zalman Aranne (1899 bis 1970).
2004 wies der Internationale Gerichtshof in Den Haag, dem Israel wie Frankreich und Großbritannien nicht angehört, die israelische Behauptung zurück, Absatz 6 des Artikels 49 („The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies“) der Genfer Konvention – von Israel am 06. Juli 1951 ratifiziert – sei im Blick auf die Siedlungen und die „Trennungsmauer“ („Gadér Ha-Hafradá“) nicht anwendbar. Wenn die Besatzungsmacht ihre Verpflichtungen umfassender Art („erga omnes“) gemäß dem internationalen Recht nicht nachkomme, könnten andere Staaten sie zwar dazu zwingen, so der Tel Aviver Verfassungsrechtler Eyal Benvenisti, doch im UN-Sicherheitsrat zeigten sich die fünf Veto-Mächte uneins, ob gemäß Artikel 24 der UN-Satzung die israelisch-palästinensische Konfrontation als Bedrohung der korporativen Sicherheit zu bewerten sei, zumal da die Palästinenser keinen Staat haben, um mit dem Gericht zusammenarbeiten zu können. Im Haager Votum blieb außerdem die Frage offen, ob die Westbank und Ost-Jerusalem souveränitätspolitisch „Terra nullius“ sind. Die UN-Schutzverantwortung („Responsibility to protect“) von 2005 bindet nur Staaten, klammert also „Palästina“ aus.
Schon ein Jahr nach dem Junikrieg entwarf der Dozent für internationales Recht an der Hebräischen Universität in Jerusalem und nachmalige UN-Botschafter Yehuda Z. Blum in rechtspolitisch schöpferischer Exegese das bis heute gültige Konzept, wonach der „Rechtsstandpunkt Israels in den in Frage stehenden Gebieten [Ost-Jerusalem, Westbank und Gazastreifen] der eines Staates ist, der juristisch ein Gebiet kontrolliert, auf das kein anderer Staat einen besseren Titel vorweisen kann“. Der an der Tel Aviver Universität tätige Verfassungsrechtler Yoram Dinstein befand, dass Israel seine Existenz keineswegs aus der UN-Teilungsresolution bezogen habe, auch wenn diese „ein historisch wichtiges Bindeglied in einer Kette von Ereignissen“ gewesen sei. Vielmehr seien 1948 die „Waagschalen der Staatlichkeit durch ein Schwert in Bewegung gesetzt“ worden, dann noch einmal 1967.
1971 bekräftigte ein Symposium in Tel Aviv die Ablehnung fremder Souveränitätsrechte in der Westbank: Meir Rosenne (1931 bis 2015), Botschafter und Rechtsberater mehrerer Regierungen, vertrat die Auffassung, dass das Recht nicht im Vakuum operiere, sondern in engstem Kontakt mit Fakten stehe. 1980 unterstrich der 1925 in Danzig geborene Meir Shamgar – 1961 bis 1968 Militärstaatsanwalt, von 1968 bis 1975 Generalstaatsanwalt, ab 1975 Mitglied des Obersten Gerichts sowie zwischen 1984 und 1995 dessen Präsident –, dass die Haager Landkriegsordnung von 1907 und Gewohnheitsverfahren nur auf einer „De facto“-Basis Beachtung finden könnten. Ihm zufolge ließ sich die Vierte Genfer Konvention nicht unmittelbar auf Judäa und Samaria übertragen. Die Militärverwaltung unterliege keiner zeitlichen Begrenzung, so Shamgar weiter, und müsse beachten, dass das Territorium vor 1967 keinen Souverän gehabt habe, nachdem der Waffenstillstandsvertrag mit Ägypten von 1949 ausdrücklich erklärt habe, dass die Demarkationslinien keinesfalls eine politische oder territoriale Grenze sowie kein Rechtspräjudiz darstellen. Das Niveau der „humanitären Vorkehrungen“ schloss Shamgar gleichwohl nicht völlig aus. Schon 1978 hatte Menachem Begin in einer Anweisung die israelischen Vertretungen im Ausland angewiesen, dass die Bezeichnungen „Administered Territories“ und „Westbank“ zugunsten Judäa und Samaria – „der göttlichen Zusage“ – entfallen sollten. Der Titel der von Shamgar herausgegebenen Sammelschrift „Military Government in the Territories Administered by Israel“ war bewusst missverständlich formuliert.
Würden wir, so zog der Jurist Netanel Lorch nach, die Genfer Konvention beachten, hätten wir die Demarkationslinie von 1949 nachträglich als internationale Grenzen billigen müssen. Nicht einmal für den Gazastreifen habe Ägypten Souveränitätsansprüche geltend gemacht. Anders sei die Sache bei den Golanhöhen gelagert, aber, so fragte Lorch: „Welchem Zweck würde es dienen, wenn wir die Konvention nur auf diesen Bergrücken anwenden?“ Nach vier Jahrzehnte sah sich US-Botschafter David Friedman von Tel Aviv aus das „State Department“ erneut zur Ermahnung an die Medien veranlasst, auf den Begriff „Besatzung“ zu verzichten. Meron Benvenisti hat die Polarität zwischen einer Siedlerin und einer Palästinenserin als einen „Zusammenprall zweier Welten“ in die Worte gefasst:
„Die jüdische Frau, die einen Anspruch auf Schutz durch die Sicherheitskräfte hat, besitzt alle Rechte eines freien Landes. Auf der anderen Seite steht eine Frau eines besetzten Volkes, die auch ein Recht auf Schutz hat. Doch die Besatzungsarmee hat seit langem vergessen, dass sie nach dem Völkerrecht die Aufgabe hat, das zu beschützende Volk zu beschützen. Die Armee ist zur Miliz der Siedler geworden und betrachtet die einheimische Bevölkerung als feindliche Elemente. Es ist leicht, die vulgäre Art der Siedler in Hebron zu verurteilen, und es ist leicht, die jüdische Enklave als eine Bande gewalttätiger Gangster abzutun. Es ist das Regime, das sich auf ethnische Diskriminierung und Trennung, auf Doppelstandards und die Absenz des Gesetzes gründet.“
Palästinensische Kläger gegen jüdische Einzelpersonen und Einrichtungen müssen den Obersten Gerichtshof in Jerusalem anrufen, wenn sie gegen die Enteignung ihrer Böden Einspruch erheben wollen. 2012 befand die von Netanjahu berufene „Commission to Examine the Status of Building in Judea and Samaria“, dass
– das internationale Recht auf Israels Anwesenheit in Judäa und Samaria im Lichte der einzigartigen historischen und juristischen Umstände nicht übertragbar sei und
– die Genfer Konvention, was die Ansiedlung jüdischer Volksteile betreffe, aus eben jenen Gründen hier nicht gelten könne.
Für Kompromisse war kein Platz. Zur Beruhigung internationaler Einwände ist ausgeführt worden, dass die Landnahme nur selten Privatböden beträfe und wenige Palästinenser ihre Ansprüche in der Zeit in der Westbank zur Geltung gebracht hätten, als sie, „auf ihren Rechten schlafend“, im Zuge „obskurer Zuteilungen“ ihre Landflächen in jordanisches Staatsland umwandeln ließen. Einige Beispiele des israelischen Vorgehens, so die Autoren Yael Ronen und Yuval Shany, seien eher unter die Bezeichnung „Landreform“ zu subsumieren. Überdies verpflichte die am 24. Oktober 1945 in Kraft getretene UN-Charta die Mitgliedsstaaten, Streit friedlich beizulegen (Art. 2 Ziff. 2) und das Allgemeine Gewaltverbot anzuerkennen (Art. 2 Ziff. 4). Mit dieser Argumentationskette sollten palästinensische Ansprüche politisch aus der Welt geschafft werden. Bereits Mitte der 1930er Zeit war die Formulierung „Krieg“ zurückgewiesen und durch das Wort „Rebellion“ („Mahepechá“) ersetzt worden. In der UN-Menschenrechtskommission – seit 2006 dem UN-Menschenrechtsrat – blieb strittig, ob mit der Besatzung die nationalen Souveränitätsrechte der Palästinenser eingeschränkt würden.
Im Oktober 2017 informierte der UN-Sonderberichterstatter Michael Lynk den Generalsekretär, dass ihm die israelischen Behörden keine Genehmigung erteilten, seinen Auftrag zur Geltung elementarer Rechtsgüter zu erfüllen, obwohl das Recht auf Selbstbestimmung für alle Völker gelte, „die unter einer Besatzung und anderen Formen von Fremdherrschaft leben“. Ein halbes Jahr später meldete er nach New York, dass die israelische Politik den formellen Anschluss von Teilen der Westbank vorbereite, nachdem sie durch die Siedlungserweiterungen, militärische Sperrzonen und die Ablehnung palästinenisischer Bauanträge und durch andere Maßnahmen diesen endgültigen Schritt vorbereitet habe. Als im Juli 2018 Diplomaten aus Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Island, der Schweiz und Spanien die Schule im Beduinendorf Khan Al-Ahmar östlich von Jerusalem in der Zone C auf dem Weg zum Tote Meer besuchen wollten, wurde das Gelände kurzerhand zur militärischen Sperrzone erklärt. In den 1950er Jahren war der hier lebende Jahalin-Stamm aus dem Negev vertrieben worden. Das juristische Prinzip „Nullus commudum capere de sua injuria proprio“ – niemand darf aus dem von ihm begangenen Unrecht Nutzen ziehen – war geschleift.
Bei ihrem Besuch im Oktober 2018 in Jerusalem hat Angela Merkel die drohende Zerstörung des Beduinenlagers von Khan Al-Ahmar zwischen Jerusalem und dem Toten Meer „eine innerisraelische Angelegenheit“ genannt – dafür sorgt „die einzigartige Partnerschaft“, wie Merkel und Netanjahu ausführten –, obwohl sie das Ziel zweier Staten endgültig beschädigt, weil sie die Westbank in einen nördlichen und einen südlichen Teil trennt. Vermutungen, dass sie die Reise absagen werde, falls die Ansiedlung geräumt würde, nannte Merkel „Fake News“; Erziehungsminister Naftali Bennett bedankte sich bei ihr. Was ist schon die politische Enteignung der Palästinesner gegenüber IT-Verträgen mit Israel wert. Statt auf Khan Al-Ahmar verwendete die Bundeskanzlerin einen erheblichen Teil ihrer Gespräche darauf, die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen anzusprechen, obwohl die Zweifel groß sind, ob ein israelisch-palästinensischer Vertrag diesen Küstenstreifen einschließen wird.
Der Status als ein „Non-Member Observer State“ gemäß der Entschließung der UN-Vollversammlung vom 29. November 2012 hat die palästinensische Mängelliste nicht geheilt. Solange Artikel 27 Absatz 3 der UN-Charta zufolge ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates an seinem Vetorecht festhält, so lange bleibt die vollgültige Aufnahme eines neuen Staates in die Vereinten Nationen aus. Die PLO band sich zudem selbst, als sie in Artikel IX der Interimsvereinbarung dem Verzicht auf Botschaften, Konsulate und andere Arten von Missionen und Posten im Ausland zustimmte. Dementsprechend sind die im Januar 2018 gegen Israel eingebrachten 240 Beschwerden des UN-Menschenrechtsrats, zu denen das Ende der Siedlungserweiterung gehört, von der Exekutive in Jerusalem mit der Erklärung zurückgewiesen worden, Palästina würde „die Kriterien der Staatlichkeit unter internationalem Recht nicht erfüllen“. Im Juni 2018 verließen die USA das Gremium mit der Begründung der politischen Voreingenommenheit zu Lasten Israels, womit sie der Regierung Netanjahus Handlungsfreiheit einräumten.
28 Ehud Barak: We Must Save Israel From Its Government, in NYT 01.12.2017.