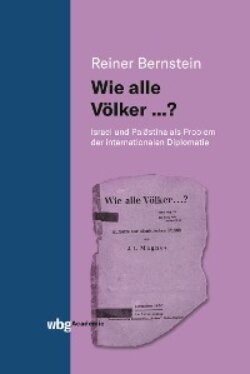Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel V
Keine Zukunft ohne Judentum
Оглавление„Das jüdische Volk ist durch sein Verhältnis zu Gott über alle naturgesetzlichen Zusammenhänge hinausgehoben29.“
Die Wahrung der Integrität des jüdischen Volkes „in seiner unendlichen Zersplitterung und Zerstreuung“ sei ihm aus eigener Kraft unmöglich gewesen, befand der aus dem neo-orthodoxen Umfeld in Halberstadt stammende Jizchak Fritz Baer (1888 – 1980), sondern verdanke sich „der göttlichen Vorsehung, die das jüdische Volk zu Zwecken erhält, die ihr allein offenbar sind“. Ihren Gegenpol erfuhr die Aussage bei Yosef Hayyim Yerushalmi, wonach die Geschichte zum einzigen Glauben ungläubiger Juden geworden sei: „Es liegt in der Natur der Sache, dass die moderne jüdische Historiographie außerstande ist, ein zerfallenes Gruppengedächtnis zu ersetzen, welches früher ohne den Historiker auskam.“ Davon blieben auch Juden in Osteuropa nicht verschont: Bereits 1823 hatte Heinrich Heine (1797 – 1856) in seiner Erzählung „Über Polen“ das Lied der doppelten Existenz angestimmt: „In der schroffen Abgeschlossenheit wurde der Charakter des polnischen Juden ein Ganzes; durch das Einatmen toleranter Luft bekam dieser Charakter den Stempel der Freiheit.“ Die Aufklärung setzte Gott ab, konstatierte Richard Lichtheim für die Zeit des deutschen Kaiserreichs. Gershom Scholem unterstellte den religiösen Reformern wie Ludwig Geiger (1848 – 1919), das Judentum seiner „mythischen oder irrationalen Elemente“ zu berauben, und verfolgte die Historisierung des Judentums mit Argwohn: Die Wissenschaft des Judentums lief für ihn auf seine „Liquidation … als eines lebendigen Organismus“ hinaus. In Abkehr von der „Haskala“ forderte Scholem eine „Wissenschaft vom Judentum“ zwecks „Erneuerung des Judentums … als eine(r) religiösmystische(n)“ Instanz im Gegensatz zum „empirische(n) Zionismus, der von einem unmöglichen und provokatorischen Zerrbild einer politisch angeblichen ‚Lösung der Judenfrage‘ ausgeht“, schrieb Scholem 1931 an Walter Benjamin. Ungehalten reagierte er auf den in Mähren geborenen Bibliographen und Orientalisten Moritz Steinschneider (1816 – 1907), für den die einzige Aufgabe nur noch darin bestand, „den Überresten des Judentums ein ehrenvolles Begräbnis zu bereiten“. Dabei war Scholem das Judentum als eine Religion der Vernunft (Hermann Cohen, 1842 – 1918) ebenso fremd wie die traditionelle religiöse Observanz. „Das Judentum als geistige dynamische Kraft existierte überhaupt nicht! Was uns entgegentrat, war erstarrte religiöse Überlieferung“, konstatierte auch Robert Weltsch. Im Rückblick beklagte er das trügerische „Gefühl der bürgerlichen Sekurität“, auch wenn „irgendwo im Verborgenen (…) der Wurm des Zweifels an dem Gefühl der Sicherheit (nagte)“.
Für Edmond Jabès (1912 – 1991) waren „Judaismus und Schreiben (…) nur einziges Warten, eine einzige Hoffnung, ein einziger Verschleiß“, hat Zygmunt Bauman (1925 – 2017) den französischen Schriftsteller und Dichter zitiert. Amos Oz und seine Tochter Fania Oz-Salzberger schrieben in ihrem Buch „Juden und Worte“ die Kontinuität des Judentums nicht der Biologie, sondern dem unendlichen Deutungsprozess von Texten zu. Jakob Hessing hat die folgenden Zeilen aus dem Text „Entdecken und Verhüllen in der Sprache“ von Chaim Nachman Bialik (1873 – 1934) aus dem Jahr 1915 überliefert: „Und wer weiß, vielleicht ist es gut so, dass dem Menschen nur die Schale der Wörter überliefert wird, nicht aber ihr Inhalt: So kann er sie jeweils aus eigener Kraft anfüllen, ihr etwas hinzufügen und das Licht seiner eigenen Seele in sie hineingießen.“
Asher Zvi Ginsberg (1856 – 1927). Der zu Unrecht als „agnostischer Rabbi“ Genannte gilt als Vater der israelischen Zivilreligion. Um sein Lampenfieber zu überwinden, wollte er „nicht etwa als einer der Schriftstellerzunft, sondern als ‚Achad Ha’am‘, als Einer aus dem Volk“, auftreten. Aus Odessa kommend, besuchte er erstmals 1881 Palästina und ließ sich 1922 endgültig im Land nieder, wo er bis zu seinem Tod blieb.