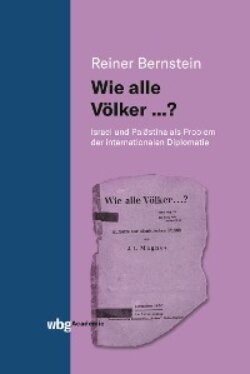Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Geniestreiche statt Hammerschläge
ОглавлениеNach der Zeremonie am 13. September 1993 vor dem Weißen Haus hatten sich die Hoffnungen auf Frieden überschlagen. Mit einem Geniestreich schienen die Epochen der Feindschaft samt ihren Ablagerungen bezwungen zu sein. Für Shimon Peres war die „Jagdsaison“ zu Ende, weil die „Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements“ eine „revolutionäre Wende in der Geschichte des Nahen Ostens“ verheiße und für alle Menschen erweiterte Horizonte eröffne: An die Stelle der Kriege um Territorien werde der Wettbewerb um den Einsatz neuer Technologien treten, denen Grenzen fremd seien. Vor der UN-Vollversammlung fügte Peres hinzu, nunmehr würden wirtschaftliche „Hammerschläge den Donner der Kanonen ersetzen“, und übertrug das Benelux-Modell auf die Levante. Die Opposition daheim tat er pathetisch als „Leute von gestern“ ab. Dass er ein Jahr zuvor einer künftigen palästinensischen Autonomie „eine höchst wichtige Dimension der Doppelgesichtigkeit“ zugemessen hatte, fiel kaum auf. Wenn John Kerry ihm und Yitzhak Rabin die Überzeugung eines palästinensischen Staates zugeschrieben hat, der für Israel Sicherheit bedeute, kann er sich nur auf persönliche Eindrücke berufen.
Rabins Vertrauter Uri Savir bekannte, dass er Zeuge und Teilnehmer „einer Serie von dramatischen Wendepunkten in der Geschichte des Nahen Ostens“ geworden sei. Für Abba Eban lief der Prozess „unweigerlich auf einen palästinensischen Staat“ zu, um „unsere unzweifelhaften historischen Rechte … in eine tragfähige Balance mit den Rechten anderer (zu) bringen und damit unserem eigenen Recht auf einen endgültigen Frieden“ den Pfad zu ebnen; 1968 hatte er den Palästinensern das Recht auf Selbstverwaltung abgesprochen. Die Soziologen und Politologen Barry Rubin, Joseph Ginat und Moshe Ma’oz stellten ihr Buch unter den Titel „Vom Krieg zum Frieden“. Der Jerusalemer Politologe Yehoshafat Harkabi (1921 – 1994) konstatierte einen erstaunlichen Umbruch („sea change“). Die israelische Rechte könne die Implementierung des „Friedensvertrages“ nicht verhindern, lautete die Prognose einer Aufsatzkollektion, welche die politische Überbewertung ausdrückte.
Doch Akiva Eldar konnte als „Haaretz“-Korresondent bei der Zeremonie am 13. September seine Tränen nicht unterdrücken, sein Kollege Gideon Levy glaubte an „Oslo“, weil er das Kleingedruckte nicht las. Für den Jerusalemer Politologen Shlomo Avineri hatte die Aussöhnung zwischen beiden Völkern einen „historischen Wendepunkt“ erreicht. Nach Auffassung seines US-amerikanischen Kollegen Bernard Reich, zwischen 1993 und 1997 Handelsminister, hatte sich „für immer und unwiderruflich das Wesen des arabisch-israelischen Konflikts verändert“. Nach Auffassung von Johan Jørgen Holst werde „das wahre Wunder“ die bisherigen Konstanten verändern. Der zu den „neuen Historikern“ zählende Avi Shlaim bescheinigte Rabin und Arafat, dass sie „die geopolitische Karte der gesamten Region neu gezogen“ hätten, um rückblickend zu ergänzen, dass „Oslo“ das einzig faire und vernünftige Angebot zur Teilung Palästinas gewesen sei. Ob Yoel Singer, aus seiner Washingtoner Kanzlei zurückgeholter Rechtsberater Rabins, mit seiner jüngsten Prognose recht behält, erscheint höchst fraglich: Komme ein Vertrag zustande, werde dieser sich an Oslo orientieren. Von einem palästinensischen Staat war dort nicht die Rede.
Uri Avnery glaubte, dass die Friedensbewegung beruhigt nach Hause gehen könne, um kurze Zeit hernach zu beklagen, dass sie sich „quasi zur Ruhe gesetzt“ habe. Doch die „Schwangerschaft“ werde „unweigerlich zu einer Geburt führen, der Geburt des Staates Palästina“. Für Avnery schien „immer klarer“, „dass die Israelis von Krieg und Besatzung genug hatten“, und „[g]anz egal, was die Fehler des Abkommens sind, die Dynamik des Friedens wird sie überholen“. 1995, nach der Interimsvereinbarung, äußerte er sich vorsichtiger: Sie sei voller Sätze, die mit „nicht später als …“ anfingen. Auch Savir bekannte im Nachgang, dass „Oslo“ den Palästinensern nichts anderes als eine „Schaufensterauslagen“ geliefert habe. Meron Benvenisti sah sich dementsprechend in seinem frühen Urteil vom „institutionellen Dualismus“ bestätigt.
Dennoch findet sich die Ausweisung „Oslos“ als Friedensvertrag bis heute in deutschen Leitmedien wieder, obwohl ein Friedensvertrag grundsätzlich nur zwischen Völkerrechtssubjekten geschlossen werden kann. Selbst die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini behauptete im Januar 2018, die Zwei-Staaten-Lösung sei in den Osloer Vereinbarungen verankert. Sechs Monaten später gestand die Europäische Union ein, dass ein Staat Palästina in weite Ferne gerückt sei. Wenn, wie Heinz Wagner, Ulrich K. Preuß und Dieter Grimm ausgeführt haben, Völkerrecht Staatenrecht meint und dieses der Inbegriff der Rechtsordnung ist, fehlt der PLO nach der Faktorenliste der Vereinten Nationen der Status eines aktiven Faktors in der Geschichte mit seinen vier Voraussetzungen:
a. einer effektiv arbeitenden Regierung, die einen unabhängigen Staat lenkt;
b. der vollständigen Kontrolle der dort lebenden Bevölkerung;
c. der souveränen Verfügung über ein durch Grenzen definiertes Territorium sowie
d. der Freiheit in der Gestaltung der internationalen Beziehungen.
Wenn Yoram Hazony ergänzt, dass ein Staat auf militärische und ökonomische Ressourcen zurückgreifen muss, um seiner Unabhängigkeit Gewicht zu verleihen, dann ist ein entmilitärisiertes Palästina der politisch-legalistischen Monopolstellung Israels ausgeliefert. Vor seinem Auftritt in der UN-Vollversammlung hat Netanjahu Ende September 2018 die Tonlage mit der Aussage weiter verschärft, dass Israel die Kontrolle westlich des Jordantals nicht aufgeben werde, womit aus behaupteten Sicherheitsbedürfnissen eine Rückkehr von palästinensischen Flüchtlingen außer Frage steht. Wann stellt sich Brüssel auf die Neuordnung seiner Politik ein, nachdem ihr Bekenntnis an den israelischen Widerständen gescheitert ist?