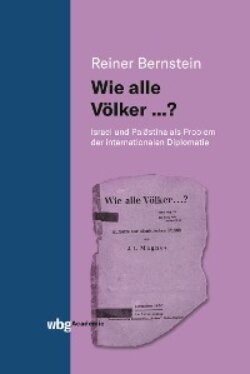Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auf dem Weg der Annäherung
ОглавлениеShmaryahu Levin (1867 – 1935), im weißrussischen Swislowitz geboren, verband das religiöse Judentum mit der nationaljüdischen Renaissance. Das Exil werde „die Funktion des Düngers für unseren historischen Boden verrichten“, meinte Jakob Klatzkin, und maß dem durch zaristische Gesetze von 1795 und 1835 eingerichteten Ansiedlungsrayon in Polen, Weißrussland und der Ukraine eine konstruktive Bedeutsamkeit im Sinne eines „nationalen Dienstes“ zu: „Wie mächtig wäre der Strom der Assimilation angeschwollen und verbreitet worden, wenn unsere Unterdrücker diesen Damm ihm [dem jüdischen Volk] aus dem Wege räumen wollten …“ Dabei fristeten in den westlichen Provinzen Rußlands nach den Beobachtungen Leon Pinskers „die dort zusammengepferchten Juden im schauerlichsten Pauperimus ein kümmerliches Dasein fristen“.
Von der zaristischen Bürokratie als „Kronrabbiner“ in Grodno und Jekaterinoslaw eingesetzt, hatte sich Levin von der Orthodoxie entfernt und repräsentierte das „Ostjudentum in seiner besten Form“, verschaffte sich aber durch sein Verständnis für die Westjuden unter auch ihnen großen Respekt (Richard Lichtheim). Nach dem Studium in Berlin und seinen Auftritten als glänzender Redner in den USA traf Levin 1924 in Palästina ein. Als einer der „großen Matadore des Zionismus“ (Chaim Weizmann) – für Golda Meir gehörte er zu den „Giganten der Bewegung“ – begründete er die Einwanderung in das Heilige Land mit der Befürchtung, dass infolge des wachsenden Gewichts der industriellen und kulturellen Modernisierung in Osteuropa „die besten jüdischen Köpfe … zu fremden Göttern und einer fremden Umwelt“ übergehen: Wie „hungrige Wölfe“ hätten sich die Juden auf die westliche Bildung gestürzt. Die russische Literatur stehe an erster Stelle, die russische Sprache sei in die oberen jüdischen Schichten tief eingedrungen, und die russischen Bücher hätten allmählich die hebräischen aus den Regalen verdrängt. Levin sah in der offenen Gesellschaft ein Desaster voraus: „Einst verkaufte Esau seine Seele für ein Gericht Linsen30, jetzt verkaufte Jakob seine Seele für Bürgerrechte. Es ist schwer einzusehen, was Jakob mit Esaus Erstgeburtsrecht gewann“. Nathan Birnbaum konstatierte „in der Ostjudenheit gewisse Verfallserscheinungen“, die auch unter den Frauen eine „Schwindsucht der jüdischen Religiosität“ auslösten. Der „Wall des Glaubens wird immer siebartiger, immer brüchiger, immer bröckliger“. Die Mehrzahl der Familien war bettelarm und deren Vater häufig ein „Luftmensch“ („Batlon“), „der von der Hand in den Mund lebte, ein kleiner Händler, Makler, Kommissionär, alles in einer Hand“ (Levin).
Gleichwohl wurden die reformerischen Erleichterungen des Zaren Alexander II. vielfach mit Beklemmung aufgenommen, auch wenn mancherorts die Hoffnung bestand, der Abschied vom Judentum werde den Antisemitismus entwaffnen. Manche Juden „fürchteten instinktmäßig“ – so noch einmal Levin –, „dass ein Riss in ihr Leben kommen könnte, dass die Freiheit, die sie unter Alexander dem Zweiten gewannen, geeigneter wäre, ihre spezifische eigene Welt zu zerstören“, als es die harten Erlasse seines Vaters Nikolaus I. – „ausgerottet soll sein Name und sein Andenken werden“ – waren: „Gewiß lebten wir in zwei verschiedenen Welten, aber es fiel uns nie ein, dass ihre Welt sicher stand, während die Grundpfeiler der unsrigen wackelten. Wir betrachteten im Gegenteil unsere Welt als die edlere, feinere und höhere.“ Weizmann erinnerte sich an seine als unbehaglich empfundene Studentenzeit in Berlin:
„In Pinsk [nahe seiner Geburtsstadt Motol] war es doch besser, obwohl Pinsk doch Rußland war und Rußland Zarismus, Beschränkung auf das Siedlungsgebiet, numerus clausus und Pogrome bedeutete. In Rußland hatten wir Juden wenigstens unsere eigene Kultur, und zwar eine sehr hohe, wir hatten Selbstachtung und dachten nicht im Traum daran, dass unser Judentum etwas sei, das abgestreift und verheimlicht werden müßte.“
Die „Gesellschaftsanzüge und Fräcke und die eleganten Abendkleider“, die „elegante und pseudo-weltmännische Note“, die „den offiziellen Zionismus“ in Berlin symbolisierten, waren ihm und seinen Studienkollegen zutiefst fremd. Im zaristischen Ansiedlungsrayon („Tscherta“ = Gebiet) lebten die Juden mit ihren Normen in ihrem eigenen Kosmos, homogen nach innen, heterogen nach außen, „eine gefrorene Masse“, die „unter den Strahlen der Aufklärung zu schmelzen begann“, wie Isaiah Berlin (1909 – 1927) den in Galizien geborenen britischen Historiker Lewis Namier (1888 – 1960) zitierte. Als Weizmann im Mai 1903 von seiner Tätigkeit an der Universität in Genf in die „Ferien heim nach Rußland“ fuhr, kam er zu dem bestürzenden Befund:
„Kinder revoltieren offen gegen ihre Eltern. Die Älteren sind in Tradition und orthodoxer Inflexibilität gefangen, die Jungen machen ihre ersten Schritte auf der Suche nach Freiheit von allem Jüdischen. In einem kleinen Ort bei Pinsk haben die Jungen die Thora-Rolle zerrissen. Das spricht Bände.“
Für Golda Meir gehörte Pinsk mit seiner jüdischen Mehrheit zu „den gefeiertsten Zentren des russisch-jüdischen Lebens“. Shlomo Avineri hat an ein Gerücht erinnert, wonach eine Gruppe junger Leute in einem Shtetl am „Yom Kippur“ eine Mahlzeit mit Schweinefleisch auf dem jüdischen Friedhof vorbereiten wollte. Dass polnische Juden der Entfremdung vom Judentum anheimfielen, ließ eine Mutter in Warschau an die Adresse ihres Sohnes ausrufen: „Ungläubiger! Feind des Judaismus!“, hat Isaac Bashevis Singer (1904 – 1991) berichtet.