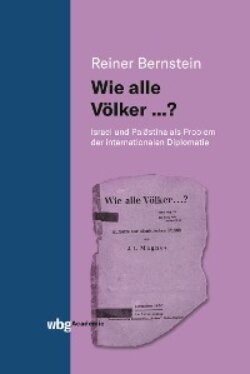Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel II
Einleitung
Оглавление„Keine Sorge, Dr. Wise, Palästina gehört Ihnen17.“
Nach seinem ersten Aufenthalt in Palästina 1891 ahnte Achad Ha’am für jene jungen Juden, die sich auf die Einwanderung vorbereiteten, „zahlreiche und schwierige Hindernisse“ voraus: „Wir im Ausland“ (sic), so sein Fazit auf der Rückreise nach Odessa, „pflegen zu glauben, dass Palästina heute ein fast ganz wüstes, unbebautes Ödland ist, und jeder, der dort Grund und Boden kaufen will, dies nach Herzenswunsch tun kann. Dem ist aber nicht so.“ Ähnlich äußerte sich der Lehrer Isaac Epstein18 auf dem VII. Zionistenkongress 1905 in Basel – dem „Sabbatkongress“ nach den Worten seines Präsidenten Max Nordau –, als er die „verborgene Frage“ aufwarf:
„Unter den schwierigen Fragen im Hinblick auf die Geburt unseres Volkes in seiner Heimat überwiegt alles eine Frage: unsere Relationen zu den Arabern. Diese Frage, an der die Lösung unserer nationalen Hoffnung hängt, ist von den Zionisten nicht vergessen worden, ist aber von ihnen vollkommen unbemerkt geblieben, in ihrer wahren Form ist sie kaum in der Literatur unserer Bewegung erwähnt worden.“
1881 erlebte Achad Ha’am schwerwiegende Bodenspekulationen, die der jüdischen Siedlung großen Schaden zufügen würden: „Knechte waren sie im Lande ihrer Verbannung, und plötzlich finden sie sich selbst in einer Freiheit ohne Grenzen, in einer ungezügelten Freiheit, wie sie sich nur in der Türkei finden läßt.“ Vierzehn Jahre später sangen in Basel die Delegierten aus Osteuropa „Wir heben die Händ‘ gen Misrach [Osten] …“. Der aus einer assimilierten Familie Odessas stammende Vladimir Zeev Jabotinsky (1880 - 1940), dem die biblischen Quellen fremd waren, beschwor die Versammelten, dem Aufruf „Politik ist Macht“ zu folgen19, bevor Nahum Sokolow (1859 – 1936) – zwischen 1905 und 1911 Generalsekretär der zionistischen Bewegung und seit 1921 Präsident mehrerer Kongresse – unter Verweis auf 1905 dem amerikanischen Botschafter in Konstantinopel Henry Morgenthau (1856 – 1946)20 das Interesse vortrug, die „nächsten Nachbarländer“ in die Kolonisationsarbeit einzubeziehen. Es dauerte nicht lange, bis Buber – „ein Mann gegen die Zeit“ (Hans-Christian Kirsch) – vor einem Zionismus der „unreflektierten Selbstverständlichkeit“ warnte, vor einem „horizontlosen Nationalismus“ zwischen den „natürlichen arabischen Rechten“ und den „historischen jüdischen Rechten“: Die Araber, „nicht wir, besitzen etwas, was man die palästinensische Form nennen darf. Die Lehmhütten der Fellachendörfer sind aus diesem Boden geschossen, die Häuser von Tel Awiw sind ihm aufgesteckt.“ 1925 erntete Weltsch heftige Reaktionen mit seinem Vorstoß, dass „diejenigen, die neu hinzukommen – und das sind in diesem Falle wir – mit dem ehrlichen und aufrichtigen Willen kommen [müssen], mit dem anderen Volk zusammen zu leben“. Seine „Jüdische Rundschau“ versuchte „für eine Politik der Verständigung und des Friedens einzutreten, was nur dann möglich war, wenn politisch das Ziel in einer Weise definiert wird, die sich mit den Interessen der palästinensisch-arabischen Bevölkerung vereinbaren lässt“, unterstrich er. Ähnlich besorgt hatte sich Nahum Goldmann (1895 – 1982) bei seinem ersten Besuch kurz vor dem Ersten Weltkrieg geäußert:
„Ich schreite durch die Weinberge und wende alle innere Energie auf, um das erhebende Bewusstsein, auf jüdischen Kolonieboden zu treten, in seiner ganzen Reinheit zu empfinden, und in mir raunt es wie die tückische Stimme eines grausamen Feindes: Aber die Araber haben es bearbeitet. Ich betrachte mit Entzücken die farbenstrahlende Blüte eines Orangenbaumes, und die Stimme murmelt: Araber haben ihn gepflanzt; ich schaue mit Stolz auf die starken, gut gezogenen Rebenstöcke, und die Stimme flüstert: Araber haben sie großgezogen.“
Felix Frankfurter (1882 – 1965), ab 1939 Richter am Obersten Gerichtshof der USA, räumte ein: „Wir, die wir das einfache orientalische Leben in seiner schönen Gestalt lieben, mögen entschuldigt sein, wenn wir mit einem Seufzer seine Pulverisierung unter den Rädern des Fortschritts sehen.“ Für Kurt Blumenfeld stellte „die Araberfrage unser politisches und menschliches Hauptproblem“ dar, dessen Klärung jedoch in weiter Ferne liege: „Je mehr mir das bewußt wurde, desto mehr beschwerte mich der Eindruck, dass in Wirklichkeit nicht nur Jahrhunderte an Entwicklung uns von den Arabern trennten, sondern daß auch die Entwicklungstendenzen der islamischen Welt unseren Versuchen der Europäisierung des Landes widersprachen.“
Behauptungen, der Fellache habe kein Interesse an der Politik, ließen sich nicht aufrechterhalten. Mit von Bedenken freien Selbstverständlichkeiten ließen sich die jüdischen Ankömmlinge in Palästina nieder – belästigt durch das „Schreien und Feilschen der arabischen Lastträger und Bootsleute“ im Hafen von Jaffa, während das benachbarte „Tel Aviv als eine normale, saubere Stadt mittlerer Größe nach europäischem Muster“ erschien, wie Shlomo Rülf im Februar 1933 nach seiner ersten Landung berichtete. Abraham Granovsky (1890 – 1962) schrieb im Vorwort seiner zwischen 1926 und 1929 entstandenen Aufsatzsammlung, dass „der Boden Erez Israels (…) erlöst und für ewige Zeiten jüdisch werden (muss)“. Solche Erwägungen nötigten Ernst Simon zu der Aufforderung, „mit der gefährlichen Parole ‚Erlösung des Bodens‘“ verantwortlich umzugehen, was ihm die Gegnerschaft „in den nationalistischen Kreisen“ eintrug.
Mit der Balfour-Deklaration vom 02. November 1917 und bestätigt durch den Völkerbund im April 1920 stieg das jüdische Volk, repräsentiert durch die zahlenmäßig kleine zionistische Bewegung, in den Rang eines Völkerrechtssubjekts auf, nachdem die Juden nach den Worten Ben-Gurions bis dahin außerhalb der Weltgeschichte gestanden und „kein eigenes Blatt in den Geschichtsbüchern“ geschrieben hatten, wie Weltsch vervollständigte. Für George Curzon (1859 – 1925), den ehemaligen Vizekönig von Indien zwischen 1899 und 1905 sowie Nachfolger von Arthur James Balfour (1848 – 1930) im Außenministerium, hatten die Juden nach dem Ende ihres nationalen Daseins in Palästina vor zwölfhundert Jahren keinen höheren Anspruch als die Briten auf Teile Frankreichs. Gleichwohl versicherte Präsident Woodrow Wilson (1856 – 1924) dem Gründer des Jüdischen Weltkongresses und erstem Präsidenten, dem in Budapest geborenen Stephen Wise21: „Don’t worry, Dr. Wise, Palestine is yours“. Seine Prophezeiung, dass der Erste Weltkrieg der letzte aller Kriege sein werde, erwies sich als haltlos. Ohne dass die USA dem Völkerbund beitraten, stimmten sie in einem gesonderten Abkommen mit Großbritannien dem Mandat zu. Aus Furcht, der jüdischen Einwanderung nichts entgegensetzen zu können, verwahrte sich Anfang Oktober 1919 Jerusalems Bürgermeister Musa Kazem Al-Husseini (1853 – 1934) „gegen jegliche Rechte für Juden“. Dieselbe Ablehnung kam von Auni Abd‘ Al-Hadi22, dem Berater des saudischen Prinzen Faisal23, der am 04. Juni 1919 mit Chaim Weizmann in Aqaba ein Schriftstück über eine mögliche arabisch-jüdische Zusammenarbeit unterzeichnet hatte.
Die Frage, ob Faisal für alle Araber sprechen konnte, erübrigt sich, weil ihre Gesellschaften hierarchisch gegliedert waren und keine demokratische Willensbildung kannten. Faisal wurde am 08. März 1920 in Damaskus zum König von Syrien (wozu Libanon und Palästina zählten) ausgerufen, musste aber schon am 27. Juli auf französischen Druck hin das Land in Richtung Bagdad verlassen. Am 11. Juli 1922 verabschiedete der britische Ministerrat eine Resolution, in der Faisal zum konstitutionellen Monarchen Iraks erklärt wurde.
Für den zionistischen Aufbau hatte der Ökonom und Jurist Arthur Ruppin24 – ein Mann von „eiserne(r) Selbstdisziplin“ und „ein Genie des Arbeitswillens“, der sich mit der hebräischen Sprache schwertat – Anfang 1908 von der zionistischen Exekutive unter ihrem Präsidenten David Wolffsohn (1855 – 1914) ein Büro in der nach einem syrischen Christen benannten Butros-Straße eingerichtet, in der „Einöde“ Jaffas, wie Richard Lichtheim (1885 bis 1963) befand; bei seinem ersten Besuch 1910 trug er einen Revolver bei sich. Ruppins „Palästina-Amt“ wurde Kopf und Herz der praktischen Arbeit. 1920 wurde die von ihm geleitete „Palestine Land Development Company“ (PLDP) in England als gemeinnützige Aktiengesellschaft anerkannt. Ein Jahr danach beauftragte er den gerade aus Frankfurt am Main eingewanderten Architekten Richard Kaufmann (1887 bis 1958) mit der Entwicklung des Jerusalemer Stadtteils Rechavia („Gottes Weite“).
Ruppin, der über seine Mutter mit den rabbinischen Überlieferungen vertraut war, bescheinigte Herzl die „absolute Unkenntnis der Verhältnisse“. Gemäß der Volkszählung vom Oktober 1922 lebten 757.182 Menschen in Palästina, von denen 83.794 Juden waren, 11 Prozent. Das eigentliche Problem sei der Mangel an Menschen gewesen, die für die kolonisatorische Arbeit in der Küstenebene, in Galiläa, im Negev und im Jordantal geeignet seien, ermittelte Lichtheim. Für Ruppin stand fest, dass die Deklaration des in Schottland geborenen britischen Außenministers Balfour „mit ihren papiernen Privilegien … für uns ein Fluch sein (wird), wenn wir glauben, daß durch sie für uns Rechte auf Palästina ‚begründet‘ sind“.
Für die in Milwaukee aufgewachsene Golda Mabovitch (verheiratete Meyerson) – „Wir sind Sozialisten, tolerant in der Tradition, aber keineswegs durch das Ritual gebunden“ – gab es von vornherein keinen Zweifel daran, dass spätestens nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches das jüdische Volk ein selbstverständliches Recht auf Palästina habe, wofür alle Juden gewonnen werden müssten. Keineswegs zufällig bezeichnete sie ihre ersten zionistischen Bekanntschaften, so den späteren zweiten Staatspräsidenten Yitzhak Ben-Zvi (1884 – 1963) und Ben-Gurion als Palästinenser: „Ich habe niemals zuvor Leute wie diese Palästinenser getroffen …“, und wenig erstaunlich deshalb ihr Ausruf Mitte Juni 1969 im Interview mit der Londoner „Sunday Times“, dass „es so etwas wie [andere] Palästinenser nicht gibt“.
„Kein anderes Volk außer den Juden war gewillt und imstande, mit der Kraft seiner Herzen und Hände und mit erheblichen Mitteln das unwirtliche Palästina in bewohntes Kulturland zu verwandelt“, urteilte Lichtheim selbstbewusst als Chef der zionistischen Vertretung in Konstantinopel. Die Juden wanderten „nicht aus negativen Gründen“ ein, betonte Ben-Gurion, der 1906 als Zwanzigjähriger gekommen war und das Pogrom im ukrainischen Kischinew, wo 49 Juden ermordet, 700 Häuser beschädigt und 600 Läden geplündert wurden, aus der Ferne erlebt hatte, „sondern mit dem positiven Vorsatz, unsere Heimat neu zu erbauen, ein Land zu besiedeln, in dem wir nicht auf ewig Fremde wie [in der Diaspora] sein müßten, sondern das durch unsere Mühe unwiderruflich das unsere werden würde“, mit „dem Spaten in der Hand“. Für Blumenfeld konnten für ein „freies Volk im jüdischen Land nur Männer schaffen, die grenzenlose Opfer zu bringen bereit sind“. Als sich im Sommer 1933 Walter Benjamin (1892 – 1940), der mit Gershom Scholem nach dessen Entlassung aus dem Militär drei Jahre in der Schweiz zusammengelebt hatte, nach Arbeits- und Lebensbedingungen in Palästina erkundigte, schrieb ihm Scholem aus Ibiza zurück: „Unsere Erfahrung ist, dass auf die Dauer hier nur der leben kann, der sich durch alle Problematik und Bedrücktheit hindurch mit dem Lande und der Sache des Judentums völlig verbunden fühlt.“ Vor dem Ersten Weltkrieg hatten viele Juden aufgrund der armseligen Lebensbedingungen das Land wieder verlassen. Idealismus reichte nicht aus.
Hatten sich die arabischen Anfeindungen zunächst hauptsächlich auf die obere Mittelschicht beschränkt, so wurde sie seit dem Ausbruch des Aufstandes im April 1936 – bis 1939 kamen in den Kämpfen fast 3.000 Araber, 329 Juden und 135 Briten ums Leben – von großen Teilen der Öffentlichkeit mitgetragen. Mit der Rebellion kehrte die Aufmerksamkeit ins arabische Umland ein. 1938 dachte Amin Al-Husseini (1895 – 1974), der am 12. April 1921 von einem islamischen Gremium gegen etliche Widerstände, die seine theologischen Qualifikationen in Zweifel zogen, gewählte und dann von den Briten bestätigte Großmufti („Al-Mufti Al-Akbar“) von Jerusalem, an das Zugeständnis eines kleinen jüdischen Staates ohne Haifa und Galiläa – in Obergaliläa hatte Metullah (gegründet 1896) im Ersten Weltkrieg die jüdische Grenzsiedlung zum Libanon gebildet. Ben-Gurion zeigte sich wenig interessiert: Die wirtschaftliche Entwicklung des jüdischen Sektors war weit fortgeschritten. Hatte der Gründungskonferenz der „Achdut Ha’avoda“ („Arbeiterpartei [im Lande Israel]“) 1919 in Petach Tiqva erstmals „internationale Garantien für die Errichtung eines freien Judenstaates in Palästina“ verlangt, womit Ben-Gurion einen friedlichen Ausgleich mit der arabischen Bevölkerung ausschloss, weil noch kein Volk in der Geschichte freiwillig sein Land hergegeben habe, glaubte er fünf Jahre später an eine Verständigung: „Söhne sind wir, die jüdischen und arabischen Arbeiter, des einen Landes, und unser Lebensweg ist auf immer gemeinsam.“ Je stärker sich das Gewicht des „Yishuv“ entwickelte, desto häufiger war die Auffassung vertreten, dass die Araber vom jüdischen Aufbau profitieren würden.
Im September 1921 empfahl der XII. Zionistenkongress in Karlsbad die Vereinigung der „zwei semitischen Völker seit alters her“. Mit „Genugtuung“ nahm er allerdings auch „zur Kenntnis“, dass „das Ostjordanland, welches das jüdische Volk stets als integralen Teil Erez Israels betrachtete, in das Mandatsgebiet eingeschlossen werden soll“. Tatsächlich hatte Balfour die Zustimmung des am stärksten imperial ausgerichteten Kabinetts in der britischen Geschichte unter Führung von David Lloyd George (1863 – 1945) nur dadurch erhalten, dass er die zionistischen Territorialforderungen eingrenzte.
Genau ein Jahr später veränderte Kolonialminister Winston Churchill (1874 – 1965) das prekäre Palästina-Mandat in seinem Weißbuch zu zionistischem Ungunsten dahingehend, dass er die Aufnahmefähigkeit des Landes an die „ökonomische Kapazität“ zu binden gedachte und darauf beharrte, dass London nicht beabsichtige, ganz Palästina in ein jüdisches Nationalheim umzuwandeln. Nichtsdestoweniger insistierte Jabotinsky darauf, dass die palästinensische Frage im Sinne eines größeren Palästinas gelöst werden müsse. Damals gehörten auch rund 8.000 Hektar östlich entlang der Demarkationslinie zwischen Syrien und Palästina – darunter der Unterbezirk Dera’a mit damals 10.000 Einwohner zählenden Stadt, wo im März 2011 der Volksaufstand gegen Bashar Al-Assads Regime begann – der „Palestine Jewish Colonization Association“ (PICA).