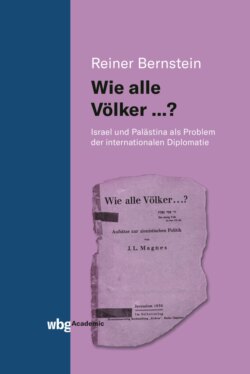Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 20
Deus vult – Gott will es
ОглавлениеIsaac Breuer (1883 – 1946), Enkel des neoorthodoxen Rabbiners Samson Raphael Hirsch (1808 – 1888), der sich, aus Frankfurt am Main kommend, 1936 als Rechtsanwalt in Jerusalem niederließ und an der Gründung der orthodoxen Partei „Agudat Israel“ („Gemeinde Israels“) beteiligt war, verwahrte sich gegen einen weltoffenen Zionismus mit dem Passus „Lässt man die Religion beiseite, so wird die vieltausendjährige Geschichte der jüdischen Nation sinnlos und die nationale Einheit gedeiht zum leeren Schemen“. Der „Zwitterzustand der Assimilation“ bekräftigte ein jüdischer Lehrer aus Österreich, führe
„für das Gesamtjudentum zur Erweichung der starken, tragenden sittlichen Mächte: es schwindet die Pflege der religiösen und nationalen Überlieferungen in den Familien dahin, mit der Sprache der Väter gerät das reiche jüdische Schrifttum in Vergessenheit, kurz, es bahnt sich unerbittlich eine Auflösung der Volkskultur, eine Entjudung des jüdischen Geistes an, deren Kehrseite die allmähliche Aufsaugung der Juden durch die Völkerwelt mittels Assimilation, Mischehe und Taufe sein muss“.
Für den in Kaunas geborenen Philosophen Emmanuel Levinas (1906 – 1995) waren „Verfehlungen gegenüber dem [jüdischen] Nächsten ipso facto Affronts gegen Gott“. Dagegen vertrat der Historiker David Myers, Leiter des international besetzten Vorstandes des liberalen „New Israel Fund“ (NIF), die Auffassung, dass ohne die „Assimilation“ – die Übernahme von Normen und Gewohnheiten der Umwelt – die aschkenasischen Juden in der Geschichte „versteinert“ wären. Sammy Gronemann (1875 – 1952), Rechtsanwalt, Zionist, Schriftsteller und Satiriker, wiederum zitierte einen „Talmud“ lernenden Mann in Berlin, den das unziemliche Benehmen seiner jüdischen Mitbewohner verdrießte: „Es gibt nur eins: Die Juden müssen zurück ins Ghetto! … Ich pfeife auf die ganze Emanzipation! … Im Ghetto hat der Jude gelebt, wie ein Mensch lebt. Ich weiß: er hat wie ein armer, elender hungriger Mensch gelebt und ständig für sein bißchen Leben gezittert! Aber er hat nicht sein ganzes Leben Komödie spielen müssen, bis er selbst nicht mehr weiß, was sein wahres Gesicht ist und was seine Maske.“ Doch hatte der Zionismus nach der russischen Revolution und der Aufhebung des Rayons noch einen vernünftigen Zweck?, lautete 1918 gefragt. Zumal dem rapiden Verelendungsprozess des jüdischen Mittelstandes aus Polen, der die vierte Einwanderungswelle in Gang setzte, in Palästina eine veritable Wirtschaftskrise folgte.
Dem Zionismus mussten die Seifenblasen äußerer Abhängigkeiten erspart werden. Deshalb hatte sich die zionistische Leitung früh gegen die Spendenpraxis besonders des Pariser Baron Edmond James de Rothschild (1845 – 1934) gewandt und an die Stelle der Unterordnung unter die „Chalukka“ („Verteilung“) den Aufbau des Landes aus eigenem Vermögen propagiert. Nahum Goldmann befand nach seinem Besuch 1914 in der Kolonie Rishon Le-Zion über deren frühe Verwalter: „Nirgends haben diese so sehr ihr Wesen getrieben als in Rischon (und in Sichron-Jakob)31. Es ergreift einen noch heute ein Zittern der Empörung, wenn man aus dem Munde mancher Kolonisten von den Willkürlichkeiten und Freveltaten dieser demoralisierten Sprößlinge Pariser Boulevardkultur hört.“
Die „tote Hand“ lag auf mehr als der Hälfte der jüdischen Bevölkerung in Palästina, allein in Jerusalem sollen rund zwei Drittel von Zuwendungen gelebt haben. Achad Ha’am notierte 1883, dass die Unterstützung des Barons der Kolonisation „Fäulnis, Schliche und Hinterhältigkeiten, Verschwendung, Schwinden des Ehrgefühls und noch andere ähnliche Eigenschaften fördere“. Levin bezeichnete die Repräsentanten der „Chalukka“ als die „erbittertsten und aktivsten unserer Feinde“, weil sie Palästina zu einem „Siechenhaus“ gemacht hätten. In seinem Roman „Tohuwabohu“, 1925 schon in 16. Auflage erschienen, hat Gronemann eine Schmarotzer-Szene aus der Kaiserzeit geschildert, in der zwei junge Zionisten in einer Berliner Kneipe abgewiesen werden, als sie den Wirt um die Zahlung eines „Shekel“ – der Silbermünze aus biblischer Zeit, die von der zionistischen Leitung als Mitgliedsbeitrag erhoben wurde – zugunsten der jüdischen Heimstätte in Palästina bitten und sich gegen den Vorwurf des Schnorrens wehren: Das „könnte den Reichen so passen“, wird ihnen vorgeworfen, „die Schnorrer abschaffen! Auf Wohltätigkeit beruht die Welt.“ In Plonsk, dem Geburtsort Ben-Gurions, gingen Frühzionisten „mit Pistolen zu reichen Leuten, betraten das Haus, legten die Pistole auf den Tisch, und begannen, über Geld zu sprechen“, ist Ben-Gurion von Tom Segev zitiert worden. Golda Meyerson verlangte 1933 nach Vorwürfen aus dem Lager des Arbeiterzionismus, dass das Geld für den Aufbau des Landes sehr wohl auch von „bürgerlich-kapitalistischen Juden“ kommen müsse.
„Bis zum neunzehnten Jahrhundert waren die Juden niemals an der Geschichte qua Geschichte interessiert“, hat Amos Funkenstein für die aschkenasischen Länder ausgeführt. Das habe sie „einzigartig unter den Völkern der Welt“ gemacht, „in ihrem Unterschieden-Sein von anderen“. Die Begründung dieser Ausnahmestellung durch das Verstehen der Geschichte sei das Hauptthema gewesen. Im Zeitalter der „Haskala“ und des Nationalstaatsgedankens – der „Universalität des Judentums“ (Funkenstein) – durfte die Verpflichtung auf Gottes Wort nicht länger dem passiven Anbruch der messianischen Zeit überlassen bleiben. Für Shmuel Hugo Bergmann (1883 – 1975)32, einen der engsten Freunde Bubers, ging es fortan um die Überwindung eines „abstrakten Judentums“. Zionistische Klassiker befürworteten deshalb die Abkehr von den drei talmudischen Eiden
– einer, dass Israel nicht geschlossen heraufziehe [d.h. Verbot der Masseneinwanderung vor Anbruch der messianischen Zeit],
– einer, dass der Heilige, gepriesen sei Er, Israel beschwor, sich nicht wider die weltlichen Völker aufzulehnen [d.h. sie nicht zu reizen], ihrer Obrigkeit Folge zu leisten, sich also der Macht zu beugen, und im Gegenzug,
– einer, dass der Heilige, gepriesen sei Er, die weltlichen Völker beschwor, Israel nicht übermäßig zu knechten33.
Noch der als talmudische Autorität gerühmte und durch seinen politischen Instinkt bewunderte ultraorthodoxe Rabbiner Eliezer Schach (1899 – 2001) vertrat die Grundüberzeugung, dass der Staat Israel nicht die Völker herausfordern solle, weil das jüdische Volk wie ein Lamm unter siebzig Wölfen sei. Die nach außen als nicht religiös auftretende Arbeitspartei verdammte er 1990 als „Partei von Schweinen und Kaninchen-Fressern“. Doch die utopische Metaphysik sollte eine realpolitische Chance erhalten. Der in Weißrussland gebürtige Exponent der „Haskala“ und Redakteur der Zeitschrift „Ha-Sháchar“ („Die Morgenröte“) Peretz Smolenskin (1842 – 1885) zitierte zur Begründung Palästinas als das „unverrückbare Ziel“ die im Buch Samuel 8,19-20 aufgezeichnete Revolte gegen Gott: „Nein, ein König soll über uns herrschen. Auch wir wollen wie alle anderen Völker sein. Unser König soll uns Recht sprechen, er soll vor uns herziehen und unsere Kriege führen“, und wies Gott in Abkehr vom rabbinischen Judentum einen Platz im Himmel zu:
„Du bist ewig, Du kannst warten. Denn tausend Jahre sind vor Dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Unsere Geduld ist aber zu Ende. Vergib Deinen Kindern also, wenn sie das Nahen des Tages beschleunigen.“
„So leben wir seit achtzehn Jahrhundeten in Schmach – und nicht ein einziger ernstlicher Versuch, sie abzuschütteln“, klagte Leon Pinsker. Entweder sollte sich das Volk „den Messias selbst verdienen“ (Nathan Birnbaum), oder die messianischen Wurzeln der Vergangenheit sollten einem säkularen Pseudo-Messianismus den Platz räumen: Wenn Gott nicht die Juden, sondern die Juden Gott erwählt haben, können sie Ihm ihren Willen aufzwingen. Spekulative Vorstellungswelten würden durch die Bejahung der substantiell-empirischen Geschichte mit dem Ziel menschlich-autonomen Handelns überwunden. Nahum Goldmann ging so weit, dem Zionismus „gewissermaßen eine Entstellung jüdischer Geschichte“ zu dekretieren. Während die Generation von Berl Katznelson (1897 bis 1944) die Zurückweisung der Diaspora die Rettung des jüdischen Volkes aus dem Exil bedeutete, habe sie für die in Palästina aufgewachsene Jugend den Abbruch der Verbindung zum jüdischen Volk und zur jüdischen Geschichte bedeutet, hat Anita Shapira ausgeführt, bis ihn die Opfer der „Shoah“ eines Besseren belehrten. Denn der Dichter David Shimoni (1886 – 1956) forderte die junge Generation auf: „Höre nicht, mein Sohn, auf die Moralpredigt der Väter“, der Jude habe für die Vereinigung von Geist und Materie im Land Israel selbst zu sorgen. Aharon David Gordon, seit 1904 in Palästina und 1910 Mitbegründer der Siedlung Degania am südwestlichen Ausgang des Sees Genezareth, griff auf talmudische Disputationen zurück, die ihm einen theoretischen Zionismus ebenso fremd erscheinen ließen wie einen ethischen Universalismus. Für ihn ging es um die „Religion der Arbeit“:
„Unsere Religion ist nicht wie die Religion der europäischen Völker, von fremdem Ursprung, sondern ist die Schöpfung unseres nationalen Geistes. Unsere Religion durchdringt unseren nationalen Geist, und unser nationaler Geist findet sich in jedem Teil unserer Religion.“
Beim allmählichen Herabsteigen der Wohnstätte Gottes („Shᵉchiná“) zu Israel und zu seinen heiligen Stätten eröffne sich der Erlösungsprozess für die ganze Welt; die Anklänge an Abraham Isaac Kook sind offenkundig. Für Shmuel Feiner von der „Bar Ilan“-Universität isoliert die Religion die Juden zwar von ihrer Umwelt, doch sei sie „ihr einziger Trost und Halt“ und beherrsche „ihr Seelenleben ebenso wie ihre Erfahrungswelt“. Doch war für den durch seine Arbeiten über die Juden im Mittelalter hervorgetretenen Jizchak Fritz Baer die Antwort eindeutig: Er knüpfte den Erlösungsprozess an Vorbedingungen. Die göttliche Gegenwart sei vom Gehorsam des „entstellten Volkskörper(s)“ abhängig.
Israels dritter Staatspräsident Shneúr Zalman Shazar (1889 – 1974), mit dem Scholem nach seinem Rauswurf aus dem elterlichen Haus in Berlin 1917 zusammenwohnte, stimmte gemeinsam mit Zalman Abramov der Antwort Yaacov Herzogs34 zu: Der Staat Israel ist ein Paradox. In diesem argumentativen Kontinuum berief er sich auf „die zeitlose Identität des Juden über die Generationen hinweg“ und erhob Bileam, den „Weissager“ (Scholem), zum Titel seines Buches „A People that Dwells Alone“: die Zurückweisung der Behauptung, dass die Deutung des Judentums in die weltumspannende Geschichte eingebunden gehöre – eine These, der auch der Historiker Ben-Zion Dinur (1898 – 1973) durch Verweise auf die „historische Einzigartigkeit“ des jüdischen Volkes nachging. In Herzog, den Berater Ben-Gurions, Levi Eshkols (1895 – 1969) und Golda Meirs, erkannten Beobachter „einen Neo-Propheten mit der gütigen Majestät des Denkens“ und einen „moralisch höchst eindrucksvollen Menschen“. Für Isaiah Berlin verkörperte Herzog den „Geist des Judentums in seiner höchst realen historischen Verkörperung“, ein Patriot ohne ein vorbehaltsloser Nationalist zu sein, dessen Staat „in Freiheit und Unabhängigkeit zur Familie der Nationen“ gehöre, indem er seine „Kenntnis der Thora und der Weisheit der Welt“ rühmte. Der Staat Israel bedeutete ihm mehr als alles andere. Seinen Einsatz gegen die Internationalisierung Jerusalems nach dem UN-Teilungsplan begründete er mit dem Psalmisten „Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und fest gefügt. Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Israel geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen35“.