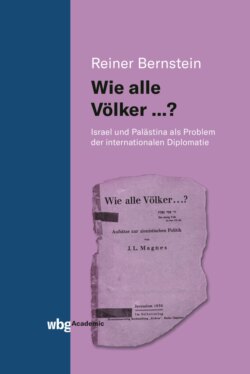Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwischen „jüdischem Grundrecht“ und „Subaru-Syndrome“
ОглавлениеFür die sich zur Friedensszene rechnende Publizistin Janet Aviad ist die ideologische Konversion zu einem „beständigen, dramatischen und machtvollen Beispiel des Widerstandes“ mit dem Ziel der „Ent-Israelisierung“ (Gershon Shaked) geworden, wobei sich strenggläubige Juden aller öffentlichen Dienstleistungen bedienen. In Anlehnung an die japanische Automarke konstatierte Yossi Melman ein „Subaru syndrome“, Gershom Scholem (1897 – 1982) beklagte die „technologische Assimilation“: Die orthodoxe Geschlossenheit im zaristischen Shtetl, der sich orientalische Juden im Habitus angeschlossen haben, soll unter Begleitung von Start-Ups und Hochtechnologie an die Stelle des religiös vielfältigen Bekenntnisses treten und der „Ent-Judung“ Paroli bieten. Bis in die staatlichen Apparate hinein ist ein „System der Unangreifbarkeit“ (Carolina Landsmann), der „Hegemonie“ (Anshel Pfeffer), der „Tyrannei“ (Chemi Shalev) und der „erbärmlichen Kapitulation“ Netanjahus (Eric H. Yoffie) zur Wahrung des religiösen Vetorechts im öffentlichen Leben entstanden – eine Leistung, die von liberaler Seite hilflos als „clown show“ und „exzentrisch“ gerügt wurde.
Es reichte 1995 aus, dass Yitzhak Rabin (1922 – 1995) das Militär in der Westbank teilweise umzugruppieren beabsichtigte, um den Palästinensern mehr Bewegungsfreiheit zu geben, für sein Todesurteil. Einen Staat Palästina lehnte er ab. 1977 verneinte ein Teilnehmer die Symmetrie zwischen der dreitausend Jahre alten Geschichte des jüdischen Volkes im Lande Israel und einer palästinensischen Nationalität, die „vielleicht fünfzig Jahre alt“ sei und eine künstliche Kreation darstelle. Das „palästinensische nationale Problem“ dürfe nicht auf Kosten des jüdischen Heimatlandes einschließlich Judäas und Samarias gelöst werden: „Warum haben wir das Recht, in Lydda, in Lod, in Ramle, in Ashdod und in Akko zu leben, wenn uns Jericho und Hebron vorenthalten werden?“ Wenn Nazareth und Galiläa 1948 annektiert worden seien, müsse Nablus folgen: „Judäa und Samaria sind hier“ („Yésha ẓe kan“). Mit Begriffen und Themen wie Terror, jüdischer Staat, Existenzrecht, Patriotismus, Loyalität sowie Judäa und Samaria haben sich Deutungsmuster als neue politisch-ideologische Wirklichkeiten über die Parteigrenzen hinweg durchgesetzt.
Der landesgeschichtlichen, theologischen und literarischen Durcharbeitung der jüdischen Geschichte in Palästina seit dreitausend Jahren sowie deren Interpretationen in zahllosen Forschungsarbeiten hat der arabisch-muslimische Kosmos wenig entgegenzusetzen, auch wenn im Koran die biblischen Namen ohne ihre religiöse Würdigung Abraham, Moses, David, Jakob, Josef und sogar Noah vorkommen 16. Wenn Aleida und Jan Assmann auf die Genese und die Kontinuität der kulturellen Erinnerung durch die Prinzipien der Auswahl und ihrer Nachdrücklichkeit mittels Texten, Bildern und Riten verweisen, „die unser Zeit- und Geschichtsbewusstsein, unsere Selbst- und Weltbildung prägen“, dann haben die Palästinenser schlechte Karten. So wird Jerusalem in der Bibel über achthundert Mal genannt, im Koran gar nicht; in der frühen islamischen Literatur kommt die Stadt unter dem römischen Spottnamen „Aelia Capitulina“ vor – nach der jüdischen Niederlage im Bar-Kochba-Aufstand von 132 bis 135 n.d.Z. Magnes glaubte, dass dem ganzen Land und besonders Jerusalem durch die jüdische Aufbauarbeit die Heiligkeit zurückgegeben werde. Zwar ließ sich die Klage des Philosophen und ehemaligen Rektors der „Al-Quds“-Universität Sari Nusseibeh nachvollziehen: „Aufgrund der Okkupation kümmern wir uns nur um uns selbst, die Welt interessiert uns nicht“. Dass aber die Palästinenser „ein Spiegel der Juden“ seien“, war weit hergeholt. Denn beide „Ideo-Theologien“ (Clive Jones) unterscheiden sich fundamental in der Kraft ihres Durchsetzungsvermögens.