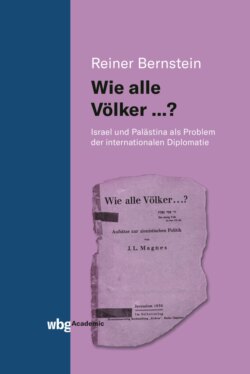Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Ganze Juden“ statt „Bindestrich-Juden“
ОглавлениеDer in der Nähe Wilnas geborene Frühzionist Elchanan Leib Lewinsky (1857 – 1910) war davon überzeugt, dass die Juden in der „Galuth“ nur zu einem Drittel oder einem Viertel Juden sein könnten. Allein in Palästina könnten sie zu ganzen Juden und die abtrünnigen Teile für das Judentum zurückgewonnen werden. In Achad Ha’ams Zeitschrift „Ha-Shilóach“ („Der Sendbote“) polemisierte er gegen Klassiker wie Scholem Aleichem (1859 – 1916) und dessen jiddische Literatur, bis er selbst das Jiddische benutzte, um den Leserkreis seiner feuilletonistischen Beiträge zu erweitern.
So wie Jakob Klatzkin 1921 behauptet hatte: „Wir lebten als religiöse Gemeinschaft im Einen Gott und können nunmehr nur in einem Vaterlande und in einer Sprache wahrhafte und ganze Juden sein“, geißelte Jonathan Sacks ein doppeltes Bewusstsein: ein „Bindestrich-Judentum“ – jüdischer Israeli, jüdischer Amerikaner, orthodoxer Jude – gegenüber dem „Volljudentum“, damit die Schlüsselworte „Thora“, Gebote, Exil, Erlösung, Volk Israel und Land Israel erhalten bleiben. Von „binationalen, bi-traditionalen Wesen, die wir jüdische Schriftsteller europäischer Sprache nennen“, denen der in Wien gebürtige Literaturwissenschaftler Gershon Shaked (1929 – 2006) eine Tiefenstruktur jüdischen Bewusstseins zuschrieb, wollte Sacks nichts wissen. Der gläubige Jude sei der vollständige Jude, befand auch Buber: „Das Streben nach Einheit ist es, was den Juden schöpferisch gemacht hat.“ Unter Verweis auf eine rabbinische Prophezeiung verlangte Sacks „Beachtet die Gesetze des Landes, in denen ihr lebt“, damit ihr euch nicht den Hals umdreht36. Für Zygmunt Bauman war der assimilierte Jude ein Widerspruch in sich. Indem die Juden „endlich zur Welt zugelassen worden“ seien, leisteten sie ihrer Entjudaisierung Vorschub. Beim besten Willen könne der Jude in der Diaspora nicht „ausschließlich Jude sein, ja, tatsächlich kann er nur sehr wenig Jude sein“, so dass ohne Israel „kein schöpferisches jüdisches Leben denkbar ist“, übertrug Ben-Gurion diese Behauptung in den Zionismus: „Selbst der observante Jude lebt also die meiste Zeit wie ein Nichtjude“, bis die „gekünstelte Unbefangenheit, die nervöse Gespanntheit“ vollständig nach der Einwanderung verschwinden, ob religiös oder nicht. Scholem maß die „Vitalität des israelischen Unternehmens“ der „außerordentlich hohe(n) historische(n) Temperatur“ zu. Der Jude könne in der heutigen Gesellschaft nur dann als Jude überleben, wenn er von der Ewigkeit seines Schicksals berührt werde. Konnte sich der Staat denn auf einen Charakter einlassen, der religiösen Grundüberzeugungen widersprach? Wer sich als Jude ausgebe, aber auf die israelische Staatsbürgerschaft verzichte, müsse der Tatsache ins Auge blicken, dass er kein voller Jude sein wolle, schloss sich Isaiah Berlin an, ohne daraus persönliche Konsequenzen zu ziehen, der sich auch Sacks entzog:
„Die Zukunft der Juden liegt im Staat Israel, und dort allein: Der Wert der Diaspora besteht deshalb allein im Ausmaß der Unterstützung, die sie dem neuen Staat anbieten, während sie sich noch vielen Gefahren gegenübersehen. Solange die jüdischen Gemeinschaften außerhalb Israels für diese Unterstützung sorgen können, haben sie eine raison d’être.“
Der Rabbiner Meir Berlin (1880 – 1949) ging so weit, Juden außerhalb Israels „eine Art Rassenverrat“ vorzuwerfen. Yaacov Herzog nannte den französischen Philosophen und Soziologen Raymond Aron (1905 – 1983), dem er kurz vor dem Junikrieg begegnet war, einen „border-line Jew“ und Träger einer „spirituellen Schizophrenie“. Jakob Klatzkin weigerte sich, „die sogenannte jüdischnationale Literatur der Neuzeit, insofern sie in fremden Sprachen niedergelegt ist, (…) als jüdisches Schrifttum“ zu bezeichnen. Sie zerfalle und verteile „sich in ihrer literarischen Zugehörigkeit auf ihre verschiedenen Sprachbezirke. Es ist bestenfalls übersetztes Judentum, ein Zweiseelenjudentum, voller Widersprüche und Konflikte, voller Risse und Wunden“. Für ihn konnte „eine fremde Form … nie durch einen jüdischen Inhalt jüdisch werden“.
„(W)enn wir sehen, daß einer unserer Volksgenossen durch seine Werke auf dem Kulturgebiet eines fremden Volkes sich einen Namen macht, so erfüllt uns das mit Stolz und Freude und wir beeilen uns, überall auszuposauen, daß der Bertreffende zu uns gehört, obwohl er selbst ängstlich bemüht ist, diese Verwandtschaft zu vergessen und vergessen zu machen“,
notierte Achad Ha’am bissig. Ein humanistisches Judentum, das sich zur Verantwortung gegenüber den Menschen gleich welcher Volkszugehörigkeit und Glaubensgemeinschaft mitverantwortlich fühlt, scheint aus der Zeit gefallen zu sein. Der aus dem rabbinisch-normativen Rationalismus Litauens hervorgegangene Neurophysiologe Yeshayahu Leibowitz (1903 – 1994), der „einsame Wolf der Orthodoxie“ (Zvi Ra’anan) entdeckte an den Werken von Nobelpreisträgern, Gelehrten, Schriftstellern und Künstlern nichts Jüdisches, solange sie sich über die „Halacha“ mit ihren Geboten als Urgrund jüdischer Kreativität hinwegsetzen und sich einer diffusen Weltoffenheit öffnen würden – der Verweis auf ihre jüdische Herkunft blieb ihm fremd, weil er zwischen Juden und jüdisch unterschied; Bubers dialogische Prinzipien tat er als eine Philosophie „für Damen“ ab. Seit seiner Kindheit in Riga verzichte Leibowitz auf die Frage, wie sich Gott zu den Menschen verhalte, sondern sei daran interessiert, wie sich der Mensch zu Gott verhalte. Viele zehntausend Trauernde begleiteten ihn 1994 auf seinem letzten Weg in Jerusalem.
Aus Verzweiflung über die „Shoah“ folgte ihm der zur Neo-Orthodoxie übergewechselte Emil Fackenheim (1916 – 2003), indem er in Distanzierung von den Humanwissenschaften den Juden ein 614. Gebot als „gebietende Stimme“ verordnete: Nach Hitler seien sie verpflichtet, endlich als Juden zu leben, statt der pseudo-aufklärerischen Moderne hinterherzulaufen. Kein Jude dürfe es mehr wagen, dem Gott der jüdischen Geschichte zu widersprechen. Damit näherte sich Fackenheim Behauptungen, die „nichtjüdischen“ Opfern des Holocaust die vollständige oder teilweise Abwendung von den 613 Geboten vorwarfen – mit anderen Worten: Gott hat den Holocaust gewollt und auch observante Juden in den Tod gerissen hätten, weil sie bei der Binnenmission versagten. Die Essayistin und Poetin Margarete Susman (1872 – 1966) drohte an der „Frage nach dem verborgenen Gott…, der auf die Fragen der Kreatur keine Antwort gibt“, zu verzagen, hielt aber dem „Urgeheimnis“ die Treue, es habe dem Volk die innere und äußere Gestalt gegeben, zwar tief verhüllt, doch immer wieder hindurchscheinend.
Nicht die Juden haben das Judentum erhalten, sondern das Judentum die Juden, befand 1906 Moritz Güdemann: „Geschichtlich ist die Religion der einzige Beruf des Volkes Israel gewesen, in ihr liegt der Zweck seines Daseins, was die Bibel unablässig dem Volke zu Gemüte führt“. Da im Staat Israel viele die Gebote Gottes von sich weisen, distanzierte sich der an der Universität Be‘ersheva tätige Gesellschaftswissenschaftler David Ohana von „jedem säkularen Juden in Tel Aviv, der sich die ganze Zeit in den Einkaufsstraßen herumtreibt und mit dummen Talkshows im Fernsehen seine Zeit verbringt“. Gideon Levy bekannte sich zu dem „falschen Säkularismus Tel Avivs“. Auch für Ohana lautete die Frage: Was mache für euch das Judentum aus? Dass ihr Hebräisch sprecht? Das tun auch die arabischen Staatsbürger.
„Man traktiert das Judentum mit Fußtritten oder mit Gleichgültigkeit“, glaubte Scholem Mitte der 1970er Jahre. Denn wer sich vom Studium der „Thora“ entferne, war nach Auffassung von Innenminister Arye Der‘i, dem Vorsitzenden der „Sefardischen Thorawächter“, zur Beantwortung der Frage verpflichtet, ob er noch zum jüdischen Volk gehöre. Für Moshe Gafni, den Vorsitzenden der Partei „United Thora Judaism“ und Leiter des Finanzausschusses der Knesset, sind die konservativen und Reformjuden „der schwerste Schlag für das jüdische Volk“. Er sei bereit, mit den schlimmsten Feinden Israels zusammenzusitzen und zu reden, nicht jedoch mit ihnen. Golda Meir soll jeden Juden, der eine „Mischehe“ eingehe, zu den späten Opfern des Holocaust gezählt haben. Dov Lior, Rabbiner in Kiryat Arba37, forderte die unter seiner Kontrolle stehenden Synagogen auf, Gebete für die Regierung einzustellen, und erklärte, dass die Befruchtung der jüdischen Frau durch nicht-jüdische Spermen zu genetischen Abnormitäten führe38.
Lässt sich die Entwertung der universellen Humanitas auf die Erfahrungen des Holocaust reduzieren? Die „Shoah“ sei die Linsen, durch die in Israel die Welt gesehen werde, behauptete Reuven Rivlin, womit der Präsident als „säkular-orthodox“ die israelische Doppelidentität aus „Religion und Holocaust-Erinnerung“ beschrieb. Dem Wissenschaftstheoretiker und AuschwitzÜberlebenden Yehuda Elkana (1934 – 2012) hingegen war es zutiefst zuwider, die Erinnerungskultur als aktiven Anteil in den politischen Betrieb einzubringen. Dazu gehört der regelmäßige Besuch deutscher Staatsleute in der Gedenkstätte „Yad va-Shem39“ vor Beginn der politischen Gespräche.
29 So der in Halberstadt geborene Historiker Fritz Yizchak Baer.
30 Gen. 25,34.
31 Rishon Le-Zion („Die erste für Zion“) und Sichron Ya’acov („Brunnen Jakobs“) waren die ersten Siedlungen in Palästina vor Theodor Herzls „Judenstaat“.
32 Hugo Bergmann, 1883 in Prag geboren, ging 1920 nach Palästina, war dort zunächst Bibliothekar an der Nationalbibliothek der Hebräischen Universität, bevor er Professor für Philosophie wurde. Zwischen 1935 und 1938 diente er der Universität als Rektor in der Nachfolge von Magnes.
33 BT-Ketubot 111a.
34 Geboren in Dublin, seit 1939 in Palästina und nachmalig Diplomat mit Stationen in den USA, Kanada und Südafrika.
35 Psalm 122,2-4.
36 Jer. 29,7: „Suchet der Stadt Bestes, dahin Ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihnen wohlergeht, so geht es auch euch wohl.“ Der Orientalist Lazarus Goldschmidt (1871 – 1950) hat in dem von ihm übertragenen Babylonischen Talmud in Gittin I, S. 213, „Das Staatsgesetz ist Gesetz“ übersetzt.
37„Kiryat Arba“: hebr. „Bezirk 4“. Zur religionsstiftenden Bedeutung des Ortes Gen. 23,2: „Da starb Sarah zu Kiryat Arba, das ist Hebron im Lande Kanaan, und Abraham begann, für Sarah die Totenklage zu halten und sie zu beweinen.“ Vgl. Gen. 35,27; Ex. 23,2 + 35,27; Neh. 11,25 und Jos. 14,15.
38 Dazu das Buch Esra 9,1-2, über die Auflösung der Ehen mit Fremden: „Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich von den Völkern der Länder, die in ihren Gräueln versunken sind, nicht abgesondert, von den Kanaanitern, den Hethitern, den Perisitern [ein Stamm in Kanaan vor dem Einzug der Israeliten], Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben sich und ihren Söhnen von deren Töchtern Frauen genommen, so dass der heilige Samen sich mit den Völkern der Länder vermischte.“ Auch Isaaks Zwillingsbruder Esau („Er kam aus dem Leib Rebekkas hervor“: Gen. 25,24f.) und wird von der römischen Verderbtheit infiziert: „Als Esau 40 Jahre alt war, heiratete er Judith, die Tochter des Hethiters Be’eri und Basmat, die Tochter des Hethiters Elon. Diese waren für Isaak und Rebekka ein Herzeleid“ (Gen. 26,34f.) Als im Oktober 2018 eine muslimische Moderatorin und ein jüdischer Schauspieler und Sänger heirateten, twitterte ein „Likud“-Abgeordneter: „Ich werfe Lucy Aharish nicht vor, dass sie eine jüdische Seele verführt hat, um unserem Staat zu schaden und mehr jüdischen Nachwuchs daran zu hindern, das jüdische Geschlecht fortzusetzen. Im Gegenteil, sie ist eingeladen, zum Judentum zu konvertieren. Hingegen tadle ich Zachi, den Islamisten Halevi, der ‚Fauda‘ [eine Netflix-Serie] einen Schritt zu weit getrieben hat. Reiß dich zusammen, Bruder. Lucy, das ist nichts Persönliches. Aber wisse, dass Zachi mein Bruder ist und das jüdische Volk mein Volk. Macht Schluss mit der Assimilation.“ Yaír Lapid, Vorsitzender der Partei „Es gibt eine Zukunft“ („Yesh Atid“) begründete seine Ablehnung mit den Verlusten im Holocaust, die durch „Mischehen“ nicht aufgefangen würden.
39 Jes. 56,5: „Ich will ihnen [den Ermordeten] in Meinem Haus und in Meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen setzen.“ Bis Anfang 2017 hat die staatlich geführte Gedenkstätte 26.513 Nichtjuden als „Gerechte der Völker“ geehrt.