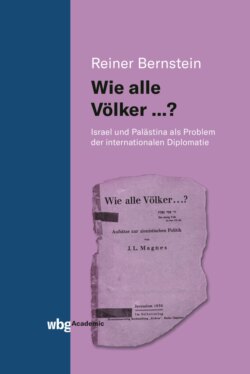Читать книгу Wie alle Völker ...? - Reiner Bernstein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel I
Das Problem
Оглавление1
André Malraux hat vorhergesagt, das 21. Jahrhundert werde das Jahrhundert der Religion sein, oder es werde gar nicht sein. Dazu forderte der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors von der internationalen Politik ein „tieferes Verständnis für die religiösen und philosophischen Vorstellungen anderer Zivilisationen“ und stellte damit das eurozentrische Weltbild in Frage. Stimmen wie diese haben jedoch keine nachhaltige Resonanz gefunden. „Vor allem werden wir uns künftig mehr Mühe geben müssen, andere zu verstehen, bevor wir selbst handeln und uns ihnen moralisch überlegen fühlen“, hat Sigmar Gabriel ergänzt. Selbst die westliche Elitenwissenschaft hat die Verschiebung der Determinanten im Wettstreit der Systeme nicht nachvollzogen. Die internationale Diplomatie steht mit ihren Angeboten und Vorschlägen den nationalistischen und ultra-religiösen Prioritäten in der Region erschöpft gegenüber. Ihre Ratlosigkeit bekämpft sie mit der Flucht in „Visionen“ und beschwört „Grundwerte“.
Die Kontroverse um das Verhältnis zwischen Moderne und Tradition, zwischen Politik und Religion zieht sich durch die Geschichte des Zionismus und des Staates Israel. Zwar trugen die „niederen Seelen“ der Land- und Bauarbeiter in der britischen Mandatszeit keine Gebetsriemen, doch blieb in ihrem Herzen die jüdische Heiligkeit verborgen, wurde behauptet. Die Infektion der bösen Schale („Klippá Nogá“) werde den Einwanderern ausgetrieben. Inzwischen weichen die Lebensentwürfe des einzelnen der Sakralisierung des nationalen Korpus. Gegen sie kommt die Idee eines säkularen Nationalstaates nur schwer zum Zuge. Der liberale Rechtsstaat ist desavouiert, die Falken haben über die Tauben triumphiert. Die politische Opposition präsentiert sich zerrissen, ist als Gegengewicht gering vernetzt und will an ihrer bis in die 1970er Jahre zurückführenden Grundentscheidung festhalten, die Kooperation mit arabischen Parteien zu meiden, um zum „nationalen Lager“ zu gehören. Die Gefahren des Irredentismus in der arabischen Bevölkerung wachsen. Werden arabische Antragsteller bei Behörden, arabische Studenten an den Universitäten und arabische Abgeordnete im Parlament auf ihrer Muttersprache bestehen? Oder wollen sie sich in einer Opferrolle einrichten? Zur Stabilisierung des jüdischen Nationalstaats ist die Bevölkerungsmehrheit zur absoluten Loyalität aufgerufen. Bekenntnisse, das Land gehöre Juden und Palästinensern gemeinsam, werden im Keim erstickt. Eine über den Flügelkämpfen stehende Persönlichkeit mit Charisma fehlt.
Israels erbitterter Kulturkampf zweier ideologisch verfeindeter Blöcke hat vor Deutschland nicht haltgemacht. Jede öffentliche Veranstaltung gerät ins Visier, die sich mit der israelischen Innen- und Außenpolitik kritisch auseinandersetzt. Am 18. September 2018 verabschiedete der Landtag von Nordrhein-Westfalen einen Antrag mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen, in dem nach dem üblichen Deckmantel „Kritik an der israelischen Regierungspolitik (muss) genauso wie in Israel erlaubt sein“ die Behauptung verbreitet wurde, dass die „BDS-Bewegung … zur Isolation und zum wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Boykott des Staates Israel“ aufrufe. Die Antragsteller scheuten nicht davor zurück, den antijüdischen Boykott in Deutschland am 01. April 1933 als Begründung für ihre Entscheidung herbeizuzitieren. Dagegen hatte die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen an die Bundesregierung im April 2013 schon klargestellt, dass es „nicht um Boykott israelischer oder gar jüdischer Produkte (geht), sondern um die Ermöglichung informierter Kaufentscheidungen“ sowie „um die Umsetzung internationalen Rechts und der Politik der Europäischen Union gegenüber Israel2“.
Die transnationale Kampagne kann, wenn sie sich gegen die Produkte aus den Siedlungen der palästinensischen Gebiete richtet, auf Ministerpräsident Menachem Begin (1913 – 1993) berufen, auf den die Anordnung an alle Botschaften und Konsulate zurückgeht, in Zukunft die Bezeichnung „Judäa und Samaria“ statt Westbank oder „verwaltete Gebiete“ zu benutzen und dafür alle administrativen Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die nachgewachsenen Generationen können mit den Markierungen der „Grünen Linie“ nichts mehr anfangen. Sind die Vorwürfe der Delegitimierung Israels und des antijüdischen Ressentiments berechtigt, oder geht es um die Verschleierung von Realitäten, den berüchtigten „facts on the ground“? Fest steht, dass mit Hemmnissen und Verboten BDS-Aktivitäten nicht mundtot zu machen sind.
Im Herbst 2018 forderte Benjamin Netanjahu mehrere europäische Regierungen offiziell dazu auf, Finanzhilfen für israelische NGO’s wie „New Israel Fund“, „Breaking the Silence“ und „B’tselem“ einzustellen, weil sie den Staat Israel und sein Militär beschädigen. Dafür schaltete der Ministerpräsident zusätzlich seinen Sohn Yaír ein, für den Menschenrechtsorganisationen der antisemitischen Konspiration verfallen sind. Im Zuge der vorzeitigen Auflösung der Knesset, um Neuwahlen im März 2019 Platz zu machen, wurde ein Gesetz vorbereitet, um Kultureinrichtungen aus der Förderung zu nehmen, die Israels Identität als jüdischen und demokratischen Staat nicht anerkennen.
Die Verurteilung der Politik Israels in trans- und supranationalen Gremien, in Leitmedien des In- und Auslandes und in Kreisen der internationalen Öffentlichkeit muss von einem Staat, der auf seine exklusiven ethnischen und religiösen Eigenbilder fixiert ist, als unangemessene, ja feindliche Versuche der Einmischung abgetan werden. Wenn sich zudem Juden dem massiven Druck entgegenstellen, erfüllen sie den Tatbestand des Selbsthasses. „Das BDS-Monster ist eine der glorreichen Erfindungen der israelischen Regierung. Mit Hilfe einer Propagandamaschinerie, riesigen Ressourcen und drohenden Botschaften hat sie eine legitime und gewaltlose palästinensische Protestbewegung in eine antisemitische Verschwörung verwandelt“, schrieb „Haaretz“. Wer einen jüdischen Staat haben will, leugnet die Existenz eines zweiten Volkes im Lande.
Waren die Beziehungen zwischen der arabischen Mehrheit und der sefardisch-jüdischen Minderheit in der Epoche der Osmanen relativ einträchtig verlaufen, so nahmen sie mit der aschkenasisch-jüdischen Einwanderung, der „Einsammlung der Zerstreuten3“, in das Land, in dem Milch und Honig fließen würden4, spannungsreiches Tempo auf. Ihm haben die heutigen Palästinenser nichts entgegenzusetzen. Nach innen gespalten, nach außen gelähmt, flüchten sie sich in Rufe wie „Gott ist groß“ („Alláhu Akbár“), nehmen zu Anschlägen als Ausdruck ihrer politischen Hilflosigkeit Zuflucht und können von ihren arabischen Nachbarn nichts erwarten. Ersatzweise verbreiten Gelehrte und Geistliche vernehmlich und aggressiv die These von der Gemeinschaft der islamischen Völker („Ummá“).
Für den Fall, dass der Oberste Gerichtshof als Normenkontrol-linstanz das „Nationalstaatsgesetz für das jüdische Volk“ („Nation-State Bill for the Jewish People“ – „Khoq Leóm Le-Am Ha-Yehudí“)5 als fünfzehntes Grundgesetz vom 19. Juli 2018“ kippt, hat Justizministerin Ayelet Shaked mit einem „Erdbeben, einem Krieg der Verfassungsorgane“ gedroht; bei der Amtseinführung neuer Rabbiner im Oktober 2018 schloss Staatspräsident Reuven Rivlin entgegen der gängigen Praxis Shaked aus. Für Kritiker des Gesetzes hingegen rückte die traditionelle Trauer um die Zerstörung des ersten und zweiten Tempels mit seinem Allerheiligsten („Kodesh Kadish“) am 9. Tag des Monats („Tisha b’Av“), der 2018 auf den 22. Juli fiel, näher und mündete im „freien Hass“ („Sin’át Hinám“) gegen alles Fremde. Das jüdische Volk habe nicht zwei Jahrtausende Verfolgungen und endlose Grausamkeiten ertragen müssen, um nun über ein anderes Volk zu herrschen, er schäme sich, Israeli zu sein, schrieb Daniel Barenboim. Ein moderner Staat lasse sich nicht mit zwei Arten von Staatsbürgern lenken, Herren und Dienern, bekräftigte der Herausgeber der arabischen Jugendzeitschrift „Al-Yad“ („Die Hand“) Odeh Bisharat. Das ehemalige Mitglied des Obersten Gerichthofs Salim Joubran mahnte, dass der Grundsatz der Gleichstellung in jedem demokratischen Staat der Welt gewährleistet sei. Der drusische Rechtsanwalt Rafik Hálabi warnte vor einem „Ehrenzertifikat“. Oppositionsführerin Tsipi Livni begründete die von Benjamin Netanjahu für ethnische und religiöse Minderheiten ins Spiel gebrachte Sonderregelung als Einführung eines „Klassensystems“. Der Jerusalemer Politologe Zeev Sternhell befürchtete, dass dem „Nationalstaatsgesetz“ weitere Stationen zum Abbau der pluralistischen Demokratie und der Gewaltenteilung folgen würden. Für den Rechtswissenschaftler Mordechai Kremnitzer bleiben Rassisten eben Rassisten. Der 94 Jahre alte Uri Avnery (1923 – 2018), der weltweit wie kein anderer Israeli die progressive Zivilgesellschaft repräsentierte, lehnte das Gesetz ab, weil Israel der Staat der israelischen Nation und nicht des jüdischen Volkes sei. In einer gemeinsamen Erklärung klagten 40 ehemalige Diplomaten, dass sie der Welt nicht mehr in die Augen blicken und ihr sagen könnten, dass ihr Staat im Geiste der Propheten die einzige Demokratie im Nahen Osten sei.
Die Abgeordnete Stav Shaffir, die im Sommer 2013 an der Spitze der Demonstrationen gegen die hohen Lebenshaltungskosten in Tel Aviv stand, weigerte sich, das „Nationalstaatsgesetz“ zum „zionistischen Traum“ zu rechnen. Es herrsche „ein Status quo des Terrors“ vor, „und je länger wir brauchen, eine Entscheidung zu fällen, desto früher werden wir Teil dieses Standpunkts“. Doch Netanjahu werde eine Episode in der Geschichte Israels bleiben, prophezeite Shaffir kühn. Der Kolumnist Bradley Burston schrieb in einem offenen Brief an „Bibi“ – so Netanjahus üblicher Spitzname –, er begehe den „zerstörerischsten Fehler“ seiner Amtszeit. Der in einer orthodoxen Familie in Los Angeles aufgewachsene Chemi Shalev verwahrte sich gegen den Chauvinismus: Es gebe wenige Länder, in denen solch primitive Ansichten zur Regierungspolitik gehören, etwa Iran und Saudi-Arabien. Der in den 1970er Jahren gegründete „Gush Emunim“ („Block der Glaubenstreuen“) habe den religiösen Zionismus metastasiert, die Ultraorthodoxen infiziert, die säkularen Nationalisten hypnotisiert sowie die Politik und die Medien infiltriert. Die Religion sei zur bedeutendsten Verkäuferin der Okkupation aufgestiegen. Für Shalev reichte das „Nationalstaatsgesetz“ jenen die Hand, die Israel mit Südafrikas Apartheid-Regime gleichsetzen.
Am 29. Juli forderten viele hundert Künstler, Autoren und Intellektuelle – unter ihnen Amos Oz, David Grossman, Abraham B. Yehoshua und Etgar Keret – Netanjahu und die Knesset auf, das Gesetz zurückzuziehen:
„Das Nationalstaatsgesetz, wonach der Staat Israel nur der Nationalstaat der Juden sein soll, erlaubt ausdrücklich die rassistische und religiöse Diskriminierung, verneint Arabisch als eine offizielle Sprache neben dem Hebräischen, erwähnt nicht die Demokratie als die Grundlage des Landes und gibt nicht die Gleichberechtigung als Grundwert an. Deshalb widerspricht sie der Definition des Staates als eines demokratischen Staates und der Unabhängigkeitserklärung, auf deren Basis der Staat gegründet wurde.“
Von nun an solle den Richtern das Recht gegeben werden, dem jüdischen Charakter Israels in ihren Entscheidungen Priorität einzuräumen. An die Adresse Netanjahus gerichtet, fuhren die Unterzeichner fort:
„Während Ihrer Regierungszeit haben Sie ständig die Grundlagen unseres Staates ausgehöhlt. Sie haben die Beziehungen zwischen Israel und den amerikanischen Juden beschädigt, und Sie haben ganze Bevölkerungsgruppen in die Armut gestürzt. Sie haben der israelischen Gesellschaft einen schweren Schlag versetzt, doch der schwerste Schlag ist der gegen die Werte der Gleichberechtigung und der gegenseitigen Verantwortung, auf denen die israelische Gesellschaft gründet und aus denen sie ihre Stärke bezieht.“
Stimmen wie diese halten die Option einer offenen Gesellschaft offen. Aber in Blitzumfragen stimmten 52 oder gar 58 Prozent der jüdischen Israelis dem „Nationalstaatsgesetz“ zu, und 51 Prozent befürworteten die Nachrangigkeit der arabischen Sprache. 45 Prozent zeigten sich unsicher, ob ein solches Gesetz notwendig sei. Um die Einschätzung des Würzburger Rechtsphilosophen Horst Dreier zu variieren: Nicht „die Kirche geht in den Staat auf“, sondern nationalistische und ultra-religiöse Themensetzungen bemächtigen sich des Staates, dessen Agenda, Dynamik und Klima sie in ihrem Sinne verändern und dessen Kontrollverlust sie feiern. Anfang des vorigen Jahrhunderts hatte der in Hildesheim geborene nicht-zionistische Wiener Oberrabbiner Moritz Güdemann (1835 – 1918) geglaubt, das Judentum spanne „den Geist seines Bekenners nicht in den Schraubstock des Glaubens“. Die Wahrheit sei, dass der neutrale Staat ein Mythos bleibe, wenn er sich nicht auf den patriotischen und tribalen Zusammenhalt stütze, hat Yoram Hazony dagegengehalte6. Mit der Opferung des ethischen Neutralitätsgebots als eines Vertrags der gesellschaftlichen Befriedung ist die geringe öffentliche Wahrnehmung der Arbeiten der „neuen Historiker“ einhergegangen. Der von Timothy Garton Ash angemahnte liberale Patriotismus blieb auf der Strecke.
1930 hatte Judah Leon Magnes (1877 – 1948), ab 1925 erster Kanzler und von 1935 bis zu seinem Tode Rektor der Hebräischen Universität, die kommenden Herausforderungen in seiner Broschüre „Wie alle Völker …?“ thematisiert und ihnen den biblischen Vers vorangestellt „Welch anderes Volk auf Erden ist wie Dein Volk in Israel7?“ Magnes wollte ermitteln, ob der Zionismus aufgrund der einzigartigen jüdischen Bindung an Gott8 ein Gemeinwesen jenseits der Realgeschichte schaffen wolle und daraus ein gesondertes Eigentumsrecht auf das Land Israel 9 reklamiere, das mit dem Schwert verteidigt werden müsse10 – Israel gegen den Rest der Welt? Der unter dem Pseudonym Achad Ha’am („Einer aus dem Volke“, 1856 – 1927) auftretende Kulturzionist Asher Ginsburg hatte 1902/03 davor gewarnt, das Schwert gegen die Schrift zu setzen. An die Adresse der „östlichen Zionsfreunde“ gerichtet, warnte er davor, sich der Parole „Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns“ anzuschließen. Oder laute die Alternative, so Magnes, dass sich der künftige Staat mit der universellen „Idee der Gemeinschaft aller Menschen (‚brotherhood‘) und der Gerechtigkeit“ als Teil der Völkergemeinschaft mit allen Rechten und Pflichten zu verstehen gedenke? William M. Brinner und Moses Rischin stellten ihrer Magnes-Biographie dessen Bekenntnis voran: „Für das jüdische Volk werden hohe Ziele (‚high end‘) nie niedere Mittel rechtfertigen. Wir haben uns zu lange aus der rabbinischen Tradition genährt.“
In San Francisco geboren und über seine Mutter deutschsprachig aufgewachsen, musste sich der oberste Repräsentant der Universität eine gewisse politische Zurückhaltung auferlegen. Einerseits war Magnes als unumstrittene Führungsfigur anerkannt, andererseits blieb er die „einsamste Stimme unter den Juden“ (Horace M. Kallen) und für Abba Eban (1915 – 2002) der „große Abweichler“. Für Magnes bildete eine Binationalität mit Selbstregierung auf der Basis politischer und numerischer Parität den Ausweg. Moralische Kraft müsse den Sieg davontragen, wenn Zion „in Gerechtigkeit erlöst11“ werden wolle. Martin Buber (1878 – 1965) verlangte einen „intra-nationalen Zugang“, damit das jüdische Volk als nationale Entität in der sozialen Struktur Palästinas überlebe. Chaim Weizmann (1874 – 1952) zeigte sich davon überzeugt, dass der Zionismus mit der schwerwiegenden Wahrheit der arabischen Gegenwart konfrontiert sei. Nur mit der Lösung des „arabischen Problems“ sei ein lebensfähiger Staat Israel vorstellbar.
Die Schärfe der Alternativen ist von allen Regierungen in je eigenem Sinne beantwortet worden. Golda Meir (1898 – 1978) wählte in ihrer Biographie den Zwischentitel „We are alone“. Der Theologe und Diplomat Yaacov Herzog (1921 – 1972), einer ihrer Berater, bekannte sich in seinen Essays und Vorträgen „A People That Dwells Alone“ zu ihr. Die Belastungen der „Shoah“ haben Neigungen verstärkt, gegenüber der Welt „keine Wahl“ zu haben, fügen sich aber in ein älteres theologisches Konstrukt ein. „Wir sind Überlebende des Holocaust und sehen überall Gefahren. Israelis und Palästinenser – auch sie Überlebende zahlreicher Fremdherrschaften – kennen nur die Sprache der Gewalt“, räumte David Grossman 1999 ein. Die Erfahrungen der „Shoah“ haben für Rivlin die Qualität einer Linse, „durch die wir die Welt sehen“. Netanjahu bekannte sich zu zwei „Hauptprinzipien“, erstens: „Wenn jemand kommt, um dich zu töten, mache dich auf und töte ihn zuerst“. Zweitens: „Wenn jemand uns verletzt, klebt sein Blut an seinen Händen.“ In der „Haggada“ („Erzählung“) am „Seder“-Abend vor „Pessach“ wird der Herr gelobt, „dass Du Dein Volk abgesondert und geheiligt hast“, nachdem sich in jeder Generation die Völker gegen Dich wenden. Dazu hat Aviezer Ravitsky, Professor für Jüdische Philosophie in Jerusalem, auf die „theologische Bürde“ des Staatsnamens in der 979 hebräische Wörter umfassenden Unabhängigkeitserklärung und die Dehnbarkeit des dortigen Begriffs „Fels Israels“ verwiesen:
„In der religiösen Tradition bezeichnet der Begriff einen Glauben an Gott und verweist auf einen passiven Gruß an den ‚Erlöser Israels‘. Im modernen Hebräisch jedoch verweist ‚Vertrauen‘ (das hebräische Wort bitakhón bedeutet auch Sicherheit12) grundsätzlich auf physische und militärische Macht.“
Für den sich zur modernen Orthodoxie zählenden Autor blieb ungeklärt, ob mit dem Schlusssatz „Im Vertrauen auf den Fels Israels“ („Tsur Israel“) die Wehrhaftigkeit des jüdischen Volkes oder der Gott Israels gemeint war. Für Jonathan Sacks, „Chief Rabbi of the United Hebrew Congregations of the Commonwealth“ zwischen 1991 und 2013, stand die doppelte Antwort fest: für die Religiösen steht „Fels Israels“ für Gott, für die Säkularen das jüdische Volk mit seinem unbezwingbaren nationalen Willen. David Ben-Gurion (1886 – 1973) hoffte, dass der Begriff ausreichend doppeldeutig sei, doch das religiöse Führungspersonal setzte die Formulierung „Fels Gottes und seines Erlösers“ durch. Für den Präsidenten des „Herzl Institute“ in Jerusalem Yoram Hazony liegt die Entscheidung auf der Hand: Im Ergebnis („in effect“) ist seit Moses als „Sprecher des Himmels und der Erde“ die „Thora“ die Verfassung des Staates. Seine Botschaft sei kein Sieg des Universalismus, sondern die alleinige Legitimierung Israels. Am Freitag des 14. Mai 1948 (im jüdischen Kalender der 5. Tag des Monats „Iyar“) vor Beginn des Shabbats wurde die Unabhängigkeitserklärung im alten Museum von Tel Aviv hinterlegt, damit sie die drohende arabische Militärinvasion überstehe.
Dass der Staat Israel in der Nachfolge des frühen Zionismus keine Nichteinmischung in Glaubensinhalte garantieren konnte, lag außerhalb der Vorstellungswelt Theodor Herzls (1860 – 1904). Er klopfte an die Tür der jüdischen Zukunft, ohne ihre Fortentwicklung zu kennen. Religiösen Verbindlichkeiten stand er indifferent bis ablehnend gegenüber, die Rabbiner wollte er in die Synagogen schicken: „In den Staat haben sie nicht dreinzureden.“ War er „unjüdisch“? Indem das angestrebte Gemeinwesen die Religion von vornherein einbeziehen musste, war ihm der Zugang zu einer den Grundrechten verpflichteten Demokratie erschwert. Mehr noch: Es war gehalten, die religiöse Neutralität preiszugeben, wenn, wie Avraham B. Yehoshua ausgeführt hat, das jüdische Volk geschichtlich einzigartig ist und nach zweitausend Jahren in sein Land zurückkehrt. Indem die Bindung an Gottes Gebote „mit den durch Arbeit im Lande neu erworbenen Rechten“ verknüpft wurde, habe „die Kolonisation (…) nichts mit den so viel gescholtenen Kolonisationsmethoden des Imperialismus“ zu tun, lautete 1930 die Antwort auf den Kommissionsbericht des britischen Staatssekretärs für die Kolonien Walter Shaw (1864 – 1937).
Zur selben Zeit verwahrte sich Ben-Gurion – nach eigenen Worten mitnichten religiös, doch in Treue zu den Propheten: „Unser Mandat ist die Bibel“ – gegen die „Illusion, dass wir wie alle Völker sind“, und machte Moses als den Urheber des jüdischen Bewusstseins vom gesondert wohnenden Volk („Am segulá“) aus – für ihn „das angeborene jüdische Bewußtsein“, wenn auch „eine besondere Last, die Verpflichtung, nach dem Gewissen zu handeln und auf das zu hören, was der [Prophet] Elia hernach ‚die leise Stimme‘13 genannt hat“. Das jüdische Volk stehe erst am Anfang der Erwählung, schränkte er später ein, habe aber in der Zerstreuung die „göttliche Präsenz“ (aramäisch „Shechintá Be-Galutá“) in seinem Leben bewahrt. 1955 ließ er den kanadischen Generalmajor E.L.M. Burns, dem Kommandanten der UN-Waffenstillstandsmission, wissen: „Der Ewige gibt Seinem Volk Macht, der Ewige, mit Frieden segnet Er Sein Volk14.“
Für den Bibelwissenschaftler Uriel Simon stand der politische Zionismus „nackt vor der jüdischen Tradition“ und zeigte, „dass wir nicht wie andere Völker sein können“15. Shneúr Zalman Abramov (1908 – 1997), Mitglied der Knesset zwischen 1959 und 1973 sowie ihr zeitweiliger Präsident für den „Block für die Freiheit Israels“ (Akronym „Gahal“) unter Führung Menachem Begins, machte im Zionismus ein „ewiges Dilemma“ aus. Andere Autoren sprachen von einem „messianischen Dilemma“ oder von einer „messianischen Realutopie“. Der New Yorker Historiker Yosef Hayyim Yerushalmi (1932 – 2009) sah im Zionismus eine „angespannte Dialektik von Gehorsam und Rebellion“, der Jerusalemer Historiker Eliezer Schweid fragte: „Israel – Heimatland oder Land des Schicksals?“ Der Publizist Yossi Melman zeigte sich zwar davon überzeugt, dass 80 Prozent der Israelis Atheisten seien wie er selbst, dass sie aber auf dem „Drahtseil“ zwischen Weltlichkeit und Religiosität balancieren, wofür er in seinem Buch die Zwischenüberschrift „Auf Gott vertrauen wir“ wählte: Wahrscheinlich seien Religion und Nationalität eine Einheit: Durch die Konzentration bleiben beide miteinander verbunden.
Im Rückblick sei daran erinnert, dass der aus Köln eingewanderte Georg Landauer (1895 – 1974) die jüdische Nationalbewegung „immer (als) ein(en) Mantel für ganz verschiedenartige, ganz entgegengesetzte Bestrebungen“ sah. Die Soziologin Susan Hattis Rolef glaubte an die Chance, dass Israel zum „Hafen für alle Juden“ werde, „religiös oder säkular, orthodox, konservativ und Reform, aschkenasisch, sefardisch oder sonst“. Das Bekenntnis zur Pluralität richtete sich gegen eine religiöse Monokultur, welche Politik und Gesellschaft zu beherrschen sucht, sich populistisch-suggestiv und kanonisch der staatlichen Ordnung bedient und Israel nur als Ort der Zuflucht vor dem Antisemitismus wähnt. Jakob Klatzkin (1882 – 1948), von 1909 bis 1911 Chefredakteur der auf gelbem Papier erscheinenden „Welt“, dem von Herzl 1897 gegründeten Organ der Zionistischen Organisation, hatte noch geglaubt, dass die „Judophobie“ eine heilbare Krankheit sei.