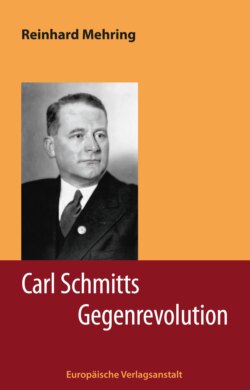Читать книгу Carl Schmitts Gegenrevolution - Reinhard Mehring - Страница 12
5. Transzendentale Souveränität?
ОглавлениеSchmitt schließt 1922 also mit seiner Positionierung zu Kaufmann seine eigene Kritik der neukantianischen Rechts- und Staatslehre ab, die er in seiner Habilitationsschrift begonnen hatte und in der Binder-Besprechung weiterführte. Wo er vor 1918 diagnostizierte, dass der Neukantianismus auf dem „schmalen Weg des Transzendentalismus“ gestrandet sei und den Transzendentalismus an Positivismus und Methodologie verraten habe, scheint er der „Machttheorie“ nun selbst zu verfallen. Das zeigt sich insbesondere im phänomenologischen und anerkennungstheoretischen Hinweis auf die „religiöse“ „Bewertung“ faktischer Macht als Recht. Vielleicht suchte Schmitt mit seiner Souveränitätslehre eine eigene Variante des „Transzendentalismus“. Wiederholt habe ich seine Habilitationsschrift als „transzendentalpragmatische“ Grundlegung bezeichnet.30 Schmitt nannte eine „relativ dauernde und beständige Macht“, wie zitiert, ein „Symbol oder Indiz einer Qualität“ (WdS 35): nämlich des Rechts, und er berief sich dafür auf kirchenrechtliche Literatur. Beide Aspekte kehren in der Politischen Theologie wieder: Schmitt anerkennt 1922 nicht jede Macht als Recht, er erkennt nur derjenigen Macht eine Rechtsqualität zu, die den „Ausnahmezustand“ entscheidet, einen Normalzustand schafft und also Ordnung stiftet.
Wo Schmitt im Wert des Staates auf kirchenrechtliche Literatur verweist, skizziert er 1922 seine „begriffssoziologische“ These und Skizze vom Wandel des Weltbildes und „Übergang von Transzendenzvorstellungen zur Immanenz“. Vergleicht man diese Säkularisierungsthese – Schmitt spricht im Vorwort zur zweiten, revidierten Auflage, auf Webers „Zwischenbetrachtung“ anspielend, von Stufen eines „Säkularisierungsprozesses“ – etwa mit Wilhelm Diltheys „Weltanschauungslehre“ und „Philosophie der Philosophie“, so konstatiert Schmitt keine Pluralität konsequent möglicher Idealtypen, die zur alternativen Option stünden, sondern eine historische Abfolge. Was er im „Ausnahmezustand“ praktisch für nötig erachtet: die souveräne Entscheidung, historisiert er in den „metaphysischen“ Voraussetzungen. Damit formuliert er einen zwiespältigen Befund: Systematisch betont er, dass dezisionäre Entscheidungen einen starken Personalismus fordern, der auf „Transzendenzvorstellungen“ beruht und eigentlich nur in einem „theistischen“ Weltbild begründet und gehalten sei; säkularisierungsgeschichtlich konstatiert er aber, dass dieses Weltbild seit der Französischen Revolution mit dem Übergang zur Volkssouveränität und demokratischen „Immanenzvorstellungen“ hoffnungslos in die Defensive geraten sei und die „Gegenrevolution“ deshalb schon 1848 ihre „Legitimität“ verlor. Auch Schmitt konstatiert also, ähnlich wie Kaufmann, eine metaphysische „Krisis“. 1922 weist er Kaufmanns Ruf nach dem „Lebensgefühl“ und einer „Metaphysik des Geistes“ dennoch zurück. Die „Darstellung einer Lebens- oder Irrationalitätsphilosophie“, die er 1922 bei Kaufmann vermisst, wird er 1923 im Schlusskapitel seiner Broschüre Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus dann in Georges Sorels „Lehre vom Mythos“ finden, die Mussolini mit dem Marsch auf Rom gerade einem nationalistischen Praxisbeweis unterzog.