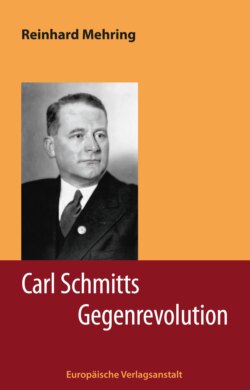Читать книгу Carl Schmitts Gegenrevolution - Reinhard Mehring - Страница 16
3. Quellenfrage
ОглавлениеHier soll die Weimarer Republik aber nicht weiter vom Ende her betrachtet werden, sondern von den Anfängen. Wie sah Schmitt sie 1918/19 und was bot er zur juristischen Beschreibung auf? Sah er den Systemwechsel bereits in den Kategorien seiner späteren Verfassungslehre und war er von Beginn an ein antiliberaler Gegner? Oder gab es vor 1923 einen anderen Schmitt, Vernunft- oder gar Herzensrepublikaner? 1940 publizierte Schmitt eine gewichtige Sammlung von Interventionen unter dem Titel Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles. Grob gesagt deutete er die Weimarer Republik und den Genfer Völkerbund hier vom „Diktatfrieden“ von Versailles her. Weimar und Genf betrachtete er gleichsam als Systeme der Sieger von 1918/19. Schmitt beschloss diese Sammlung im August 1939 kurz vor Kriegsbeginn und datierte seinen Dreifrontenkampf auf die Jahre 1923 bis 1939. Zweifellos setzte er seinen Kampf gegen „Versailles“ auch nach 1939 fort. Seine Schrift Völkerrechtliche Großraumordnung proklamierte eine „Überwindung des Staatsbegriffs“ durch imperiale Großraumordnungen und reklamierte den mitteleuropäischen Großraum als hegemonialen Herrschaftsraum für das nationalsozialistische Reich. Eine fortdauernde kritische Betrachtung Weimars ist auch nach 1945 bei Schmitt offenbar.
Weitaus schwieriger ist aber die Antwort auf den Beginn dieses verfassungspolitischen „Kampfes“. Der „Kampf“ gegen Versailles, Genf und Weimar ist eigentlich erst ab 1923 publizistisch greifbar. Davor hat Schmitt keine eingehenden Analysen der Lage publiziert. Für die genaue Verortung in den Münchner Jahren 1915 bis 1921 oder gar der Umbruchzeit von 1918/19 fehlen nicht nur einschlägige Schriften, sondern auch aussagekräftige briefliche Zeugnisse und andere Quellen. Das Tagebuch bricht Ende 1915 ab und beginnt erst im Spätsommer 1921 wieder mit dem Wechsel nach Greifswald. Nur wenige Briefe aus Münchner Zeit sind bisher ediert. Dass diese Jahre nach wie vor im Dunklen liegen, hat mindestens einen starken persönlichen Grund: das Scheitern von Schmitts erster Ehe mit der legendären Halbweltdame und Hochstaplerin Carita Dorotić, die sich als Gräfin ausgab und fünf Jahre jünger machte. Im Zusammenhang mit diesem Ehedebakel und -skandal hat Schmitt wahrscheinlich Dokumente vernichtet. Erst mit der beruflichen Etablierung als Ordinarius in Bonn sind die biographischen Quellen reichlicher erhalten. Wer Schmitts Haltung zum Umbruch von 1918/19 rekonstruieren möchte, stößt also auf ein Quellenproblem, das die späteren retrospektiven Äußerungen nur zu bereitwillig übertünchten. Schmitt hat seine Biographie mit mancherlei Legenden verstellt. Zeitnahe authentische Zeugnisse sind eigentlich nur die großen Monographien Politische Romantik und Die Diktatur von 1919 und 1921. Von den früheren und späteren Schriften her ist aber klar, dass es beachtliche Positionswandel gab und der Schmitt von 1925, 1928 oder 1933 nicht mit dem Autor des Frühwerks zu verwechseln ist.