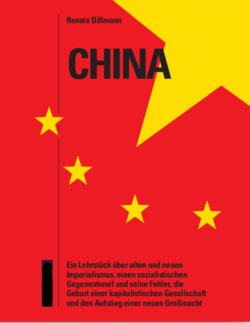Читать книгу China – ein Lehrstück - Renate Dr. Dillmann - Страница 10
Löhne und Sozialversicherungen
ОглавлениеDie Reallöhne in China sind zwischen 2008 und 2017 durchschnittlich um mehr als 80 % gestiegen.11 Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte haben einige Teile Chinas, vorwiegend an der Ostküste und im Umkreis von Beijing, den Status eines Billiglohnlandes hinter sich gelassen. Das ist eine Entwicklung, die die chinesische Führung in Beijing teilweise durchaus unterstützt, z. B. mit demonstrativer Zurückhaltung im Honda-Streik 2010/11, weil sie ihrem Selbstverständnis als potente Nation nach keineswegs auf ewig der „Kuli“ der Welt bleiben will. Es war insofern kein Wunder, dass dieser Lohnkampf in einem japanischen Unternehmen, also beim ideologischen „Hauptfeind“, stattgefunden hat (Japan hatte im 2. Weltkrieg versucht, China als seinen „Lebensraum“ zu erobern; dabei verloren 20 Millionen Chinesen ihr Leben).
Auch dem Gesichtspunkt, dass eine Förderung der einheimischen Nachfrage nützlich für die Entwicklung des Binnenmarktes ist, kann die chinesische Führung etwas abgewinnen – in dieser Funktion kommt also der angestrebte „bescheidene Wohlstand“ der Massen bei ihrer KP durchaus vor. Dabei behält sie natürlich sofort die andere (und letztlich eben doch ausschlaggebende) Funktion der Löhne im Auge: In Guangdong etwa, der durch die riesige Industriezone Shenzen reichsten Provinz, haben Lohnerhöhungen bereits zu einer Abwanderung ausländischer Unternehmen nach Vietnam und Indonesien geführt – woraufhin die dortige Provinzregierung Lohnerhöhungen vorläufig eingefroren hat.
Insofern ist es kein Wunder, dass parallel zu den schnell steigenden Löhnen in einigen Provinzen andere Regionen, die ihre kapitalistische Erschließung erst noch in Gang setzen wollen, ihre Bewohner nach dem bewährten Erfolgsrezept zu sehr billigen Löhnen anbieten. Mindestlöhne werden von den Provinzregierungen festgesetzt; das handhaben diese als Mittel ihrer Konkurrenz um Kapitalinvestitionen und/oder Arbeitskräfte – je nachdem, was ihnen gerade wichtiger erscheint. Im Resultat variieren die chinesischen Löhne nach Branchen und Regionen massiv.12
Seit den 2000er-Jahren baut China verschiedene sozialstaatliche Strukturen auf, insbesondere die klassischen Sozialversicherungen. In der sozialistischen Etappe der Volksrepublik war die soziale Versorgung des Volks Staatsziel. Dem entsprechend wurde schnell eine rudimentäre Gesundheitsversorgung auf dem Land entwickelt und in der Zeit der Volkskommunen zu einer kollektiven Sicherung ausgebaut – auch wenn man sich das alles schlicht und eher am Überleben orientiert vorstellen muss. Die Staatsbetriebe in den Städten boten ihren Beschäftigten eine ziemlich umfassende Versorgung bei Krankheit, Kinderbetreuung und im Alter – was zwar nur eine Minderheit der chinesischen Bevölkerung betraf, aber als ernsthaftes Ideal für den weiteren „sozialistischen Aufbau“ galt (mehr dazu in Teil 1 des Buchs). All das wurde in den ersten beiden Jahrzehnten der „Systemtransformation“ zerschlagen bzw. aufgegeben; Gesundheitsleistungen wurden weitgehend privatisiert und damit für viele Chinesen unerschwinglich, die Altersversorgung Gegenstand privater Vorsorge bzw. den Familien überlassen. Der Zweck chinesischer Betriebe – ob privat, kommunal oder staatlich geführt – sollte künftig ja die Erzielung von Gewinn und nicht die Versorgung ihrer Belegschaften sein (ausführlich in Teil 2, Kapitel 4).
Inzwischen will die kommunistische Führung die anfallenden Notlagen des kapitalistischen Lohnarbeiterlebens (Arbeitsunfälle, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter, Pflegebedürftigkeit) nicht mehr einfach dem Lauf der Dinge bzw. „dem Markt“ überlassen, den sie selbst in Kraft gesetzt hat. Nachdem es ihr mit dem Angebot konkurrenzlos billiger Arbeitskräfte gelungen ist, internationales Kapital ins Land zu locken und nachdem sie damit eine sich dauerhaft selbst verstärkende Akkumulation von Kapital ins Leben gerufen hat, steht sie nun auf dem gut sozialdemokratischen Standpunkt einer „nachhaltigen“ Bewirtschaftung der Ressource Arbeitskraft. Damit reagiert die chinesische KP auch auf eine weit verbreitete Unzufriedenheit ihrer Bevölkerung mit der medizinischen Versorgung in den Krankenhäusern und den Preisen für Medikamente, die die Pharma-Firmen verlangen,13 sowie den zunehmenden praktischen Problemen bei der Versorgung der alten Menschen angesichts von Ein-Kind-Politik und großer Arbeitsbelastung der jüngeren Generation.
An diesem Beispiel wird übrigens deutlich, wie in der Volksrepublik die Berücksichtigung von Problemen und Beschwerden der Bürger vor sich geht. Wenn der Führung des Landes die von ihr wahrgenommene Unzufriedenheit als wirtschafts- bzw. staatsnützlich einleuchtet, zieht sie entsprechende Konsequenzen und leitet Reformen ein – auch ohne die in westlichen Nationen üblichen demokratischen Mechanismen mit Parteien, Wahlen, Opposition, Lobbyismus.
Umgekehrt offenbart das Beispiel, dass die chinesische Regierung – genau wie die westlichen Verwalter kapitalistischer Standorte – die Existenz sozialpolitischer Notlagen als zu ihrer Ökonomie gehörende Erscheinungen unterstellt und anerkennt. Dass die von Lohnarbeit lebenden Menschen auch in ihrem „Sozialismus chinesischer Prägung“ ohne nennenswerte Mittel dastehen, wenn sie krank, arbeitslos oder alt sind, ist für sie so selbstverständlich, dass sie sich gleich den Aufbau mehrerer Sozialversicherungen auf die Tagesordnung setzt, die für das Überleben unter diesen Bedingungen sorgen sollen.14
Bei der Einführung einer Unfall-, einer Kranken-, einer Arbeitslosen- und einer Rentenversicherung orientiert sich China übrigens weitgehend an europäischen Vorbildern. Seine Sozialpolitiker suchen sich aus den verschiedenen Modellen (National Health Service oder Gesetzliche Krankenversicherung; Renten zusammengesetzt aus staatlichem Zuschuss, gesetzlicher Versicherung und Betriebsrente etc.) das heraus, was sie für besonders geeignet halten bzw. mischen die verschiedenen Möglichkeiten. Gleichzeitig ziehen sie aus den finanziellen Engpässen der europäischen Sozialsysteme den Schluss, die systembedingt engen Grenzen der Sozialpolitik von vornherein zu berücksichtigen. Inzwischen existiert eine aus Steuern finanzierte Basis-Gesundheitsversorgung für alle chinesischen Bürger; darüber hinaus sind fast alle in einer gesetzlichen Krankenversicherung erfasst, die für städtische Lohnarbeiter verpflichtend, für Bauern auf dem Land freiwillig ist (ein Angebot, das offenbar massiv wahrgenommen wird).15 Zusätzlich zur gesetzlichen Zwangs-Versicherung, die maximal 80 % eventueller Krankheitskosten und einen Teil des Lohnausfalls abdeckt, können diejenigen, die es sich leisten können, private Versicherungen abschließen. Auch an einem solchen Punkt kommt also die „soziale Differenzierung“ der einst so egalitären chinesischen Gesellschaft vorwärts.
Exkurs zu Corona: Repressiver Staat kann Virus unterdrücken?
Das Corona-Virus Covid 19 ist in China entstanden, besser gesagt: Es wurde dort zum ersten Mal festgestellt (inzwischen gibt es mehrere Nachweise seiner Existenz in Frankreich bzw. Italien vor November 2019 – sein „Ursprung“ ist insofern wissenschaftlich zurzeit ungeklärt). Inzwischen – ein Jahr später – gilt die Pandemie in China wie einigen anderen südasiatischen Staaten als weitgehend „bewältigt“, während Nord- und Südamerika und Europa steigende Infektions- und Todeszahlen aufweisen. Die hierzulande kursierende Erklärung – wenn überhaupt Interesse geäußert wird – kürzt sich im Grunde darauf zusammen, dass in einer Diktatur eben einiges möglich ist, was „wir“ hier nicht wollen. Zwei Beispiele für viele:
„Als sich im Januar 2020 das Coronavirus in Wuhan ausbreitete, stockte der Weltbevölkerung der Atem. Eine Pandemie ausgerechnet in dem Land mit der Milliardenbevölkerung und zahlreichen Millionenstädten. Zur Eindämmung nutzte die chinesische Regierung viele Möglichkeiten eines diktatorischen Systems: Städte wurden abgeriegelt, die Bevölkerung in Hotspots wurde in ihren Häusern eingesperrt und die Armee wurde eingesetzt. Bereits Ende März erklärte das Politbüro die Pandemie für beendet.“16 „Die Propaganda spricht vom ‚Volkskrieg‘, wie schon der Staatsgründer Mao im Kampf für ein kommunistisches China, und die Chinesen machen mit. So bekommt das Land, in dem alles begonnen hat, noch im Frühjahr seine Epidemie in den Griff.“ 17
Auch wenn es manchmal etwas differenzierter zugeht, bleibt die Botschaft dieselbe: Die Erfolge Chinas bei der Eindämmung der Pandemie beruhen darauf, die Freiheit des Individuums nicht zu beachten: kein Datenschutz, keine Intimsphäre.
Stattdessen: abriegeln, einsperren, Armee.
Es fragt sich allerdings, ob man mit staatlicher Unterdrückung ein Virus besiegen kann – wie es die Vorstellung nahelegt und wie es auch die hiesige Wissenschaft bekräftigt: „Chinas Vorteil in der Pandemie-Bekämpfung: Sie können die Menschen einfach zwingen.“ (Nils Grünberg, Mercator Institut18). Zwingen – wozu?
Versuchen wir hier eine vorläufige Richtigstellung.
Im November 2019 wurden in der Stadt Wuhan Lungenentzündungen einer bis dahin unbekannten Art registriert. Die Stadtverwaltung, gerade mit der Ausrichtung eines Parteijubiläums o. ä. befasst, reagierte mit einer Mischung von Ignorieren und Bagatellisieren auf die ersten Meldungen ihrer Mediziner. Einem Augenarzt, Li Wenliang, der seine Warnungen öffentlich machte, wurde Panikmache vorgeworfen und mit schweren Konsequenzen gedroht, falls er keine Ruhe gebe.
So weit, so üblich und so mies.19 Nachdem die staatliche Führung die Bedeutung der Erkrankungen begriffen hatte, reagierte sie allerdings zügig.
Am 31.12.2019 informierte die chinesische Regierung die Weltgesundheitsorganisation WHO, als 41 „atypische Erkrankungen“, aber noch kein Todesfall vorlagen. Taiwan hat darauf alle Flüge nach Festland-China ausgesetzt und mit weiteren Maßnahmen reagiert. Schon am 7.1.2020 übermittelten die chinesischen Wissenschaftler das entschlüsselte Genom des neuen Virus an die WHO.
In Wuhan und der gesamten Provinz Hubei (58,5 Millionen Einwohner) wurde der Gesundheits-Notstand ausgerufen. Die Grenzen der Provinz wurden geschlossen, um eine weitere Ausbreitung ins Rest-Land zu verhindern; Ausgangssperren erlassen, die Versorgung der Stadt (11 Millionen) wurde staatlich organisiert.
„Der Staat organisiert die Versorgung der Bevölkerung. Jene, die draußen arbeiten müssen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Medizin und Nahrungsmitteln zu gewährleisten, tragen eine komplette Schutzausrüstung: Maske, Brille, Handschuhe, Ganzkörperanzug. Alle Straßenzüge wurden großflächig desinfiziert. Ein 24-Stunden-Dienst aus lokalen Kadern der kommunistischen Partei und Hausverwaltungsbeamten überwacht die Einhaltung der Regeln.“1 „Vom 17. Februar 2020 an galten für die gesamte Provinz Hubei weitere verschärfte Maßnahmen, die der Eindämmung der Epidemie dienen sollten. Insgesamt verhängte die Provinzregierung durch Erlass 15 Beschränkungen. Alle nicht wesentlichen öffentlichen Orte werden geschlossen, Massenveranstaltungen untersagt. Apotheken und Supermärkte bleiben geöffnet, müssen aber bei jedem Eingelassenen die Körpertemperatur bestimmen. Zusätzlich müssen von jedem Käufer von Husten- oder Fiebermitteln alle Personaldaten erfasst werden. In der gesamten Provinz werden die Zufahrten zu allen Dörfern und Gemeinden gesperrt, um Ausreisen zu kontrollieren und Externen den Zugang zu verwehren. Der Betrieb aller Fahrzeuge ist untersagt mit Ausnahme von Transport-, Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeifahrzeugen. Zeitgleich lief eine dreitägige Tür-zu-Tür-Erfassungsaktion in allen Gemeinden an, mit dem Ziel, ausnahmslos alle bisher unerkannten Fälle zu identifizieren und aufzunehmen. (…) Eine wissenschaftliche Studie prüfte im April 2020 die Effektivität der Eindämmungsmaßnahmen und glich auch die aus China gemeldeten Daten mit dem in der Studie verwendeten mathematischen Modell ab. Die Autoren schrieben, die chinesischen Fallzahlen würden plausibel den Verlauf des Ausbruchs wiedergeben und seien in sich kohärent. Die Modellrechnung ergab, dass ab dem 7. Februar die Zahl der durch das System nicht erfassten Neuinfektionen einen Höhepunkt erreicht habe und somit die Ausbreitung entscheidend gebremst wurde. Die Forscher nannten die Maßnahmen effektiv und ursächlich für die Entwicklung der Fallzahlen; man könne allerdings keine Aussage über die Effektivität von Einzelmaßnahmen treffen, weil die Maßnahmen ‚paketweise‘ implementiert wurden.“2
„Auf Bannern, die in der Öffentlichkeit aufgehängt wurden, wurden die Menschen aufgefordert, Masken zu tragen, ihre Wohnung verstärkt zu lüften und regelmäßig die Hände zu waschen und diese möglichst auch zu desinfizieren. Dazu der Appell: Hört auf die Wissenschaft und nicht auf irgendwelche Gerüchte. Und man konnte sehen, dass die Leute das ernst nahmen. Wir (in Beijing, Zusatz d. Verf.) hatten keinen Lockdown wie in Wuhan, trotzdem ging kaum noch einer auf die Straße. Anders als zurzeit in Deutschland war es in Beijing nicht verpflichtend, im Supermarkt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es haben aber trotzdem fast alle gemacht. Selbst auf der Straße trugen bald 85 bis 90 Prozent der Menschen eine Maske. Weil den Leuten einfach klar war, dass das vernünftig ist.
Es war dann auch sehr schnell so, dass alle, die irgendwo einen Eingang zu bewachen hatten, also zum Beispiel Rezeptionisten in Büro- oder Hochhäusern oder die Kontrolleure an den Zugängen zur U-Bahn, schnell mit elektronischen Fieberthermometern ausgestattet wurden. Diese haben dann bei jedem die Temperatur am Handgelenk gemessen. Das gleiche in Parks, die alle ein Tor haben und von Parkwächtern betreut werden. Und wer nur etwas erhöhte Temperatur hatte, wurde aufgefordert, sich testen zu lassen.
Sofort wurden auch die Nachbarschaftskomitees mobilisiert. Das sind die Graswurzelorganisationen der Kommunistischen Partei. Deren Mitglieder gingen von Wohnung zu Wohnung, fragten, ob alle gesund seien und verteilten Handzettel mit Informationen. Gleichzeitig haben sie halb Beijing durchdesinfiziert, die öffentlichen Toiletten in der Altstadt, die Nahverkehrsmittel usw.3
„Entgegen der Meinung der WHO haben die Chinesen Wuhan im Januar mit einem ‚travel ban‘ und einer Ausgangssperre lahmgelegt. Ich erspare es mir, auf die anderen Maßnahmen einzugehen, welche in China getroffen worden sind. Nach Meinung internationaler Forschungsteams hat China mit diesen früh und radikal einsetzenden Maßnahmen Hundertausenden von Patienten das Leben gerettet.“ 4
„Washington – Die Ausgangssperre in der chinesischen Stadt Wuhan hat einer Studie zufolge womöglich 700.000 Ansteckungen verhindert und die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus signifikant verzögert.
Die drastischen Maßnahmen in Wuhan, das als Epizentrum der Pandemie gilt, innerhalb der ersten 50 Tage hätten anderen Städten im Land wertvolle Zeit zur Vorbereitung eigener Beschränkungen verschafft“, schreiben Forscher aus China, den USA und Großbritannien in einem gestern in der Fachzeitschrift Science (2020; doi; 10.1126/eabb6105) veröffentlichten Beitrag.
„Unsere Analyse legt nahe, dass es ohne das Reiseverbot in Wuhan und die nationale Notfallreaktion bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 700.000 bestätigte COVID-19-Fälle außerhalb von Wuhan gegeben hätte“, erklärte Christopher Dye, Wissenschaftler der Universität von Oxford. „Chinas Kontrollmaßnahmen scheinen gewirkt zu haben, indem sie die Übertragungskette erfolgreich durchbrochen haben.“5
Für die nötige Gesundheitsversorgung in Wuhan wurden im Eiltempo zwei neue Krankenhäuser gebaut und weitere 12 Notfallkrankenhäuser eingerichtet. Alle Infizierten wurden in besonderen Aufnahmezentren untergebracht, auch wenn sie keine Behandlung brauchten, da sich herausgestellt hatte, dass die meisten Infektionen (75 %) in häuslicher Umgebung stattfinden. In diesen Zentren konnten sich positiv Getestete (bei nicht schwerem Verlauf) Gesellschaft leisten. Nicht erkrankte Menschen schickten die Behörden in eine streng überwachte häusliche Quarantäne. Für die Behandlung der Erkrankten wurde medizinisches Personal aus dem gesamten Land zusammengezogen (mehr als 40.000 Ärzte und Pfleger)20.
Es wurde auf eine strikte Trennung der Corona-Tests und Behandlung von Infizierten vom restlichen Gesundheitsdienst geachtet (das galt „nach Wuhan“ in ganz China); aufwendige Schutzkleidung für das medizinische Personal, dessen Arbeitszeit auf 6 Stunden (!) beschränkt wurde, um Infektionen durch nachlassende Konzentration zu vermeiden21.
Nach dem chinesischen Neujahrsfest (24.1.2020) wurde ein landesweiter Lockdown verhängt, bei dem Schulen geschlossen und ein nicht unerheblicher Teil der Produktion des Landes stillgelegt wurden, soweit die Arbeiten nicht zur weiteren Versorgung notwendig waren: „Dass China seine Wirtschaft mit einer Leistung von rund 13 Billionen Euro (Deutschland: 3,4 Billionen Euro) nach der massenhaften Verbreitung des Corona-Virus mal eben fast einen ganzen Monat lang auf nahezu null heruntergefahren hat, Geschäfte geschlossen, Arbeiter und Angestellte in Quarantäne gesteckt und Transport- und Reiseverbindungen gekappt hat, sei in der Geschichte der Welt ohne Beispiel, sagt Andrew Batson vom Pekinger Analysehaus Gavekal Dragonomics.“ (FAZ 12.3.2020)
Diese Maßnahme sollte einerseits dafür sorgen, dass nicht Hunderte Millionen gleichzeitig mit Flugzeug, Bahnen und Bussen zu ihren Arbeitsstätten zurückkehrten22, andererseits das Arbeiten in den riesigen, engen Fabriken in der ersten Phase der Pandemie verhindern.
Entlassungen wurden den betroffenen Staatsbetrieben untersagt. Bei privaten Betrieben, die zu denselben Maßnahmen aufgefordert wurden, galt: Wer in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt hatte, aber noch nicht anspruchsberechtigt war, erhielt 6 Monate Arbeitslosengeld23.Es gab einmalige (allerdings nicht sonderlich hohe) staatliche Unterstützungen für Wanderarbeiter, die ein „Kleinst- oder ein Familienunternehmen“ führen. In wieder eröffneten Betrieben sollten massive staatliche Kontrollen bezüglich Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz für Infektionsschutz sorgen; bei Verstößen wurde das Unternehmen unverzüglich stillgelegt.
Engere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs, um mehr Platz und Abstand für die Fahrgäste zu schaffen.
Gesundheitspolitisch galt flächendeckend Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Überall wurde per Thermoscanner Fieber gemessen, Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und großzügig zum Einsatz gebracht (Verkehrsmittel etc.).
Es wurden sehr schnell Massentests durchgeführt, wenn neue Infektionen auftraten: 10 Millionen Tests in Wuhan im Juni 2020 mitmiettl dem Ergebnis, dass 300 symptomlose Infektionen festgestellt wurden; 1 Million in Quingdao nach 8 festgestellten Fällen; 4 Millionen in Kashgar.
Entwicklung einer Corona-App, die laut DW so funktioniert: „Vor dem Betreten vieler öffentlicher Orte müssen die Chinesen einen Gesundheits-Code auf ihrem Handy vorzeigen. Ein QR-Code in den Farben Grün, Gelb oder Rot gibt Auskunft darüber, ob sich der Handynutzer an Orten mit einem hohen Infektionsrisiko aufgehalten hat oder Kontakt zu einem Infizierten hatte.“24 Weil viele Restaurants und Parks, aber auch Arbeitgeber und Verkehrsbetriebe das Vorzeigen der „grünen“ Ampel verlangen, ist die App faktisch Pflicht geworden, wenn man am öffentlichen Leben teilnehmen will.
Schließung der chinesischen Grenzen für ausländische Touristen. Geschäftsreisende, die ein Visum bekommen, müssen sich einer 14-tägigen Quarantäne in dafür ausgewiesenen Hotels unterziehen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten:
Auch in der Volksrepublik setzt die staatliche Führung Gesundheitsmaßnahmen für ihr Volk stets in ein Verhältnis zum Wirtschaftswachstum. Die lokalen Behörden haben auf die ersten Fälle von Covid-19-Infektionen mit Ignoranz und Bagatellisierung reagiert: Eine Krankheit stört das erwünschte Wirtschaftswachstum und die staatliche Erfolgsbilanz. Sobald die pandemische Bedeutung erkannt war, hat die chinesische Führung auf eine konsequente Eindämmungs-Strategie25 gesetzt. „Eindämmungs-Strategie“ bedeutet, dass tatsächlich mit aller Konsequenz versucht wurde, die Zahl der Infizierten auf null zu bringen26. Der Grund dafür liegt einerseits in den Erfahrungen, die China (und die asiatischen Länder) mit den Vorgänger-Epidemien Sars und Mers gemacht hatten; andererseits in der staatlichen Einschätzung, dass ein harter und durchaus kostenintensiver Lockdown (das Wirtschaftswachstum fiel im 1. Quartal auf -7 %, die Exporte in Januar und Februar 2020 auf -24 % bzw. -27 %!) letztlich günstiger ausfallen würde als andere Varianten. In der Folge hat die chinesische Politik alle Mittel angestrengt, die sie zur Verfügung hatte – insofern sind gesundheitspolitische Entscheidungen dieser Art bei Staaten, die im Prinzip alle dasselbe Verhältnis von Volksgesundheit und Wirtschaftswachstum aufmachen, wesentlich eine Frage der jeweiligen nationalen Bedingungen (die ihrerseits zu einem großen Teil auf frühere staatliche Entscheidungen zurückgehen). Zu diesen gehören in China
ein Gesundheitswesen, das bei allen vorher erwähnten Mängeln durch Privatisierung der Krankenhäuser und der Pharmaindustrie offenbar immerhin viele gut ausgebildete Mediziner und Pflegekräfte hervorgebracht hat; die Fähigkeit, Notfallkrankenhäuser extrem schnell zu bauen/zu organisieren;
die sofortige Verfügung über Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken (Bestände, die auch auf Basis der Sars- und Mers-Epidemien angelegt worden waren) bzw. die Produktionskapazitäten dafür und für eine große Menge an Testmaterial (z. T. eine positive, aber ungeplante Folge „globaler Arbeitsteilung“ mit der VR China als „Werkbank der Welt“);
ein zentralstaatlicher Entscheidungsapparat, dem im Großen und Ganzen sowohl die Provinzen gefolgt sind wie die staatlichen Betriebe; gesellschaftliche Organisationen (vor allem solche der Kommunistischen Partei), die wesentliche Funktionen in den Quartieren und im öffentlichen Raum übernommen haben (alle Haushalte aufsuchen, befragen und informieren, Menschen in Quarantäne versorgen);
ein Volk, das schon vorher ziemlich viel Wert auf seine Gesundheit gelegt hat und dem viele Maßnahmen – bei durchaus vorhandener Kritik an Behörden und Regierung – insgesamt sinnvoll erschienen und das seine Bedenken gegenüber staatlichen Überwachungsmaßnahmen nicht ausgerechnet im Fall einer Pandemie-Bekämpfung geltend gemacht hat.
Selbstverständlich ist bei all dem staatlicher Zwang (in Form der gesetzlichen Vorschriften und ihrer Durchsetzung beim Lockdown, beim Sperren von Grenzen, bei Quarantäne-Maßnahmen für Einheimische wie Ausländer usw.) festzustellen – qualitativ allerdings nicht anders, als das in westlichen Staaten auch gehandhabt wurde (bei den Ausgangssperren in Spanien, Italien und Frankreich, der Durchsetzung der ab Ende April in Deutschland eingeführten Maskenpflicht, beim Isolieren der Alten in ihren Heimen, im Fall überraschender Grenzschließungen durch einzelne Staaten, bei Polizeieinsätzen gegen feiernde Jugendliche).
Das kann auch nicht groß verwundern, sind doch in kapitalistischen Ökonomien alle Akteure dem Diktat der Konkurrenz unterworfen, so dass sie ohne staatlichen Zwang kaum Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit bzw. die ihrer Beschäftigten nehmen können. Deshalb muss – insbesondere im Fall von Seuchen – die nötige Vorsicht (eigentlich ein Gebot der Vernunft im Hinblick auf die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen) in dieser Art von Gesellschaft tatsächlich mit sanktionsbewehrten Verordnungen gegen alle durchgesetzt werden. Und was die staatliche Datenerfassung über die sogenannte „Gesundheits-App“ betrifft: Es ist kaum anzunehmen, dass China, seine asiatischen Nachbarn ebenso wie die westlichen Staaten bei dem, was sie über ihre Bürger erfahren wollen, ausgerechnet auf eine Pandemie angewiesen sind … Im Unterschied zu den westlichen Ländern fällt auf, wie sehr die chinesische Regierung in vielerlei Hinsicht ihre Bürger dabei unterstützt, gesundheitsbewusst zu handeln bzw. die unangenehm-einschränkenden Seiten der Pandemie-Politik durchzustehen. In westlichen Ländern wurde dagegen von Anfang an betont, dass es in der Eigenverantwortung der Menschen liegt, die Infektionszahlen zu senken, vor allem durch Unterlassen privater Mobilität und Einschränken privater Kontakte. Masken bzw. medizinische Schutzkleidung kostenlos zu verteilen (vgl. die im Januar 2021 gerade laufende Debatte darüber, dass Hartz-Bezieher sich die nun vorgeschriebenen FFP2-Masken nicht leisten können), Aufklärungssendungen über deren korrekte Handhabung, Arztpraxen bei der Trennung von Covid-Behandlungen vom Rest der Fälle zu unterstützen, die Arbeitszeit der Ärzte und Pflegekräfte unter den erschwerten Bedingungen zu senken, Quarantäne-Quartiere einzurichten (z. B. in den Hotels, die schließen mussten), Menschen, die allein leben, alt sind oder selbst nicht klarkommen, ausfindig zu machen und zu versorgen, im öffentlichen Raum und Transportwesen Fieber zu messen – alles sinnvolle und einsehbare Maßnahmen, die übrigens auch nichts mit Einschränkungen von Freiheitsrechten zu tun haben, finden dagegen nicht statt.
Auf Basis dieser Maßnahmen sind die Corona-Fälle in China massiv eingedämmt worden. China zählt bis heute (31.1.2021) ca. 100.000 Infizierte und unter 5.000 Todesfälle. Würde man die deutschen Zahlen auf die chinesische Bevölkerung hochrechnen, dann hätte China etwa 38 Millionen Infizierte und 960.000 Tote; nähme man die amerikanischen Zahlen, wären es mehr als 100 Millionen Infizierte und 1,7 Millionen Tote.
Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass der Verstädterungsgrad bei einer Pandemie eine wichtige Rolle spielt und dieser in China mit 60 % geringer liegt als der in Deutschlands (77 %) und den USA (82 %), sind das enorme Unterschiede.
Und auch dann, wenn Chinas Meldungen über die Zahl der (Nicht-)Infizierten und Todesfälle geschönt sind (was nicht auszuschließen ist), sind sie jedenfalls nicht entscheidend falsch: „Es gibt sicherlich eine unbekannte Dunkelziffer und nicht öffentlich gemachte Fälle, aber ich glaube nicht, dass wir uns da in den Zehntausenden bewegen. Das wäre bei aller Zensurkapazität nicht möglich. Allein schon wegen der vielen im Ausland lebenden Chinesen mit guten Kontakten ins Land“, berichtet das MERICS-Institut, das ansonsten kaum ein gutes Haar an China lässt. 27 In vielen anderen asiatischen Ländern (Japan, Taiwan, Südkorea, Vietnam, Singapur28) wurden ähnliche Maßnahmen in Kraft gesetzt und ähnliche Erfolge bei der Eindämmung erzielt; es ist allerdings auffällig, wie wenig öffentliches Interesse an Information und Diskussion dieser und insbesondere der chinesischen Erfahrungen im „aufgeklärten“ und „wissensorientierten“ Westen besteht. Einige Mediziner mögen sich über die Grenzen hinweg austauschen; ansonsten aber steht das Urteil über diesen Staat, den man als „systemischen Konkurrenten“ betrachtet, fest: China hat uns das Virus und seine üblen Folgen beschert29; es macht mit berechnenden Hilfsangeboten Politik (Italien, Spanien, Serbien) und bringt damit Unfrieden nach Europa. Von China etwas lernen oder gar übernehmen, das ist unter diesen Vorzeichen natürlich schlicht indiskutabel.30 Der Beijinger FAZ-Korrespondent Mark Siemons bezeichnet das als „Dünkel, der so viele im Westen davon abhielt, in der Pandemie von Ostasien zu lernen“ (FAZ 29.3.2020), der Schweizer Arzt Paul Vogt nennt das westliche, speziell das europäische Verhalten „arrogant, ignorant und besserwisserisch“.31 Es ist dies das Selbstbewusstsein von Staaten und ihren nationalistischen Anhänger_innen, die für sich in Anspruch nehmen, dass ihr ökonomischer und politischer Erfolg in der Welt von Geschäft und Gewalt damit zusammenfällt, dass sie in allen Fragen richtig liegen – in der Herrschaftsausübung, bei den Werten, in der Kultur.
Indes schwindet die Grundlage für dieses Selbstbewusstsein westlicher Nationalisten etwas: Weltweit sind die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) laut UNCTAD im vergangenen Jahr wegen der ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie um 42 Prozent auf geschätzte 859 Milliarden US-Dollar gefallen. China war 2020 mit 169 Mrd. US-Dollar erstmals das größte Empfängerland für ausländische Direktinvestitionen; davor hatten die USA diese Spitzenposition über Jahrzehnte inne. Dort brachen die FDI um 49 Prozent auf rund 134 Mrd. US-Dollar ein, in Deutschland sogar um 61 Prozent.32 Dass der unangenehme Konkurrent aus Asien mit seiner raschen Bewältigung von Corona der einzige größere Staat ist, der für 2020 ein Wirtschaftswachstum aufzuweisen hat (und damit übrigens deutsche Exporterfolge trotz Krise ermöglicht) und mit seinem für 2021 prognostizierten Wachstum weiter die „Weltkonjunkturlokomotive“ sein wird, wird die Meinung über ihn nicht verbessern – im Gegenteil.