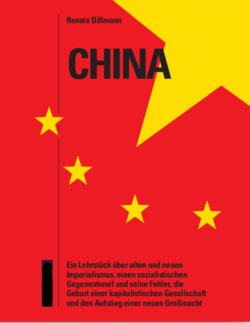Читать книгу China – ein Lehrstück - Renate Dr. Dillmann - Страница 25
Der Zusammenhang von Geschäft und Gewalt in China
ОглавлениеWer sich ernsthaft erklären will, warum die staatliche Gewaltanwendung in China oft härter und anders ausfällt als in den westlichen Demokratien und nicht mit Erklärungen zufrieden ist, die den Grund in Herrscherfiguren suchen (der aktuelle Staatspräsident Xi Jinping bspw. wird als besonders autoritäre Persönlichkeit gehandelt), muss seinen Blick auf das aktuelle Staatsprogramm richten.
Die Einführung des Kapitalismus in China beinhaltet nicht weniger als die erneute Einführung einer Klassengesellschaft: Es gibt nun diejenigen, die fremde Arbeitskraft erfolgreich anwenden, deren Leistungen aneignen und seitdem gut davon leben (darüber handelt Kapitel 7 im zweiten Teil des Buchs). Für die meisten anderen aber gilt: Sie haben in den letzten Jahren ihre alten, vielleicht bescheidenen, aber doch zumindest überlebenstauglichen Ansprüche als sozialistische Bauern oder Werktätige verloren und sind in eine Freiheit der Konkurrenz geworfen, für die sie keine Mittel haben; für sie wird „das Leben“ wieder – wie weltweit üblich – ein „Kampf“.
Dieses Programm ist der Sache nach eine gewaltsame Angelegenheit, weil damit die Freiheit der Konkurrenz um Eigentum in diesem Land etabliert wird.
Zugespitzt könnte man sagen: Gerade weil in China Freiheit durchgesetzt wird (Freiheit des Eigentums), ist so viel Zwang notwendig. Überall werden gesellschaftliche Gegensätze der härteren Art aufgeworfen (es ist eben nicht so, dass die staatliche „Unterdrückung“ vorwiegend bei den Künstlern und Journalisten zuschlägt – wie es sich die Linken oft vorstellen). Beispiele: Bauern werden gezwungen, die Enteignung des ihnen vorher zugesprochenen Landes zugunsten von Gewerbeflächen anzuerkennen; Anwohner sollen die Existenz einer giftigen Chemie-Fabrik und die für deren Rentabilität notwendige Verseuchung der Flüsse akzeptieren, Wanderarbeiter rebellieren wegen nicht gezahlter Löhne usw. usf. Das ist der Grund dafür, dass der Einsatz staatlicher Gewalt gegenüber dem Volk im Zuge der flächendeckenden Ausbreitung marktwirtschaftlicher Prinzipien nicht geringer geworden ist, sondern ganz im Gegenteil stetig zugenommen hat – ein Zusammenhang, den die Freunde der Marktwirtschaft nie so gern erkennen wollen: Wie notwendig Gewalt zu dieser Produktionsweise gehört, in der um Eigentum konkurriert wird! Wenn westliche Stimmen bedauern, dass in China „trotz wirtschaftlicher Öffnung keine politische Liberalisierung“ zu verzeichnen sei, würden chinesische Politiker insofern antworten, dass das gerade wegen der wirtschaftlichen Öffnung und ihren Risiken innen wie außen nicht sein könne (vgl. dazu das Kapitel zum „Jahr 1989“ im zweiten Teil des Buchs). Die erste Option der chinesischen Führung angesichts zunehmender Beschwerden (die Zahl der Arbeitskonflikte und anderer gesellschaftlicher Auseinandersetzungen steigt rapide an), besteht im Niederschlagen dieser Proteste, wo immer sie sich rühren. Auf der anderen Seite versucht die Beijinger Zentralregierung zu unterscheiden, wo die Beschwerden ökonomischen oder politischen Zuständen gelten, die sie selbst als dysfunktional einstuft (Fälle von Sklavenarbeit will sie z. B. nicht haben in ihrem Land und hat selbst eine Pressekampagne dagegen gestartet. Oder die Fälle von unrechtmäßiger Enteignung von Bauern durch ihre eigenen Parteifunktionäre, die sie als „Korruption“ verfolgt; usw.).
Sie versucht also, allgemein gesagt, systemnötige von unnötiger, bloß „persönlicher“ Brutalität bzw. illegaler „Habsucht“ zu trennen. Solche Versuche haben allerdings notwendig den Charakter eines Kampfs gegen Windmühlen. Schließlich sind die „Auswüchse“ die Konsequenzen eines Prinzips – Produktion für Profit –, das ausdrücklich von der Regierung selbst gewünscht ist und das deshalb immer wieder (und natürlich nicht nur in China! Man denke an die deutschen Schlachthof-Arbeiter!) diese Art von „Skandalen“ hervorbringen wird.
Auf die unvermeidlichen Verwerfungen bei der Einführung der kapitalistischen Staatsräson und auf ihre hässlichen Dauerphänomene deuten die westlichen Kritiker mit ihrem menschenrechtlichen Zeigefinger und rühmen sich ihrer „Zivilgesellschaften“.
Es ist allerdings so, dass die westlichen Staaten ihren Weg hin zu „etablierten Weltmächten“ sicher nicht mit den sprichwörtlich „gewaltfreien Diskursen“ gemacht haben. Sie haben erstmals ganze Arbeitergenerationen verschlissen und Widerstand aller Art, Klassenkampf, regionalen Separatismus usw. gewaltsam niedergemacht; dann haben sie sich nach langen Kämpfen, in denen sie die Protagonisten von Gewerkschaften, SPD und Kommunisten verfolgt und kaltgestellt haben, ein paar Rücksichtnahmen auf die Arbeiter und deren Lebensnotwendigkeit als funktionale Maßnahmen zur effektiven Indienstnahme des Proletariats einleuchten lassen, um heute, wo die angefeindete „Systemalternative“ nicht mehr existiert, ihren Sozialstaat von allen „unnötigen Kosten“ zu befreien oder ihn selbst zur Geschäftssphäre umzugestalten. Von Kriegen, faschistischen Sonderetappen und deren erzieherischer Wirkung auf die Arbeiterklasse gar nicht zu reden. Politisch sind Geheimdienste, Partei- und Berufsverbote, die Verfolgung und Drangsalierung abweichender Standpunkte und Personen etc. in den menschenrechtlich perfekten Demokratien fest beheimatet. Wenn auf dieser Basis alles fest im Griff der Herrschaft ist und auch die Beherrschten im Staat die unerlässliche Bedingung ihrer zur Konkurrenz genötigten Existenz begreifen, sodass sie sich als Patrioten für den Erfolg der Nation interessieren, gibt es tatsächlich Wahlen und Meinungs- und Pressefreiheit! Und letztere funktioniert tatsächlich auch noch ganz von selbst und viel besser als jede Zensur. So nämlich, dass sie politische Einreden, die nicht die konstruktive Sorge um den Erfolg der Nation zum Inhalt haben, wie von selbst als nicht befassungswürdig totschweigt oder ins Leere laufen lässt – von gestern, unrealistisch, utopisch … heißt es dann.
Das theoretisch Unlautere an den entsprechenden Vorwürfen an die Adresse Chinas ist ein sehr schräger Vergleich: Die eine Seite des Vergleichs betrifft ein Land, das damit befasst ist, mit aller dafür nötigen Gewalt den Maßstab kapitalistischer Gewinnproduktion zur gültigen gesellschaftlichen Maxime zu machen und die dazu passende Zentralgewalt herzustellen. Die andere sind Staatswesen, die genau das die letzten 200 Jahre mit aller Härte durchgesetzt, ihre Gesellschaften von A – Z gleichgeschaltet und jede Art von Interessenverfolgung auf sich, ihr Recht und ihr demokratisches Procedere verpflichtet haben und die zu Nutznießern der von ihnen geschaffenen Weltordnung samt ihres Weltmarkts geworden sind. Deren Propagandisten rechnen China die notwendigen Gewaltakte seiner „ursprünglichen Akkumulation“ vor, die ihre Staaten so erfolgreich schon lange hinter sich gebracht haben – das ist ebenso selbstgerecht wie verlogen.
Soviel in aller Kürze zu Gemeinsamkeit und Unterschied dieser beiden Varianten kapitalistischer Staaten. Die Vergleiche, die üblicherweise angestellt werden, sind anderer Art. Die Gemeinsamkeit kommt gar nicht erst in den Blick; stattdessen vermisst man am chinesischen Staat alles (angeblich) Wesentliche: Wahlen, Parteien, Opposition 52, freie Presse, Demonstrationen etc. Das Interessante: Die Messlatte dieses Vergleichs liegt – ebenso selbstverständlich wie selbstbewusst – „bei uns“, im politischen System der westlichen Länder.
Einerseits ist das die bornierte Art, in der Nationalisten immer über „das Eigene“ und „das Fremde“ urteilen. Andererseits haben die westlichen Nationen ihre historisch besondere Art der Herrschaftsorganisation von Anfang an als universelles Prinzip deklariert: Menschenrechte. Ausgerechnet diese harte Anmaßung wird überhaupt nicht als solche wahrgenommen – ganz im Gegenteil. Auf dem Feld der Menschenrechte in China (!) finden Linke und deutsche Politik ganz gut zusammen, auch wenn sie Verschiedenes meinen.
Politiker in den westlichen Erfolgs-Staaten sind nämlich (im Unterschied zu Journalisten und Linken) keine Demokratie-Idealisten; das ist unschwer daran zu erkennen, dass sie problemlos mit Autokraten und Diktatoren zusammenarbeiten und, solange diese Zusammenarbeit klappt, menschenrechtliche Verbesserungen und bürgerrechtliche Reformen kein Anliegen ihrer Außenpolitiker und Diplomaten darstellen.53 Diese Überlegung führt zur Rolle der Menschenrechtsdiplomatie im Verhältnis zu China. In diesem Fall hat man es mit einem Staatswesen zu tun, auf das die westliche Außenpolitik wenig Einfluss hat. China ist nicht eingeordnet in die westlichen Allianzen, steht westlichen Initiativen distanziert und frei kalkulierend gegenüber und verfolgt seine eigenen Anliegen „mit zunehmendem Selbstbewusstsein“, wie die hiesige Presse etwas verärgert feststellt. Anders formuliert: In diesem Land vermisst man die üblichen Einflussmöglichkeiten für westliche Interessen. NGOs54 werden inzwischen von den chinesischen Behörden registriert und in ihren Aktivitäten kontrolliert; es gibt keine oppositionellen Parteien oder Gruppierungen, die man fördern oder bestechen könnte, um den eigenen Interessen Einfluss zu verschaffen, kurz: es herrscht „Betonkommunismus“. Das zu durchbrechen und über Kanäle, wie sie in anderen Ländern üblich sind, den westlichen Berechnungen einen Weg in den politischen Betrieb der Volksrepublik zu bahnen – das ist der tiefer liegende Kern der westlichen Menschenrechts-Bemühungen.
Davon wollen Linke allerdings nichts wissen, wenn sie sich mit ihrer Regierung gegen den „gruseligen“ chinesischen Staat zusammenschließen. Sie werfen der Politik höchstens vor, dass sie sich in ihrem Kampf für Menschenrechte mal wieder durch miese ökonomische Berechnungen bremsen lässt. Und die ehemals friedensbewegten Grünen machen mit Menschenrechts-Vorwürfen zurzeit den ideologischen Vorreiter im neuen Kalten Krieg gegen die Volksrepublik. Da kommt für sie ganz ideal viel zusammen: Sie beweisen realpolitischen Durchsetzungswillen, und treten gleichzeitig im Namen höchster Werte an – gegen ein Land, das dem deutschen Ehrgeiz in Sachen Weltgeltung erheblich zu schaffen macht.