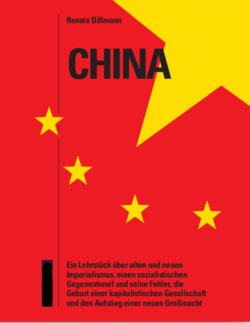Читать книгу China – ein Lehrstück - Renate Dr. Dillmann - Страница 34
Kapitel 2
Die Kommunistische Partei – Programm und Durchsetzung
ОглавлениеAm 1. Oktober 1949 wird in Beijing die Gründung der Volksrepublik China ausgerufen. Im Unterschied zum Überraschungscoup der Bolschewiki 1917 in Russland ist dies das Resultat eines gewonnenen Bürgerkriegs und einer Behauptung gegen auswärtige Mächte. Was die russischen Revolutionäre nach der Oktoberrevolution noch zu bestehen hatten – Krieg gegen Konterrevolution und imperialistische Invasion –, hat die Armee der »Roten« in China bereits erfolgreich hinter sich gebracht.
Die Kommunistische Partei Chinas wird 1921 von einer Handvoll Intellektueller gegründet. Zu ihrem ersten Kongress im Juli 1921 kommen 13 Abgeordnete, die insgesamt 57 Mitglieder (!) vertreten. Mit Blick auf die eigene schwache Ausgangssituation sucht die KP von Beginn an ein Bündnis mit der Guomindang Sun Yatsens. Die KP sieht sich selbst als »Avantgarde des Proletariats«, die für »die Befreiung der Arbeiterklasse und für die proletarische Revolution«13 kämpft. Der Guomindang erkennt sie die Rolle einer zwar bürgerlichen, aber doch auch »revolutionären Partei« beim Aufbau eines unabhängigen und entwickelten China und damit die Erledigung einer »historischen Mission« zu. Die Kommunisten kritisieren allerdings an der GMD, dass sie der Aufgabe, die sie ihr zugedacht haben, nicht wirklich gerecht wird: Sie bekämpfe den imperialistischen Einfluss in China nur halbherzig und wolle sich im Innern lediglich militärisch durchsetzen, »statt« die soziale Frage anzugehen. Deshalb wollen die Kommunisten den Kampf der Guomindang einerseits unterstützen und gleichzeitig durch ihre Einflussnahme soweit wie möglich in ihrem Sinn radikalisieren. Das Bündnis soll vor allem sie selbst stark genug machen, damit sie die Auseinandersetzung um die letztendliche Ausgestaltung eines befreiten China gewinnen können. Dem Vorschlag der Komintern (3. Kommunistische Internationale) folgend tritt die KP deshalb 1923 in ein Volksfront-Bündnis mit der GMD ein. Schwartz/Fairbank 1955: 49f.
»Aus dieser Lage kann es keine Rettung geben, wenn China sich nicht selbst aufrafft zu einer das ganze Land umfassenden Bewegung für das Selbstbestimmungsrecht des Volkes. (...) Wir hoffen immer noch, dass alle revolutionären Elemente unserer Gesellschaft zur GMD stoßen werden, um den Sieg der nationalen Revolutionsbewegung zu beschleunigen. Gleichzeitig hoffen wir, dass die GMD entschlossen ihre beiden bisherigen Leitgedanken, das Vertrauen zum Ausland und die Konzentration auf die militärische Gewalt, fallen lässt. (...) Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse des In- und Auslandes sowie der Leiden und Nöte derjenigen Klassen der chinesischen Gesellschaft (Arbeiter, Bauern, Industrielle und Kaufleute), die dringend die nationale Revolution brauchen, vergisst die KPCh keinen Augenblick, dass sie die Interessen der Arbeiter und Bauern vertritt. (...) Es ist unsere Sendung, die unterdrückte chinesische Nation durch eine nationale Revolution zu befreien und zur Weltrevolution fortzuschreiten, welche die unterdrückten Völker und die unterdrückten Klassen der ganzen Welt befreien wird.
Es lebe die nationale Revolution Chinas!
Es lebe die Befreiung der unterdrückten Völker der Welt!
Es lebe die Befreiung der unterdrückten Klassen der Welt!«
Manifest des Dritten Nationalkongresses der KPCh, Juni 1923, zit. nach Brandt/Schwartz/Fairbank 1955: 49f.
Befreiung der Nation und Befreiung der unterdrückten Klassen gehören für die chinesischen Kommunisten also zusammen. Und sie kennen eine klare Reihenfolge in der Erreichung dieser Ziele: Die nationale Revolution gilt ihnen als entscheidende Voraussetzung, um das Elend der unterdrückten Klassen beenden zu können.
Damit verknüpfen die chinesischen Revolutionäre programmatisch zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, ja sogar einen regelrechten Widerspruch beinhalten: Kommunismus und Nationalismus. Die Befreiung Chinas von den ausländischen Mächten ist ein Kampf um die Souveränität einer Nation. In ihm treten die Kommunisten als chinesische Patrioten an, die sich als solche mit den bürgerlichen Kräften und der nationalen Bourgeoisie zusammenschließen. Das Resultat dieses Kampfs – ein freies und geeintes China – soll der erste und entscheidende Schritt zur Lösung aller weiteren Fragen sein, die sie als Kommunisten aufwerfen und lösen wollen. Der Grund für die elenden Zustände der chinesischen Massen, die sie als kommunistische Opposition kritisieren und praktisch überwinden wollen, liegt allerdings nicht in einer Fremdherrschaft auswärtiger Mächte, sondern in den herrschaftlich festgeklopften Produktionsverhältnissen, denen Bauern und Arbeiter unterworfen sind und in denen sie ausgebeutet werden: Grundeigentum auf dem Land, kapitalistische Produktion in den Städten. Vom Standpunkt einer kommunistischen Bewegung muss also diese Eigentumsordnung beseitigt werden, um eine geplante Produktion zum Nutzen aller Produzenten einzurichten. Die Nationalität der Grundbesitzer bzw. Eigentümer – ob Japaner, Deutsche oder Chinesen – ist für diesen Kampf ganz und gar gleichgültig; sie wird allenfalls dann interessant, wenn imperialistische Staaten die Beschneidung der Eigentümerinteressen ihrer Bürger nicht hinnehmen und gewaltsam intervenieren. Aber auch in dem Fall wäre nicht eine Nation zu verteidigen, sondern das, was sich die Revolutionäre erkämpft haben: Die Freiheit, sich ein Leben zu ihrem Nutzen einzurichten.
In ihrem »Manifest« gestehen die chinesischen Kommunisten selbst unfreiwillig ein, dass in ihrem Entschluss zur »nationalen Einheitsfront« ein Widerspruch steckt. Sie beteuern ausdrücklich, die Interessen der Arbeiter und Bauern nicht darüber vergessen zu wollen, dass sie sich zunächst einmal für die nationale Revolution stark machen. Warum ist diese Versicherung nötig? Offensichtlich deshalb, weil die nationale Befreiung, die angeblich alle Klassen der chinesischen Gesellschaft »brauchen«, gar nicht ohne Weiteres zusammenfällt mit den Interessen der Arbeiter und Bauern bzw. der kommunistischen Kritik an ihrer bisherigen ökonomischen Ausbeutung und ihrer Unterdrückung durch den Staatsapparat. Der Parole zur weltrevolutionären Befreiung »aller unterdrückten Völker« wird deshalb auch noch die von der Befreiung »aller unterdrückten Klassen« hinterher geschickt – auch das ein deutlicher Hinweis, dass es sich dabei um zwei verschiedene Paar Stiefel handelt und die Befreiung der unterdrückten Klassen noch in gar keiner Weise eingeleitet ist, wenn ein Volk »sich selbst bestimmt«. Die chinesischen Kommunisten peilen mit ihren Beteuerungen und Windungen allerdings genau die umgekehrte Aussage an. Sie behaupten, dass es keinen gravierenden Gegensatz gibt zwischen der Sache der Nation und ihrem kommunistischen Programm, sondern dass im Gegenteil beides zusammenpasst und unverbrüchlich zusammengehört.
Sehr unbefangen schreibt sich die chinesische KP also beides zugleich auf die Fahnen: Kommunismus und Nationalismus, Befreiung der Massen von Ausbeutung und Befreiung der Nation von äußeren und inneren Fesseln. So wenig sie theoretisch etwas von der Unverträglichkeit beider Ziele wissen bzw. gelten lassen will, so sehr macht sich diese in ihrer praktischen Verfolgung derselben immer wieder geltend. Um den Nachvollzug der Darstellung dieser widersprüchlichen Politik und ihrer Verlaufsformen in den Jahrzehnten des sozialistischen Aufbaus zu erleichtern, seien einige grundsätzliche Überlegungen zur notwendigen Unverträglichkeit von Kommunismus und Nationalismus vorangestellt (die auch zur Kritik anderer sozialistischer Staatsprojekte der bisherigen Geschichte ermuntern wollen).