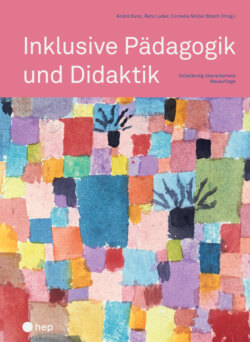Читать книгу Inklusive Pädagogik und Didaktik (E-Book, Neuauflage) - Reto Luder - Страница 26
Professionelle Zusammenarbeit für eine interdisziplinäre Förderplanung
ОглавлениеProfessionelle Zusammenarbeit
Ein Förderplanungsprozess wird meist in multiprofessioneller Zusammenarbeit geleistet. Dabei sind neben der Lehrperson auch die Eltern und eine schulische Heilpädagogin oder ein Therapeut. In vielen Fällen ist es sinnvoll, das betroffene Kind oder die betroffenen Jugendlichen selbst in die Förderplanung einzubeziehen. Inklusive Förderplanung ist anspruchsvoll. In der Praxis werden die Lernsituationen von unterschiedlichen Beteiligten auch sehr unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert. Besonders bei Vorschlägen, was wie gefördert werden sollte, ist man sich oft nicht einig. Analysiert man Förderpläne, so sieht man, dass es bei den vorgeschlagenen Maßnahmen oft weniger auf inhaltliche Tatsachen wie die Probleme des Kindes und die angestrebten Ziele ankommt als auf die persönlichen Vorlieben der beteiligten Personen oder darauf, welche Maßnahmen gerade verfügbar sind (McCormack, Pearson & Paratore, 2007; Luder, Ideli & Kunz, 2020). Zudem ist die Frage wichtig, ob und wie sich einzelne Beteiligte mit ihren Ideen für die Förderung im Team durchsetzen oder eben nicht (Edmondson, 2020). Zentrale Grundlagen für gelingende Zusammenarbeit sind willentliche, aufgabenbezogene, auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtete und mit einem gegenseitigen Vertrauensvorschuss gemeinsam durchgeführte Handlungen (Spieß, 2004). Dabei sind gegenseitige Autonomiegewährung, Vertrauen, Empathie, gegenseitige Wertschätzung und wechselseitige Kommunikation entscheidend (Axelrod, 2005; Spieß, 2004; Tomasello, 2012). Merkmale erfolgreicher Teams sind seit Längerem bekannt (z. B. Francis & Young, 1998, S. 19): Leistungsfähigkeit durch Stärkeergänzung, allen Mitgliedern bekannte Zielsetzungen, Dynamik im Sinne gegenseitigen Ansporns, Struktur durch Regelung von Führungsansprüchen, Arbeitsstil, Organisation und Rollenverständnis sowie ein vertrauensvolles Klima. Google konnte im Rahmen des Forschungsprojekts «Aristotle» ebenfalls Faktoren aufzeigen, die erfolgreiche Teams ausmachen (Google, 2020):
— Psychologische Sicherheit (vgl. dazu Edmondson, 1999): Gemeint ist damit ein Klima, in dem sich die Teammitglieder trauen, nachzufragen, Fehler offen zuzugeben, in dem sie sich wohlfühlen und zusammenarbeiten, ohne Angst, sich zu blamieren.
— Verlässlichkeit: Arbeiten rechtzeitig und mit hoher Qualität zu erledigen, erhöht den Erfolg.
— Struktur und Klarheit: Klärung von Zielen, Aufgaben und Rollen vermitteln Struktur und Sicherheit.
— Bedeutsamkeit: Arbeit, die jedem Teammitglied persönlich wichtig ist, erhöht die Bereitschaft, sein Bestes zu geben.
— Sinnhaftigkeit: Die Haltung, dass die eigene Arbeit zu einem Erfolg führen kann, der auf ein gemeinsames Ziel orientiert ist, wird durch sinnhafte Tätigkeit befördert.
Daraus lässt sich ableiten, dass man erstens die eigene Arbeit als Lernaufgabe betrachten und sich darüber klar sein soll, dass es immer auch große Unsicherheiten gibt. Zweitens ist es wichtig, die eigene Fehlerhaftigkeit zu (be-)achten. Dies erlaubt es, offen zu sprechen. Und drittens hilft Neugierde bei der Suche nach (neuen) Lösungen.
Verschiedene Arbeiten liefern Hinweise, wie gute Förderplanung (nun verstanden als Lernaufgabe des Förderteams) aussehen könnte (z. B. Thomas, 1998; Sopko, 2003). Ein wichtiger Punkt dabei ist es, die vier generellen Schritte im Prozess der Förderplanung stimmig und sinnvoll miteinander zu verbinden (Suhrweier & Hetzner, 1993; Buholzer, 2006). Es lassen sich allein aus der diagnostischen Erfassung von Lernvoraussetzungen nicht einfach Förderziele oder Maßnahmen direkt ableiten. «Förderziele sind kein Ergebnis von Diagnostik, sondern Resultat einer ‹Abmachung›, in die unter anderem auch Kontextfaktoren, normative Beurteilungen und persönliche Ansichten der beteiligten Personen einfließen» (Kunz et al., 2012, S. 7). → Siehe auch Beitrag von Hollenweger. Sowohl objektive Fakten und verlässliche Informationen als auch subjektive Einschätzungen und gemeinsame «Abmachungen» sind nötig für eine Förderplanungsarbeit. Und erst in der sinnvollen Kombination von beidem entsteht eine Förderplanung, die der Situation gerecht werden kann. Dies ist eine höchst interdisziplinäre Aufgabe und bezieht auch die Eltern mit ein.