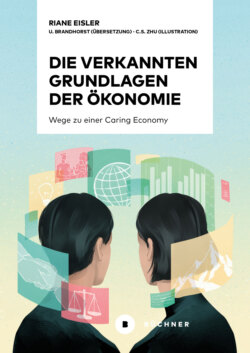Читать книгу Die verkannten Grundlagen der Ökonomie - Riane Eisler - Страница 11
1.1 Womit sich die Ökonomie eigentlich beschäftigen sollte
ОглавлениеIm Herbst 2004 wurde ich von der Dag Hammarskjöld-Stiftung zu einem Forschungsworkshop zur Zukunft der Wirtschaft eingeladen. Die Veranstaltung fand im Haus meiner langjährigen Freundin und Kollegin Hazel Henderson statt, die zu den Vorreiterinnen auf dem Weg zu einer neuen Art des Wirtschaftens gehört. Die 25 Teilnehmenden, darunter gegenwärtige wie ehemalige Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, sozialen Bewegungen und Regierungspolitik, kamen aus Lateinamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien und den USA.
Ausgangspunkt unserer Diskussion war eine Kritik an der sogenannten Neoklassik, also der heute vorherrschenden und oft einzigen Wirtschaftstheorie, die an westlichen Universitäten gelehrt wird. Diese Theorie hat sich aus den früheren klassischen Wirtschaftstheorien von Adam Smith, David Ricardo und anderen »Vätern« der modernen Kapitalismuslehre heraus entwickelt. Sie beschäftigt sich vornehmlich mit der Analyse und Vorhersage dessen, wie der Markt funktioniert. Dabei bedient sie sich hauptsächlich mathematischer Modelle, die eine Art geschlossenen Kreislauf bilden und auf grundlegenden, ja als unantastbar geltenden Annahmen beruhen.
Zu diesen Annahmen gehört unter anderem die Vorstellung eines Homo oeconomicus, der auf Basis rationaler Eigeninteressen fundierte Entscheidungen trifft. Hinzu kommt die Vorstellung, dass der Wettbewerb diese auf Eigeninteressen basierenden Entscheidungen in einer sich selbst organisierenden Dynamik reguliert, was letztendlich dem Allgemeinwohl zugutekäme. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Regierung sich nicht in das Marktgeschehen einmischen solle – eine Ansicht, die als das eigentliche Kernstück der aktuellsten neoklassischen Theorie, dem sogenannten Neoliberalismus, betrachtet werden kann. Diese Theorie wird weltweit von den Vertretern des Neokonservativismus propagiert, die Privatisierungen, Deregulierungen der Märkte und einen von Nationalgrenzen und Nationalinteressen ungehinderten Handel als Wundermittel gegen alle unsere Probleme ansehen.
Zunächst lag der Schwerpunkt des Forschungstreffens der Hammarskjöld-Stiftung darauf, die Defizite der neoklassischen und neoliberalen Wirtschaftstheorien und -modelle zu benennen. Einige Teilnehmende erklärten, dass diese Modelle nicht mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang zu bringen seien und verwiesen dabei auf Forschungsarbeiten aus der Physik, die Fehler in den computergestützten Analysemethoden und den orthodoxen Wirtschaftsmodellrechnungen offengelegt haben. Diese reduktionistischen Methoden, so ihre Schlussfolgerung, führten zu einem verzerrten Bild der Wirklichkeit. Andere Teilnehmer zeigten auf, wie Märkte heute massiv durch ausgeklügelte Marketingstrategien manipuliert werden, die künstliche Vorlieben und sogar künstliche Bedürfnisse schaffen. Auch die Prämisse, dass Wettbewerb den Markt reguliert, wurde infrage gestellt. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass überall auf der Welt Großkonzerne kleinere Firmen durch Übernahme bzw. Aufkauf schlucken oder sie durch Preisdruck in den Ruin treiben.
Die Diskussion ging dann von der Wirtschaftstheorie zur aktuellen Weltlage über. Viele Teilnehmende kritisierten zum einen den Trend zur Privatisierung von Trinkwasser und anderen lebensnotwendigen Gütern, zum anderen die Anhäufung von immer mehr Vermögen und Macht in multinationalen Konzernen und bei wenigen Superreichen. Andere beanstandeten die fehlende Rechenschaftspflicht für Akteure der Globalisierung (wie zum Beispiel Unternehmen) und internationale Handelsverträge oder das fatale Ausblenden der Umweltzerstörung. Außerdem wurden Neuerungen gefordert, wie zum Beispiel messbare Indikatoren für Lebensqualität (wie der Glücksindex im Königreich Bhutan), aber auch internationale Gerichtshöfe für Produkthaftung sowie neue Lehrbücher und Kurse, in denen alternative ökonomische Sichtweisen dargestellt werden.
Im Laufe der Diskussion wurde allerdings noch etwas anderes immer deutlicher: Trotz zahlreicher gemeinsamer Bedenken und Kritiken gab es in einem Punkt große Unstimmigkeit – und zwar bei der Frage, welchen Bereich die Wirtschaft umfasst bzw. umfassen sollte.
Einige Teilnehmende interessierten sich – ebenso wie die etablierten Wirtschaftswissenschaftler, an denen sie Kritik übten – nur für den schmalen Bereich der ökonomischen Beziehungen innerhalb der Marktwirtschaft. Sie lehnten ökonomische Modelle strikt ab, wenn in diesen auch unbezahlte Care-Arbeit berücksichtigt wurde, die vornehmlich in Privathaushalten und anderen nicht monetären Wirtschaftsbereichen geleistet wird.10 Dies rechtfertigten sie zunächst damit, dass diese Arbeit nicht quantitativ erfassbar sei. Als darauf hingewiesen wurde, dass dies durchaus möglich sei und bereits getan würde, blieben sie dennoch einmütig dabei, dass diese Arbeit nicht miteinbezogen werden solle.11 Während sie sich einerseits also durchaus im Klaren darüber waren, dass fehlerhafte Wirtschaftsmodelle zu fehlerhafter Wirtschaftspolitik führen, machten sie andererseits deutlich, dass sie kein Interesse daran hatten, den Wirtschaftsbegriff auszuweiten oder gar neu zu definieren.
Doch diese Ausweitung und Neudefinition ökonomischer Modelle findet bereits statt. Seit geraumer Zeit haben weltweit Tausende von Männern und Frauen auf die Absurdität hingewiesen, dass die elementarste menschliche Tätigkeit in der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaftsgesetzgebung völlig ausgeblendet wird. Bereits 1988 veröffentlichte Marilyn Waring ein bahnbrechendes Buch zu diesem Thema.12 Seitdem haben auch Barbara Brandt, Ann Crittenden, Marianne Ferber, Nancy Folbre, Janet Gornick, Heidi Hartmann, Hazel Henderson, Marcia Meyers, Julie Nelson, Hilkka Pietilä, Genevieve Vaughan und weitere Wirtschaftswissenschaftlerinnen vehement darauf hingewiesen, dass Care-Arbeit in der Wirtschaftstheorie und -praxis berücksichtigt werden muss.13 Weitere Vordenker, wie zum Beispiel Edgar Cahn, Nirmala Banerjee, Herman Daly, Devaki Jain, David Korten, Paul Krugman, Amartya Sen und Thomas Piketty, weisen nachdrücklich darauf hin, dass wir ökonomische Beziehungen aus einem weiteren Blickwinkel heraus betrachten müssen.14 Ihre Arbeiten, besonders die von Pietilä und Henderson, bilden die Grundlage für das erweiterte ökonomische Modell, das für eine Caring Economy notwendig ist.