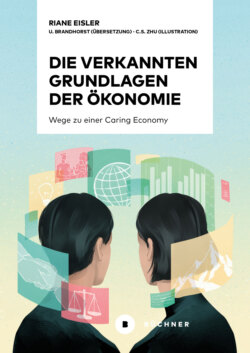Читать книгу Die verkannten Grundlagen der Ökonomie - Riane Eisler - Страница 20
2.2 Das Dominanz- und das Partnerschaftssystem
ОглавлениеIn Dominanzsystemen gibt es in Beziehungen nur zwei Möglichkeiten: Man ist übergeordnet oder untergeordnet. Die Übergeordneten kontrollieren die Untergeordneten – sei es in der Familie, am Arbeitsplatz oder in der Gesellschaft. Wirtschaftspolitik und -praxis sind darauf ausgerichtet, den Übergeordneten auf Kosten der Untergeordneten Vorteile zu verschaffen. Es herrschen hohe Anspannung und ein Mangel an Vertrauen, weil das System vornehmlich durch Angst und Zwang aufrechterhalten wird.
Fürsorge und Mitgefühl müssen unterdrückt und abgewertet werden, um die Hierarchien aufrechtzuerhalten. Das beginnt in den Familien und reicht bis in Politik und Wirtschaft. Aus diesem Grund besteht einer der Grundpfeiler einer Caring Economy aus Überzeugungen und Institutionen, die sich stärker an einem Partnerschaftssystem orientieren.
In einem Partnerschaftssystem werden Beziehungen gestärkt, die von gegenseitigem Respekt und Fürsorge geprägt sind. Auch hier gibt es Hierarchien, um die Funktionalität des Systems zu wahren, aber ich nenne diese Hierarchien »funktionelle Hierarchien«4, denn anders als bei »dominanzgeprägten Hierarchien«5 gelten Rechenschaftspflicht und Respekt hier wechselseitig und nicht nur von unten nach oben. Außerdem sind die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen so gestaltet, dass alle Ebenen teilhaben und Einfluss nehmen können. In einem Partnerschaftssystem ermutigen, inspirieren und stärken Führungskräfte, anstatt zu kontrollieren und zu schwächen. Wirtschaftspolitik und -praxis in einem Partnerschaftssystem sind darauf ausgerichtet, unseren überlebensnotwendigen Grundbedürfnissen sowie unserem Bedürfnis nach Gemeinschaft, Kreativität, Sinnhaftigkeit und Fürsorge – oder anders ausgedrückt: der bestmöglichen Entfaltung unseres menschlichen Potenzials – gerecht zu werden.
Keine reale Gesellschaft beruht auf einem reinen Partnerschafts- oder Dominanzsystem, sondern enthält immer Anteile beider Systeme. Dennoch ist die allgemeine Lebensqualität in Ländern, die sich an einem Partnerschaftssystem orientieren, höher als in Ländern, die mehr Anteile eines Dominanzsystems aufweisen – wie im Folgenden am Beispiel der nordeuropäischen Länder gezeigt wird. Und das ist kein Zufall – es ist bekannt, dass in den Ländern des Nordens Fürsorge und Care-Arbeit durch die Politik sichtbar gemacht und wertgeschätzt werden.
In den aktuellen Wirtschaftsmodellen gibt es zwar partnerschaftliche Elemente – doch viele unserer globalen Probleme resultieren daraus, dass sowohl kapitalistische als auch kommunistische Wirtschaftssysteme stark dominanzgeprägt sind.
Obwohl es große Unterschiede zwischen kapitalistischen und kommunistischen Wirtschaftssystemen gibt, werden in beiden sowohl die natürlichen Ressourcen als auch die Produktionsmittel von »den Oberen« kontrolliert – was auf Mensch und Natur gleichermaßen negative Auswirkungen hat. Im Sowjet-Kommunismus übten das politische Establishment sowie die großen, von der Regierung gelenkten Staatsbetriebe eine hierarchische, auf Angst und Zwang basierende Kontrolle aus und verursachten Umweltprobleme, deren bekanntestes Beispiel die Tschernobyl-Katastrophe darstellt. Auch im aktuellen, an den USA orientierten Kapitalismus arbeiten Regierungen und Konzerne Hand in Hand. Mithilfe von Wahlkampfspenden, machtvollem Lobbyismus und anderen Maßnahmen üben Unternehmen enormen Einfluss auf Regierungen und damit auch auf die Wirtschaftspolitik und -praxis aus, was unter anderem in einer mangelhaften Umweltpolitik resultiert.
Diese hierarchische Kontrolle war typisch für frühere feudalistische und monarchische Gesellschaften, als ein noch sehr viel ausgeprägteres Dominanzsystem herrschte. Tatsächlich stammen viele Grundannahmen, auf denen unsere aktuelle Wirtschaftspolitik und -praxis beruhen, aus Zeiten, als Könige über Untertanen regierten und jedem, der von Freiheit und Gleichheit redete, grausame öffentlich inszenierte Foltermaßnahmen und Hinrichtung drohten. Diese Zeiten, in denen despotische Väter über die Familien herrschten und despotische Adlige und Könige über Stadtstaaten, Lehen und Länder, sind noch gar nicht so lange her – und wir haben sie keineswegs und nirgendwo auf der Welt vollständig hinter uns gelassen.
Aus diesen sehr viel ausgeprägteren Dominanzgesellschaften mit ihrer breiten Unterschicht aus Sklaven, Leibeigenen und später fast völlig verarmten Fabrikarbeitern stammt die heute noch immer verbreitete Annahme, dass die Angst vor Schmerz und Mangel der Hauptgrund dafür sei, dass Menschen arbeiten. Und noch heute wird die Wirtschaftswissenschaft in weiten Kreisen als eine Wissenschaft definiert, die sich damit beschäftigt, eine begrenzte Anzahl von Gütern in einer Welt unbegrenzter Bedürfnisse zu verteilen.6
Diese Definition basiert auf zwei Grundannahmen: unausweichlichem Mangel und einer dem Menschen inhärenten Gier, die zu unbegrenzten Wünschen und Forderungen führt. Tatsächlich ist es so, dass diese Definition nicht die Wirtschaft an sich beschreibt, sondern die Wirtschaft in einem Dominanzsystem. Und selbst hier halten diese Grundannahmen einer näheren Überprüfung nicht stand.
Zwar kommt es manchmal vor, dass Naturereignisse einen Mangel verursachen, aber in dominanzgeprägten Wirtschaftssystemen wird Mangel – und damit Leid und Angst – systematisch künstlich erzeugt und aufrechterhalten und zwar durch eine ungleiche Verteilung der Ressourcen zugunsten der oberen Gesellschaftsschichten, durch hohe Rüstungsinvestitionen, durch fehlende Investitionen in die menschlichen Grundbedürfnisse, durch rücksichtslose Ausbeutung der Natur sowie durch Verschwendung natürlicher und menschlicher Ressourcen durch Kriege und andere Formen der Gewalt – all dies Charakteristika eines Dominanzsystems.
Darüber hinaus ist es in Dominanzsystemen schwierig, unsere menschlichen Grundbedürfnisse – darunter auch unser Bedürfnis nach Wertschätzung, Fürsorge, Liebe, Anerkennung und Lebenssinn – zu befriedigen, sodass Menschen in diesen Systemen kaum Zufriedenheit finden können. Auf diesem Weg erzeugt ein Dominanzsystem künstlich Gier und den unersättlichen Wunsch nach mehr materiellem Besitz und Status. Dieses Gefühl, niemals genug zu bekommen, wird heute noch von Werbekampagnen angefacht, die künstliche und zum Teil schädliche Bedürfnisse und Wünsche generieren.
Wenn man den Einfluss dieser künstlich geschaffenen Mangelgefühle und der ebenso künstlich generierten Bedürfnisse und Wünsche in die Betrachtung miteinbezieht, zeigt sich ein ganz anderes Bild von Angebot und Nachfrage, als es uns in den üblichen Darstellungen des Wirtschaftsgeschehens präsentiert wird. Der Marktwert einer Sache wird also oft von Dynamiken verzerrt, die auf Vorannahmen aus Dominanzsystemen beruhen und verhindern, dass die tatsächlichen menschlichen Bedürfnisse befriedigt werden.
Außerdem herrscht in Dominanzsystemen und damit auch in der Wirtschaft von Dominanzsystemen typischerweise eine Kultur des Misstrauens und der Feindseligkeit, wobei den Übergeordneten unbedingter Respekt und Gehorsam gezollt werden müssen.
Der in Dominanzsystemen verbreitete Mythos, dass Menschen grundsätzlich böse und selbstsüchtig seien und daher einer strikten hierarchischen Kontrolle unterworfen werden müssten, gehört zu den Grundpfeilern des dominanzgeprägten Denkens. Er findet sich sowohl in der religiösen Vorstellung der Erbsünde als auch in den soziobiologischen Theorien über egoistische Gene wieder.
Diese Ansicht über die menschliche Natur ist integraler Bestandteil weit verbreiteter Theorien zur freien Marktwirtschaft, die auf der Annahme beruhen, dass in einem Wirtschaftssystem alle davon profitieren, wenn einfach jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Natürlich käme keiner auf die Idee, einem Kind zu erklären, dass alles perfekt funktioniert, wenn jeder nur an sich selbst denkt. Und trotzdem wird diese Vorstellung weiterhin verbreitet – wobei dadurch keineswegs eine freie Marktwirtschaft gefördert wird (die unter solchen Voraussetzungen gar nicht funktionieren könnte), sondern es zu einer Idealisierung der Gier kommt, von der die Wirtschaft in Dominanzsystemen angetrieben wird.
Eine weitere tradierte Grundannahme besteht darin, dass »weiche« Eigenschaften und Tätigkeiten – wie zum Beispiel Friedfertigkeit oder Fürsorge – für die Führung einer Gesellschaft oder Wirtschaft ungeeignet seien. Dazu gehört unter anderem auch die Annahme, Fürsorge und Care-Arbeit seien für die Produktivität hinderlich oder im besten Fall wirtschaftlich irrelevant. Anders ausgedrückt: Wir haben aus der Vergangenheit kulturelle Überzeugungen und Institutionen übernommen, die der Fürsorge und Care-Arbeit nicht zu-, sondern abträglich sind – und das hat zu zahlreichen unrealistischen wirtschaftlichen Theorien, Regeln, Maßnahmen und Praktiken geführt, die uns zunehmend gefährden.