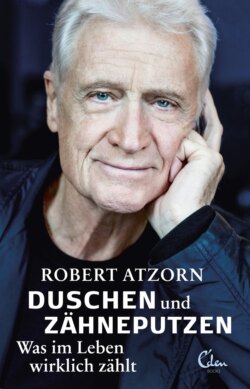Читать книгу Duschen und Zähneputzen – Was im Leben wirklich zählt - Robert Atzorn - Страница 7
Alles auf Anfang
ОглавлениеKurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1945, wurde ich in einer kleinen Stadt in Westpommern geboren. Unsere Familie hatte dort Verwandte, und es schien sicher genug zu sein, um dort ein Kind auf die Welt zu bringen. Drei Tage später wurde das Krankenhaus evakuiert: Die Russen kamen in bedrohliche Nähe.
Da ich gleich nach der Geburt an Diphtherie erkrankte, meinte der Arzt zu meiner Mutter: »Versuchen Sie so schnell wie möglich, in den Westen zu kommen. Lassen Sie das Baby hier, es stirbt sowieso.«
Aber sie ließ mich natürlich nicht zurück. Sie schloss sich einem Treck an und landete in Neumünster in einem Auffanglager. Mein Vater war zu der Zeit als Offizier auf dem Russlandfeldzug und geriet in Gefangenschaft. Ich lernte ihn erst kennen, als ich fünf Jahre alt war.
Von Neumünster ging es nach Oldenburg in Oldenburg in das kleine Reihenhaus meiner Großeltern. In einem der oberen Zimmer stand mein Kinderbettchen. Als ich drei Jahre alt war, wurden dort zwei Flüchtlingsfrauen aus Ostpreußen zwangsuntergebracht und ich landete auf dem Dachboden. Ich erinnere mich, dass ich dort oben schreckliche Angst hatte. Es spukte, es knackte, es war unheimlich. Auch das Zusammenleben mit den Flüchtlingsfrauen gab immer wieder Anlass zu Auseinandersetzungen, weil eine der beiden heimlich im Zimmer rauchte. Besonders schlimm wurden die Streitereien, als das ganze Haus plötzlich mit Wanzen verseucht war. Mein Opa lief Amok. Für ihn war es eindeutig, dass die Damen die Schuldigen waren. Der Kammerjäger räucherte und räucherte. Ich fand den Gestank ätzend – ich glaube, er arbeitete mit Ammoniak –, aber trotzdem war die Aktion für mich ein spannendes Unterfangen: ein Jäger im Haus, dunkel angezogen, ein bisschen gespenstisch mit seiner Giftspritze. Jede Ecke wurde untersucht und eingesprüht. Ich folgte ihm neugierig auf Schritt und Tritt. Wie diese Monster wohl aussahen? Allerdings bekam ich nie eine Wanze zu Gesicht. Vielleicht hatte mein Opa das auch nur erfunden, um die Frauen loszuwerden, denn sie wurden danach umgesiedelt. Ich weiß es nicht. Mein Bett wurde wieder runtergestellt, ich schlief wie ein Murmeltier. Und dann, oh Schreck, war plötzlich auch noch der Holzwurm im Gebälk! Es rieselte und rieselte, aber dafür fand Opa keinen Schuldigen …
Im Ersten Weltkrieg war mein Opa schwer verwundet worden. Nach seiner Genesung hatte er bei der Reichsbahn gearbeitet, und auch im Rentenalter war er noch ein begeisterter Eisenbahner. Am Bahnhof zeigte er mir Züge mit der Aufschrift »DR«. Das bedeutete »Deutsche Reichsbahn«, aber er flunkerte: »Kuck mal, da sind meine Initialen auf jedem Waggon, DR!«
Sein Name war Diedrich Remmers. Ich war so stolz auf meinen Opa, auch weil er alle Bahnstrecken kannte, samt Zwischenstationen und Umsteigemöglichkeiten. Ich fand das phänomenal und wollte unbedingt auch zur Bahn, am liebsten natürlich als Lokomotivführer.
Opa wurde meine Hauptbezugsperson. Er und meine Oma hatten einen Sohn im Babyalter verloren, was vielleicht eine Erklärung dafür ist, warum er sich so um mich kümmerte. Ich war so etwas wie ein Ersatzsohn. Er radelte mit mir aufs Land zu Bauern, um etwas Essbares zu ergattern. Dort bekam ich dicke Brotschnitten mit Speck. Herrlich. Obwohl es sonst meistens nur wenig zu essen gab, oft nur Mahlzeiten mit Steckrüben und Kartoffeln in diversen Variationen, hatte ich nie ein Mangelgefühl. Es war einfach so. Opa ging mit mir spazieren und erklärte mir die Natur.
Als ich vier oder fünf Jahre alt war, meldete er mich im Turnverein an. Das war allerdings überhaupt nicht mein Ding, einmal und nie wieder. Ich konnte mit Barren, Reck und Ringen nichts anfangen. Er selbst muss wohl in seiner Jugend ein großer Turner gewesen sein. Im Garten hatte er eine Reckstange, wo er mir hin und wieder seine 15 Klimmzüge zeigte. Irgendwann schaffte ich immerhin zwei. Opa war glücklicherweise nicht enttäuscht, als meine Turnversuche scheiterten. Wir gingen einfach mehr spazieren, schauten den Anglern an einem Teich zu, kümmerten uns um unseren kleinen Gemüsegarten.
In dieser Zeit kam mein Vater aus der Gefangenschaft zurück. Doch davon erzähle ich an anderer Stelle.
Meine Mutter hatte der Krieg völlig aus der Bahn geworfen. Sie war verstummt. Sie half nicht im Haushalt, machte eigentlich gar nichts. Oma sorgte für alles. Heute würde ich sagen, meine Mutter hatte eine schwere Depression. Sie saß irgendwo im Sessel und wartete. Auf was, wusste ich nicht. Oder sie stand in ihrem grünen Bademantel vor dem Fenster, schaute verloren in den Garten und weinte. Warum, wusste ich auch nicht. Hin und wieder unternahm ich einen Versuch, sie zu trösten, sie anzusprechen oder abzulenken. Ich wollte mit ihr im Garten spielen oder mit ihr spazieren gehen, aber jedes Mal wandte sie sich ab und verwies auf Opa. Keine Umarmung, keine Nähe. Mein Opa fing dieses Defizit mit Wärme auf. Von ihm fühlte ich mich angenommen und geliebt.
Manchmal spielte Mutter Klavier und sang. Sie war Sopranistin und liebte Lieder, vor allem von Franz Schubert oder Hugo Wolf. Früher hatte sie mit diesen Liedern Konzertreisen zur Truppenunterhaltung gemacht. Bei einer dieser Reisen hatte sie meinen Vater kennengelernt. Jetzt spielte sie mir etwas vor. Nach jedem Lied schaute sie mich mit hungrigen, traurigen Augen an. Ich sollte das eben Gehörte schön finden, sie loben. Ich fand diese Lieder aber einfach langweilig bis scheußlich, ich konnte absolut gar nichts damit anfangen. Aber damals rang ich mir irgendein »Hm …, schön« ab. Das beruhigte sie. Und sie lächelte ein bisschen.
Opa war ein Choleriker der reinsten Art und konnte sehr rüde mit meiner Mutter und meiner Oma umgehen. Vielleicht weinte sie auch deshalb. Immer wenn etwas nicht so lief, wie er es wollte, knallten sämtliche Türen, dass man es bis auf die Straße hörte. Er schrie und legte sich dann zwei Tage lang ins Bett. Zwei Tage! Nicht ansprechbar. Stur. Man durfte ihm nichts zu essen bringen. Keiner durfte ihn stören. Keiner durfte in sein Zimmer. Selbst ich nicht. Alle schlichen auf Zehenspitzen durchs Haus. Oma musste auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen. Auch ich traute mich nicht zu ihm. Eiszeit. Am dritten Tag stand er morgens wieder auf wie immer und tat, als wäre nichts gewesen. Alle waren erleichtert, aber gesprochen wurde nie darüber, jedenfalls nicht in meiner Gegenwart. Gott sei Dank war ich nie die Ursache für seine Ausbrüche.
Ein großes Glück in meiner Kindheit war ein Kino, das ganz in unserer Nähe lag. Nachdem ich sechs Jahre alt geworden war, besuchte ich so viele Vorstellungen, wie ich konnte. Wenn das Taschengeld nicht reichte, nahm ich den Rest heimlich aus Opas Geldbörse. Ob er es je bemerkt hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich im Tarzan-Film die erste nackte Frau meines Lebens gesehen habe. Meine Güte, war das aufregend! Eigentlich war der Film erst ab zwölf, aber irgendwie hatte ich mich, angestachelt durch ältere Jungen, reingeschummelt. Nacktheit war ein absolutes Tabu in meiner Familie, und da schwamm Jane völlig nackt von links nach rechts über die Leinwand. Diesen Film habe ich mehrmals angeschaut, weil er mich ziemlich neugierig auf das weibliche Geschlecht machte. Das musste ich genauer wissen!
Ich war zehn Jahre alt, als wir nach Hamburg zogen. Eine neue Volksschule für zwei Monate, daneben die Prüfung fürs Gymnasium. Alles klappte so leidlich. Aber ich vermisste meinen Großvater. Mit wem sollte ich reden, meine Probleme besprechen? Mein Vater war sehr streng, autoritär. Er redete tagelang nicht mit mir, wenn ich etwas »falsch« gemacht hatte. Entsprechendes kannte ich ja schon von meinem Opa … Aha, so lösen Männer also Probleme? Mit Schweigen?!
Meine Mutter taute in Hamburg zwar langsam aus ihrer Ohnmacht auf, aber ich hatte immer das Gefühl, ich müsste sie unterstützen. Ich war traurig. Allein. Ohne meinen Großvater schien mir das Leben nicht lebenswert. Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, starb er, jetzt konnte ich nicht einmal mehr die Ferien in seiner Nähe verbringen.
Meinem Vater täuschte ich vor, dass ich sehr interessiert an neuen gymnasialen Lernbereichen sei. Ich dachte, dann würde er mich sicher mögen. Er sollte auf keinen Fall merken, wie langweilig ich die Schule fand. Hat er auch nicht. Aber es war demzufolge kein Wunder, dass ich zweimal sitzen blieb. Schule war eine Tortur für mich, es war grauenvoll, lediglich die letzten drei Jahre auf dem musischen Zweig mit Zeichnen und Malen als Hauptfach waren einigermaßen erträglich. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen und ausgelacht zu werden, beteiligte ich mich nie am Unterricht. Ganz schlimm war es, wenn ich aufgerufen wurde und an die Tafel musste. Wie der Gang zur Guillotine. »Robert, dann zeig du uns doch mal, wie das geht!«
Ich wusste es nicht. Ich hatte meine Hausaufgaben nicht gemacht. Diese Matheaufgabe an der Tafel war für mich unlösbar. Verlegen schlich ich nach vorn. Wie konnten drei Brüche multipliziert werden? Ach ja, erst gleicher Nenner, und was dann? Die Klasse johlte schon. Alle weideten sich an meiner Unwissenheit. Ich schrieb irgendeine vermutete Zahl hin. Nenner 24. Schallendes Gelächter. Ich war schweißgebadet.
»Wie wär’s mit Nachhilfe? Wer kann helfen?«
Ein Klassenkamerad, nicht gerade mein Freund, löste es mit links. Ich stand doof daneben.
»Ja, das sieht nicht gut aus für dich, Robert. Setz dich.« Der Lehrer schrieb irgendwas in irgendein Heft.
Glücklicherweise hatte ich in den letzten drei Klassen einen sehr liebevollen Klassenlehrer, der mich akzeptierte, wie ich war. Ohne ihn hätte ich das Abitur nie geschafft. Ich bin sicher, alle meine Lehrer haben vereint mitgeholfen, dass ich endlich die Schule verlassen konnte. Ich war schließlich überfällig.
Jetzt half nichts mehr, ich musste mich für einen Beruf entscheiden. Da der Zeichenunterricht mein Überleben in der Schule gesichert hatte, wollte ich erst einmal weiter zeichnen. Eine Grafikerausbildung schien mir ziemlich geeignet. Das kam mehr aus dem Kopf als aus dem Herzen. Ich bewarb mich an einer Hamburger Grafikschule, wurde angenommen und begann verhalten mit dem Studium. Freude kam nicht wirklich auf.
Ein Lichtblick während meiner Schulzeit war der Jugendring, über den man verbilligte Veranstaltungskarten bekam. Sooft ich welche ergattern konnte, war ich im Theater. Am liebsten verbrachte ich meine Freizeit im Deutschen Schauspielhaus oder im Thalia Theater, dort fühlte ich mich zu Hause. Ich hatte Bilder von Ulrich Haupt, Will Quadflieg, Richard Münch und Heinz Reincke aus den Programmheften ausgeschnitten. Das waren die Idole meiner Jugendzeit. Riesenplakate in der heutigen Form gab es noch nicht. Auf die Idee, selbst Schauspieler zu werden, kam ich nicht. Zu groß war meine Bewunderung und Hochachtung für diese Künstler.