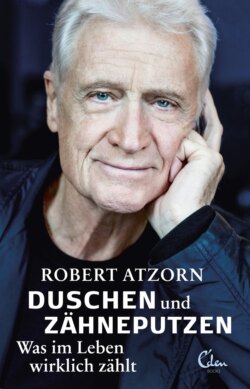Читать книгу Duschen und Zähneputzen – Was im Leben wirklich zählt - Robert Atzorn - Страница 9
Mit diesem Schauspieler kann ich nicht arbeiten
ОглавлениеIn Hamburg hatte ich nach dem Abitur ein Grafikstudium begonnen, das wollte ich in München fortsetzen. Aber das einsame Sitzen vor einem leeren Blatt Papier gefiel mir nicht wirklich. Beim Zeichnen bist du immer allein. Ich war schüchtern, wollte raus aus dieser Einsamkeitsfalle, war neugierig aufs Leben. Vielleicht doch die Schauspielerei?
Das Schicksal half. Eines Abends brachte mein Vater Wolfgang Reichmann mit in unsere Wohnung, um ihn zu interviewen. Ich hatte ihn schon einige Male im Fernsehen gesehen, als Othello etwa oder als Lenny in Von Mäusen und Menschen. Ein wunderbarer Mensch. Das war eine günstige Gelegenheit. Ich vertraute mich ihm an. Er meinte, so einfach könne er nicht beurteilen, ob das etwas für mich sei. Deshalb trafen wir uns an einem der nächsten Tage in der Wohnung einer befreundeten Schauspielerin. Er ließ mich die Suchsituation »Portemonnaie weg« improvisieren. Es machte Spaß, und er war wohl ganz angetan, denn er empfahl mich seiner Kollegin. Ich nahm ein paar Stunden bei ihr, bis ich an der Falckenberg-Schule vorsprechen konnte.
An anderer Stelle erzähle ich, warum ich diese Schule schnellstens wieder verließ und auf einer Privatschule landete, nämlich auf der Neuen Münchner Schauspielschule. Dort platzte eines Tages meine Schauspiellehrerin Ali Wunsch mitten in eine Rollenstunde.
»Robert, kommst du mal?«
Schreck lass nach. Wieso ich? Der Unterricht wurde unterbrochen.
»Gehen wir nach nebenan.«
Ich folgte ihr irritiert. Es klang nach einer Übeltat. Hatte ich etwas falsch gemacht? Aber was? Irgendjemand hatte einen anonymen Liebesbrief an die Chefin geschrieben, und es ging das idiotische Gerücht herum, ich sei das gewesen. Völliger Quatsch, ich war doch an einem ganz anderen Mädchen interessiert. Glaubte meine Lehrerin das etwa auch? Das konnte ja wohl nicht wahr sein, an älteren Damen war ich nicht so sonderlich interessiert.
»Ich habe gerade einen Anruf vom Residenztheater bekommen.«
Der besagte Brief war es also nicht.
»Die sind in den Endproben von Schillers Räubern, mit Martin Benrath und Helmut Griem. Von den Räubern, also von den Rollen ohne Text, ist plötzlich einer wegen Erkrankung ausgefallen, und die brauchen Ersatz. Ich denke, du könntest das.«
»Wirklich?«
»Geh sofort hin und stell dich vor.«
»Jetzt?«
»Ja, beeil dich, ich habe dich vorgeschlagen, die proben seit zehn Uhr. Je schneller du da bist, desto besser. Premiere ist in sieben Tagen!«
»Danke! Toll!«
Ich rannte los. Das Residenztheater war mit der U-Bahn von Schwabing aus leicht zu erreichen. Der Pförtner wusste schon Bescheid und alarmierte den Regieassistenten. Ich war sehr aufgeregt, hatte den größten Respekt und auch Angst vor den großartigen, bekannten Schauspielern.
Der Assistent meinte: »Sei ganz leise. Du weißt ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich stelle dich gleich in die Reihe der Räuber, die sind mitten in einer Probe. Allererster Durchlauf. Du kennst ja das Stück!«
Ich kannte es nicht, aber ich ließ ihn in seinem Glauben.
»Griem wiederholt gerade einen seiner Monologe.«
Obwohl ich so viel Theater gesehen hatte, waren mir Schillers Räuber nie untergekommen. Der Assistent schummelte mich an die vierte Stelle in einer Reihe Kleindarsteller. Es waren zehn Räuber, teilweise kostümiert, mit Messern oder Degen ausgestattet. Er wollte die Einwechslung ohne großes Aufsehen durchführen. Also sagte er niemandem etwas, ich war plötzlich einfach da.
Griem war für mein Empfinden richtig gut. Ich war beeindruckt. Einen so hervorragenden Schauspieler hatte ich noch nie aus der Nähe erlebt. Solche gekonnten Wutausbrüche gab es auf unserer Schauspielschule nicht. Die Rede war intelligent und durchdacht aufgebaut, mit lauten und dezenteren Momenten. Griem benutzte die komplette Probebühne, ging die ganze Räuberreihe auf und ab und schaute jedem von uns mitten ins Gesicht. Auch ich war dran. Das irritierte mich, denn ich wusste nicht, wie ich zurückgucken sollte. Ich wusste ja überhaupt nicht, worum es ging. Er zögerte kurz, dann ging er weiter, setzte den Monolog fort, schreiend oder auch wimmernd. Dann kam er wieder zurück in meine Richtung. Einer nach dem anderen wurde mit fordernden Vorwürfen dem Stück entsprechend bedacht. Vor mir blieb er stehen. Stockte. Brach ab. Wie hätte ich denn schauen sollen? Wütend, betroffen, erstaunt oder verblüfft? Keine Ahnung! Eins war klar, mein Blick war falsch.
Griem schaute zum Regisseur und rief laut zu ihm hinunter: »Mit diesem Schauspieler kann ich nicht arbeiten!«
Stille. Mir stockte der Atem. Ich bekam Herzrasen und wusste nicht, was ich machen sollte. Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken.
Regisseur Hans Lietzau rief von unten: »Jetzt beruhige dich mal, Helmut. Der ist heute eingesprungen. Ganz neu. Das wird schon.«
Ich stand mit knallroter Birne da. Sagte gar nichts. Nur ganz leise nach ein paar Sekunden: »Ja, äh …Tut mir leid.«
»Die Szene machen wir morgen noch mal, und Sie … wie heißen Sie eigentlich?«, fragte der Regisseur.
Ich räusperte mich: »Hrrrkr … Robert Atzorn.«
»Ja, also, Sie … Herr … äh …? Sie bereiten sich bis morgen vor.«
»Ja, klar, mach ich.«
»Helmut, wir wiederholen die Stelle. Mach das noch mal, allein. Mir ist aufgefallen, du bist immer noch zu schnell … Versuch mal, die Erregung noch mehr nach innen zu nehmen …!«
Ich war zunächst erlöst. Erleichtert verschwand ich mit den anderen Richtung Kantine. Ich stellte mich den Kollegen vor. Ich wurde nicht rausgeschmissen.
Der Assistent kam zu mir: »Ich hätte dich nicht so einfach reinstellen sollen. Das war falsch, Entschuldigung! Wenn wir das morgen wieder machen … Es geht um Folgendes …«
Er umriss das Thema, ich ging mit dem Textbuch aufgeregt nach Hause, las die Fassung über Nacht, und von der nächsten Probe an lief alles wie geschmiert. Ich fand mich schnell in das Konzept ein. Es gab jede Menge Gruppenauftritte, meist mit kämpferischem Gesang. Die Vorstellung wurde ein großer Erfolg. Sogar mit mir als viertem Räuber.
Und es ging weiter: Wir gastierten mit den Räubern in Moskau. Die Russen nahmen uns herzlich auf. Nach der gelungenen Premiere wurden mehrere Reden über den fruchtbaren Kulturaustausch gehalten, wir beklatschten uns gegenseitig und es gab jede Menge zu essen und zu trinken. Besonders zu trinken. Wodka im Übermaß. Daneben Kaviar. Einige tranken hemmungslos.
Die Räuberbande schlief jeweils zu zweit in einem Doppelzimmer. Die Schauspieler mit den großen Rollen hatten natürlich Einzelzimmer. Ich teilte mir mit einem gleichaltrigen Jungschauspieler, einem riesigen Bodybuilder, das Zimmer. Er hatte exzessiv getrunken. Zwei Stunden nachdem ich aufs Zimmer gegangen war – ich schlief schon –, riss er die Tür auf und versuchte, sich wankend zurechtzufinden. Er zog sich erst gar nicht aus, peilte gleich sein Bett an. Dabei stolperte er über einen Stuhl und stürzte neben das Bett. Sein Kopf streifte die metallene Bettkante. Das hörte sich nicht gut an. Unter Stöhnen rappelte er sich halb hoch, Gott sei Dank blutete er nicht. Mühsam hielt er sich am Bettrahmen fest, rülpste mehrmals laut, würgte, schluckte Verdächtiges wieder runter, schnappte nach Luft und richtete dann den Blick aufs Zielgebiet Bad. Ein Ansatz in die Richtung gelang ihm noch, doch schlagartig entlud sich das nicht mehr Festzuhaltende. Er übergab sich mehrmals auf den Boden. Bei dem Versuch, doch noch das rettende Ufer zu erreichen, rutschte er aus und landete kopfüber in der Suppe. Er kam nicht mehr hoch. Alles stank. Erst mal Fenster auf. Ich habe keine Ahnung, wie es mir gelang, diesen Hünen ins Bett zu hieven. Ich konnte nicht mehr schlafen, er röchelte unregelmäßig, dann eine beängstigend lange Stille, also Atemlosigkeit. Ich fürchtete schon, er würde ersticken. Sollte ich vielleicht einen Notarzt holen? Aber ich sprach kein Russisch …
Irgendwann, gegen fünf Uhr morgens, wurde mein Zimmergenosse wach und registrierte, was los war. Ich glaube, er schämte sich. Verzweifelt versuchte er, alles zu reinigen. Das Wasser im Bad lief ununterbrochen. Ich stellte mich schlafend, irgendwann schlief ich tatsächlich ein.
Am nächsten Abend trank er wieder, allerdings verhaltener. Wollte alles wiedergutmachen, entschuldigte sich und lud mich auf einen Wodka ein. Dankend lehnte ich ab.
Zurück in München lief das Stück weiter. Das war ein schönes Taschengeld neben der Schauspielschule. Zwischen unseren Auftritten hatten wir während der Vorstellung lange Wartezeiten. Einige lasen, manche unterhielten sich, andere, auch ich, spielten Tischtennis. Bei den Turnieren schnitt ich gar nicht schlecht ab. In einer der letzten Vorstellungen passierte es dann: Der Inspizient hatte uns schon auf die Bühne gerufen, wir hatten noch bis zur letzten Sekunde um einen Turniersieg gekämpft. Mittendrin, so ein Mist, mussten wir abbrechen und rasten geräuschlos auf die Bühne. Das Stück fand auf einer Schräge statt, die sich quer über die ganze Bühne zog. Hinten war sie sicher drei Meter hoch, zur Rampe hin dann abgesenkt. Griem hielt gerade den Monolog, der einst so ungut für mich geendet hatte. Wir Räuber waren alle in Habachtstellung und warteten auf das Stichwort, bei dem wir mit erhobenen Armen in Jubelgeschrei ausbrechen sollten. Das Stichwort kam, wir schrien, rissen unter lautem Gegröle die Hände aus den Hosentaschen – doch was war das denn? Nein, nein, nein, bitte nicht, ein Tennisballhopser-Geräusch – nein, stopp, oh Gott, nein! Einer der Bälle hatte sich wohl in der Hand meines Nachbarn verklemmt, er wurde mit aus der Hosentasche gezogen, fiel auf den Bühnenboden und hüpfte lautstark von ganz hinten – hops, hops, hohohops, kuller, kuller, kuller – über die schiefe Ebene ins Publikum. Das Geschrei war allen im Halse stecken geblieben. Stille. Das durfte doch nicht wahr sein! Das war auf offener Bühne passiert? Alle standen unter Schock.
Und noch jemand stand unter Schock: Helmut Griem. Er hatte einen Hänger. Totale Irritation. Er wusste nicht, wie er reagieren sollte. Im Publikum erst Starre, dann Lacher. Griem war außer sich wegen dieser maßlosen Dämlichkeit. Aber er fing sich nach ein paar Sekunden wieder, es blieb ihm ja auch gar nichts anderes übrig. Er baute seine persönliche Wut in die Rede ein und schmetterte den Rest als Kanonade in Richtung Publikum. Szenenapplaus! Es folgte unser planmäßiges Jubelgeschrei.
Ab sofort wurde das Tischtennisspielen strikt verboten.
»Welcher Idiot war das?«
Keiner verriet den Schuldigen. Einer für alle, alle für einen, wie es sich für eine richtige Räuberbande gehört. Doch intern wurde dieser Schlamassel dem Pechvogel noch lange unter die Nase gerieben. Ironische Bemerkungen bei jeder Vorstellung. Helmut Griem hatte sicher irgendwie herausbekommen, wer der Schuldige war, aber er verschonte ihn. Der Intendant Helmut Henrichs setzte für alle eine Ordnungsstrafe fest: zehn Mark. Sie wurde mit der nächsten Gage einbehalten.