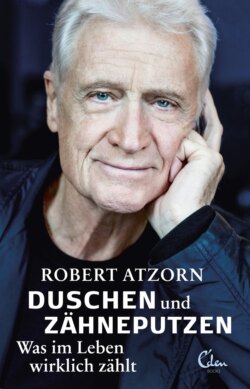Читать книгу Duschen und Zähneputzen – Was im Leben wirklich zählt - Robert Atzorn - Страница 8
Drum Fever
ОглавлениеEin Schulfest im Gymnasium. Eine Schülerband spielte, die Jungen waren bereits in der Oberstufe. Ich war fasziniert davon, wie durch verschiedene kleine Verstärker ein immenser Sound entstand. Rock ’n’ Roll vom Feinsten. Songs von Chuck Berry, Elvis, den Everly Brothers und anderen. Es hörte sich fast so gut an wie auf einer Platte. Fast.
Vor allem die Drums, wow! Ich starrte wie gebannt. So was hatte ich noch nie aus der Nähe gesehen. Sie hörten sich gigantisch an, sahen phänomenal aus und versprachen überdurchschnittlichen Erfolg bei den Mädchen – das war mein Instrument!
Auf der nächsten Klassenreise hatten zwei Jungen ihre Gitarren dabei. Und sie spielten Skifflesongs von Lonnie Donegan. Ich war animiert, überwand meine Schüchternheit, schnappte mir aus der Jugendherbergsküche einfach einen Eimer und trommelte mit. Die Jungen fanden das super, mit der Betonung auf zwei und vier konnte nicht viel schiefgehen. Mir gelang sogar ein kleines Trommelsolo. Die Klasse freute sich, sang mit. Ein Waschbrett wurde aufgetrieben, und die Rhythmen purzelten mir aus den Händen.
Ich fühlte mich großartig. Endlich war mir mal was Tolles gelungen. Ein grandioses Erfolgserlebnis.
Diese Klassenreise war der Beginn. Ein Schlagzeug musste her oder zumindest einige Basisteile desselben. Meine Eltern hatten Angst vor der Lautstärke, Angst vor den Nachbarn. Wir wohnten in einem ziemlich hellhörigen Haus im zweiten Stock, sie stellten sich meinem Wunsch vehement entgegen. Irgendwie konnte ich es verstehen, aber nicht wirklich.
»Lern lieber Klavier spielen. Wir haben doch diesen schönen Flügel!«
»Nö.«
Dazu hatte ich nun überhaupt keine Lust. Durch die langweiligen Gesangsübungen meiner Mutter mit Klavierbegleitung war der Flügel für mich zu einem persönlichen Störfaktor geworden, dem ich rein gar nichts abgewinnen konnte.
Gott sei Dank hatte ich zu der Zeit noch meinen Opa. In den nächsten Ferien fuhr ich zu ihm und ließ ihn an meiner Begeisterung teilhaben.
Er hörte sich geduldig meine Sehnsucht an, seufzte mehrmals tief, dachte nach und meinte schließlich: »Komm mal mit, mien Jung, ich weiß was. Wir besuchen einen alten Kameraden.«
Seine alten Kameraden waren Überlebende des Ersten Weltkriegs. Oft und gern hatte ich meinen Opa zu den Treffen mit seinen Kameraden begleitet, denn ich bekam dort immer eine Zitronenbrause zu trinken. Etwas ganz Besonderes. Hochgefühl. Die Gespräche der acht oder neun Männer waren für mich ziemlich langweilig. (Heute würde ich allerdings ein Band mitlaufen lassen.) Der eine alte Kamerad war tatsächlich Inhaber eines Musikgeschäftes. Er rüstete die örtliche Blaskapelle aus. Von einem Schlagzeug beziehungsweise Drumset hatte er noch nichts gehört, aber er hatte – eine Marschtrommel. Opa zückte sein Portemonnaie, und ich war happy. Mir war völlig egal, auf welcher Trommel ich anfangen würde zu lernen. Hauptsache, es war endlich ein Instrument da.
Unverzüglich wollte ich nach Hause und loslegen, doch ich hatte es schon befürchtet: Zuerst gab es noch ein längeres Gespräch zwischen den beiden alten Kameraden. Ich bekam mit, dass es sich um eine Schlacht bei Verdun handelte und dass sie beide etwas Französisch gelernt hatten. Immerhin konnten sie bis vier zählen, nämlich: »Un, dö, katre, keng.«
Sie wiederholten es immer wieder: »Un, dö, katre, keng.« Und freuten sich diebisch über ihre enormen Fremdsprachenkenntnisse.
Ich war unruhig, mimte freundliches Interesse, lachte mit. Dass sie die »troi« vergessen hatten, teilte ich ihnen nicht mit, das hätte die Situation unnötig verlängert. Irgendwann waren wir trotzdem zu Hause, ich griff zu meinen Stöcken und war nicht mehr zu bremsen. Endlich! Oma und Opa liefen sofort in die nächste Apotheke und besorgten sich Ohrenstöpsel. Meine Seele wurde weit. Ich war glücklich!
Wieder in Hamburg wurde ich mit meiner kostbaren Fracht sofort und ultimativ in den Keller verbannt. Mit den verständnislosen Nachbarn wurden nach einigem Hin und Her Übungszeiten vereinbart. Ich weiß noch genau: Montag und Donnerstag jeweils von fünfzehn bis sechzehn Uhr. Ich übte. Autodidaktisch. Versuchte, Songs aus dem Radio mitzuspielen. Hörte mit stundenlanger Geduld das Schlagzeug heraus und spielte es nach. Aber es fehlten wesentliche Teile des Instruments. Ich sparte mein Taschengeld, bis es für eine Hi-Hat reichte, ein Becken-Paar, das per Pedal bedient wurde. Klang schon besser. Fortschritt. Neben der Schule arbeitete ich in einem Lebensmittelgeschäft, füllte die Regale auf, trug Waren aus und – kaufte ein Schlagzeug-Becken.
An meinem 14. Geburtstag geschah ein Wunder: Mein Vater hatte nach einem halben Jahr erkannt, dass mein Trommeln sich zu einer Leidenschaft entwickelt hatte, die nicht mehr zu bremsen war. Er fuhr mit mir in ein Musikgeschäft und schenkte mir ohne Kommentar, einfach so, ein Sonor-Schlagzeug, komplett mit Snare, Bass Drum, Tomtom, Standtom, Becken, einem richtigen Drummersitz und allem, was sonst noch so dazugehörte. Ich konnte es kaum glauben.
Aber damit nicht genug. Er hatte noch eine Überraschung vorbereitet: Weiter ging es zum NDR in die Rothenbaumchaussee. Wir stürmten in ein leeres Aufnahmestudio. Big-Band-Instrumente standen herum, und hinter einem Trixon-Schlagzeug saß mutterseelenallein der Schlagzeuger des NDR-Unterhaltungsorchesters. Er stand auf, begrüßte meinen Vater herzlich. Es stellte sich heraus, dass dieser Freund eine Gruppe von Nachwuchstrommlern unterrichtete.
»Setz dich mal ran und leg los«, forderte er mich auf.
Mein Herz schlug bis zum Hals. Ich hatte eine trockene Kehle, hustete verlegen. Er drückte mir seine Stöcke in die Hand.
»Trau dich!«
Jetzt musste ich Farbe bekennen. Ich saß hinter dem für mich damals unüberschaubaren, mit allen Raffinessen ausgestatteten Set und wusste nicht, wie loslegen.
»Genieße es«, rief er.
Ich begann, einen Rhythmus zu erzeugen. Es gelang so gut wie gar nicht, war furchtbar, hölzern, langweilig, unstimmig.
»Stopp!«
Ich hörte nichts, zu laut schlug ich zu, teilweise aus Frust, da nichts funktionierte.
»He, stopp mal. Ich weiß, was los ist!«
Ich war erschrocken, dachte schon, er hätte die Nase voll von mir.
»Ich merke, du bist Linkshänder, da müssen wir was umstellen!«
Die Drums wurden umgestellt, und jetzt lief es rund. Einige ganz gute Schläge gelangen.
»Weiter!«
Allmählich kam ich rein.
Schließlich unterbrach er: »Stopp, okay, nicht unbegabt. Wir können anfangen. Nächste Woche kommst du in die Gruppe. Notenblatt mitbringen.«
Ich war das, was man heutzutage als geflasht bezeichnen würde. Das hatte mein Papa für mich getan, das hatte er für mich eingefädelt! Ich war sprachlos, musste meine Tränen zurückhalten. Ich umarmte ihn, bedankte mich aus tiefster Seele. Auch er war gerührt. Zum ersten Mal gab es zwischen uns eine Art Einklang der Herzen.
Tatsächlich zum allerersten Mal, denn unser Verhältnis war von Anfang an seltsam belastet. Ich hatte ihn ja erst mit fünf Jahren kennengelernt, als er 1950 aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt war. Plötzlich stand da ein ewig langes, abgemagertes und verdrecktes Wesen im Wohnzimmer, und meine Mutter sagte: »Das ist dein Vater.«
Ich war verwirrt. Nie war in meiner Gegenwart von einem Vater gesprochen worden. Er existierte für mich überhaupt nicht, und plötzlich war dieser Vater-Mensch einfach da. Wozu brauchte man überhaupt einen Vater? Ich hatte doch meinen Opa!
Meine Mutter dagegen lachte, steckte mich zusammen mit ihm in eine Badewanne. Ich fühlte mich überhaupt nicht wohl, nur überfordert. Nackt mit einem Fremden in der Badewanne. Was sollte das? Es sollte uns wohl miteinander vertraut machen, aber ich schämte mich nur.
Ich kann mich kaum an Erlebnisse erinnern, die mit meinem Vater zu tun hatten. Vielleicht hat er sich sogar bemüht, eine Beziehung zwischen uns aufzubauen, aber diese Stelle war durch Opa bereits komplett ausgefüllt.
Das muss für ihn enttäuschend und schmerzhaft gewesen sein. Das Gefühl der Fremdheit blieb bis zu seinem Tod. Es gelang uns nicht, ein anhaltendes herzliches Gefühl füreinander zu entwickeln. Trotz mancher Versuche von beiden Seiten.
Mein Bruder wurde neun Monate nach der Rückkehr meines Vaters geboren. Die beiden hatten von Anfang an eine ganz andere Vater-Sohn-Beziehung. Kein Wunder, mein Vater hat ihn ja auch als Baby erlebt und aufwachsen sehen.
Er hat nie über seine Kriegserlebnisse gesprochen. Ich spürte nur immer seinen verzweifelten Versuch, die Bilder nicht hochkommen zu lassen. Meine Mutter erzählte mir später, dass er nachts oft geträumt und dabei geredet oder auch geschrien hatte. Auch auf direkte Nachfragen erzählte er nie etwas. Sein gereizter Kommentar war immer wieder: »Darüber rede ich nicht. Ich hasse es, wenn andere von ihren großartigen Erlebnissen erzählen und sich als große Helden darstellen. Die sollen lieber ihren Mund halten.«
Er saß auf einem riesigen Aggressionspotenzial.
Als mein Vater zehn Jahre alt war, starb seine Mutter und er wurde in ein Jesuiteninternat gesteckt. Dort legte er ein super Abitur hin, sagte er jedenfalls, sollte Priester werden, entschied sich aber für ein Ingenieurstudium. Doch der Krieg brach aus, er wurde eingezogen, und nun war er zu alt für die Fortsetzung des Studiums. Es hieß: Jetzt sind die Jungen dran. Er war Anfang dreißig. Das war eine fürchterliche Ablehnung für ihn, denn seinem Gefühl nach hatte er für Deutschland den Kopf hingehalten, fünf Jahre russische Gefangenschaft überlebt, und als Dank bekam er keinen Studienplatz. Eine grenzenlose Demütigung. Er begann zu trinken. Er trank eigentlich immer.
Ein Freund, der für die Oldenburger Nordwest-Zeitung journalistisch arbeitete, verschaffte ihm einen Job als Volontär. Er arbeitete jeden Tag sehr lang, ich bekam ihn kaum zu Gesicht. Durch Learning by Doing wurde er ein anerkannter Journalist und ging einige Jahre später zu Axel Springer. Das bedeutete für uns alle: Umzug nach Hamburg. Da war ich zehn Jahre alt.
Doch jetzt hatte mein Vater mich mit einem wunderbaren Schlagzeuglehrer zusammengebracht. Ich wurde ein äußerst gelehriger Schüler, obwohl ich mit seiner Musikrichtung nichts anfangen konnte. Er liebte und spielte nämlich Tanz- und Unterhaltungsmusik. Ich wollte selbstverständlich Rock ’n’ Roll spielen. Nach einiger Zeit merkte er meine leise Ablehnung.
»Ich spiele dir alles, glaub mir, ich kann alles spielen«, meinte er. »Aber spiel doch das erst mal.«
Er zeigte mir die Noten irgendeines Benny-Goodman-Songs. Ich sah hin, ja, das war wirklich verzinkt und herausfordernd.
»Mit dieser Musik der großen amerikanischen Bands bin ich groß geworden. Swing ist mein Leben.«
»Okay«, sagte ich, »versteh ich, ist ja auch nicht schlecht. Aber ich möchte viel lieber Rock ’n’ Roll spielen!«
»Okay, das akzeptiere ich«, sagte mein Schlagzeuglehrer. »Trotzdem bleiben wir erst mal bei den Grundrhythmen des Swing. Aber pass genau auf: Der Drummer ist der Herzschlag einer Band. Er gibt das Tempo vor, und er hält es, egal was passiert. Alle müssen sich darauf verlassen können.«
Das gefiel mir allerdings.
»Denk immer daran: Drumming ist nie Solo, außer du spielst eins, nie Ego. Du fügst dich ein, du dienst dem Gesamtsound. Immer im Hintergrund, aber unverzichtbar. Du trägst die anderen.«
Die strikten Übungszeiten zu Hause nervten mich. Ich sparte für ein Practical, ein Übungsschlagzeug mit Gummiflächen. Damit konnte ich spielen, wann immer ich wollte. Mein Lehrer war sehr streng. Technisch und musikalisch war er nicht zu überbieten. Er bestand beispielsweise auf dem traditionellen Griff für die Stöcke. Oder er ordnete ständiges Üben von Paradiddles und sämtlichen Betonungsmöglichkeiten der Triolen an. Und ich sollte erst einmal sämtliche Grundrhythmen erfassen: Swing, Shuffle, Sechsachtel- und Dreivierteltakt. Außerdem das Ungleichgewicht zwischen linker und rechter Hand ausbügeln.
Drums, das war meine Welt. Die erste Schülerband wurde gegründet. Wir spielten alles nach, was uns gefiel und was wir hinbekamen. Die Wochenenden verbrachten wir im Star-Club oder im TopTen auf der Reeperbahn, um uns von den englischen Livebands Anregungen und Ansporn zu holen. Leider habe ich die Beatles dort nie gehört.
Wir übten in der Schule und in irgendwelchen Kellern. Die ersten Auftritte kamen, mehr oder weniger erfolgreich. Wir spielten im Grünspan. Wurden Zweiter beim Schülerband-Festival im Star-Club. Parallel zu uns gab es eine Band, die im Star-Club regelmäßig auftrat: The Rivets. Sie boten mir an, als Schlagzeuger einzusteigen, aber ich war unentschlossen. Sie wollten nämlich richtige Profis werden, also Schule schmeißen und auf Tour gehen. Sie hatten durchaus Chancen, ähnlich wie die Lords damals, hatten bereits eine oder zwei Platten auf dem Markt, komponierten selbst. Ich war mir aber nicht sicher, ob Musiker wirklich mein Beruf werden sollte.
Allerdings hatte ich die Schule wieder komplett vernachlässigt und blieb zum zweiten Mal sitzen. Dieses Mal musste ich die elfte Klasse wiederholen. Meine Eltern waren sehr tolerant, sie schimpften nicht, halfen mir, die Schule zu wechseln und die Oberstufe auf einem musischen Gymnasium zu überstehen. Da ging es mir besser. Mein Klassenlehrer war so etwas wie ein Laienspielpapst, er schrieb Theaterstücke und inszenierte sie mit Schülern, ich probierte mich aus. Das Spielen machte mir großen Spaß, aber auf die Idee, es zu meinem Beruf zu machen, kam ich noch nicht.
Nach meinem Abitur zog meine Familie nach München. Mein Vater hatte die Außenredaktion der Hörzu übernommen. Zum Abschied schenkte mir mein Schlagzeuglehrer sein komplettes Drumset. Er hatte sich eine neuere Version zugelegt. Ich war zutiefst gerührt. Mit dem überragenden Sound dieses Sets hatte ich in München in kürzester Zeit eine Band gefunden. Sie hatten einen afroamerikanischen Sänger, und wir traten meistens in den Klubs der amerikanischen Kasernen auf. Eine unvergessliche Zeit. Wir spielten alle bekannten Motown-Titel. In den Pausen gab es echte, frisch gebratene Hamburger. Mir läuft noch heute das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran denke. Dazu ein kaltes Bier. Einfach unwiderstehlich.
Meine Liebe zu den Amerikanern wuchs. Der Humor, die Leichtigkeit, ich wollte unbedingt in die USA reisen. Aber das sollte noch dauern.
Als ich nach dem Abitur auf die Schauspielschule ging, lief die Musik noch parallel, und ich konnte das Schulgeld davon bezahlen. Doch als das erste richtige Engagement kam, war Schluss mit lustig: Die Drums wurden verkauft.
Nichtsdestotrotz: Mein Interesse für das Schlagzeug ist geblieben. Wenn ich heute in irgendeiner Stadt an einem Musikgeschäft vorbeikomme, drücke ich mir immer noch die Nase platt. Ich will die neuesten Kreationen und Verbesserungen der Drums sehen. Und wenn die Sehnsucht überhandnimmt, schaue ich auf YouTube »Drummerworld«.