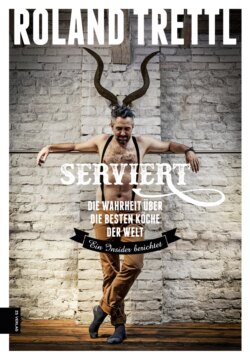Читать книгу Serviert - Roland Trettl - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Deutsche Küche, Sushi und Erdbeeren. Mein Jahr in Japan
Оглавление2002 zog ich nach Tokio, weil sich einige Zufälle merkwürdig zusammenfügten. Ein deutscher Konditor namens Karl Joseph Wilhelm Juchheim hatte in Japan in den 1920er-Jahren ein Baumkuchen-Unternehmen aufgebaut. Dieses war nach dem Krieg in japanische Hände übergegangen, pflegte aber dennoch seine deutsche Tradition. Der deutsche Designer Peter Schmidt hatte Juchheim ein starkes Markenoutfit verpasst, und jetzt wollten die Verantwortlichen ein deutsches Restaurant eröffnen, um den Markenauftritt zu unterstützen. Ein deutsches Restaurant in Tokio brauchte natürlich den berühmtesten Patron, und das konnte nur Eckart Witzigmann sein. Und wie immer in den vorangegangenen zehn Jahren war, wo Witzigmann draufstand, auch Trettl drin.
Im Herbst bekam ich in München einen Anruf: „Roland, in Tokio gibt es ein Problem. Du musst kommen.“
„Okay. Wann?“
„Morgen. Dein Flug ist gebucht.“
Ich hatte gerade noch Zeit, eine Zahnbürste einzupacken und mir das Buch Kulturschock Japan zu kaufen. Das Buch habe ich im Flieger gelesen. Und dann half ich eben mit, das Restaurant aufzubauen. Das befand sich zu dieser Zeit ja noch im Rohbau. Ich organisierte die gesamten Einkäufe und schrieb die Menükarten.
Das war eine coole Erfahrung, denn es erlaubte mir, in die unglaubliche Welt japanischer Lebensmittel einzutauchen. Bei allem, was ich bis dahin schon gesehen hatte – in der „Aubergine“, im „Tantris“, im „Ca’s Puers“ –, waren japanische Lebensmittel mit Abstand das Beste, was ich bis dahin erlebt hatte.
Was bei uns als Spitzenklasse gilt, wäre in Tokio maximal Durchschnitt. Ganz egal, ob es Fisch, Obst oder Fleisch ist. Jeder Apfel ist saftiger als die Äpfel bei uns. Ich habe Tomaten gegessen, die so gut waren, dass mir die Tränen über die Wangen gelaufen sind. Ich hatte noch nie etwas so Gutes gegessen.
Man steht in Japan den Lebensmitteln viel respektvoller gegenüber als bei uns. Man investiert mehr Geld in gute Produkte – und das muss man auch, weil die besten Produkte ein Vermögen kosten. Man hängt einer ganz anderen Ökonomie an als wir: ein Wagyu-Rind zum Beispiel darf lange klein bleiben und langsam wachsen, bis es die Fleischqualität hat, die wir so bewundern. Bei uns kann alles gar nicht schnell genug gehen, weil im Hintergrund immer der Zähler mitläuft, ob das Rind auch schon wieder ein paar Kilo zugelegt hat, damit es sich endlich lohnt, es zu schlachten.
So denkt in Japan niemand. Und auch wenn ich nie ein Japaner sein könnte, halte ich die japanische Esskultur für die sauberste und sensationellste, die ich je kennengelernt habe. Ich muss nur den Aufwand vergleichen, mit dem wir daran arbeiten, verschiedene Fonds einzukochen und zu definieren, Kalbsjus und Wachteljus und Taubenjus und Entenjus und Fischfond und Tomatenfond.
Einem Japaner muss das völlig bescheuert vorkommen. Er hat genau einen Grundfond, das ist sein Dashi. Und dieser Dashi ist eben perfekt, weil er das perfekte Kombu, also Seetang, verwendet, und die perfekten Bonito Flakes und eine Sojasauce, von der wir nur träumen können.
Denn wir verwechseln ja die Kikkoman-Sauce, die wir alle in unseren Kühlschränken stehen haben, mit Sojasauce – das ist ungefähr so, wie wenn man einen Rotwein aus dem Tetrapak mit einem feinen, eleganten Burgunder vergleicht. Es liegen Welten dazwischen. Galaxien.
Die Japaner haben also ihren perfekten Dashi. Das ist der Basissud von jedem weiteren Sud. Wenn es aber um diese Produkte geht, dann reicht oft schon ganz wenig davon, um einen glücklich zu machen. Wagyu-Rind, weil wir das schon angesprochen haben, wird als Tataki oder Sukiyaki gegessen, und zwar ein winziges Stück davon – wenn du nämlich hundertfünfzig Gramm Wagyu Beef isst, erleidest du augenblicklich einen Eiweißschock.
Traumwelten: kein besserer Fisch als in Japan
Zum Respekt vor dem Produkt gehört auch die Pflege der Messer. Japaner pflegen ihre Messer leidenschaftlich. Sie kommen eine Stunde vor Dienstantritt, um täglich ihre Messer über den Stein zu ziehen und sie so präzise wie möglich zu schleifen.
Schon an diesem Beispiel habe ich erkannt, dass ich nie zum Japaner werden könnte. Auch wenn ich diese Eigenschaft, den Respekt vor dem Werkzeug, aufrichtig bewundere. Die enorme Traditionsverbundenheit gebietet diesen Respekt und führt zu großartigen Ergebnissen. Dafür bleibt allerdings jede Spontanität auf der Strecke, und diese Spontanität ist mein größtes Kapital als Koch.
Die Qualität der japanischen Produkte ist ein Statussymbol. Du bringst, wenn du irgendwo eingeladen bist, nicht eine Flasche Wein als Gastgeschenk mit, sondern eine Melone. Natürlich nicht irgendeine Melone, und es reicht auch nicht, dass die Melone gut ist – sie muss außerdem schön sein. Du zeichnest dich selbst aus, wenn du als Geschenk eine besonders schön gezeichnete Melone mitbringst, und wenn sie schön ist, wird die Schönheit auch ausführlich besprochen und gelobt.
Aus diesem Grund habe ich es auch nicht gewagt, einen japanischen Koch in den „Hangar-7“ einzuladen. Wir hatten nur einmal einen Koch aus dem „Park Hyatt“, der gemeinsam mit einem österreichischen Executive Chef gearbeitet hat. Der besaß schon ein gewisses Gefühl für die Fallhöhe zwischen japanischer und europäischer Kochkunst.
Weil bei japanischen Spitzenköchen hast du es mit abartigen Produktfanatikern zu tun. Da kann es dir passieren, dass der Koch einen lebendigen Fisch vor sich auf dem Tisch liegen hat und dir erklärt, dass der Fisch nicht frisch genug ist – und das ist keine Pointe, sondern die Wahrheit. Vielleicht ist der Fisch zwar frisch genug, weil er gerade erst getötet wurde, aber er wurde falsch getötet. Für jeden Handgriff gibt es eine Tradition, und die Spitzenköche beherrschen diese Traditionen blind, während wir in ihren Augen unwissend sind.
Ich finde das nicht unbedingt sympathisch. Aber ich habe einen Riesenrespekt davor.
Gleichzeitig gibt es in einer Stadt wie Tokio natürlich auch einen gewaltigen Underground, eine Subkultur. Ich habe auch sehr schräge Vögel kennengelernt. Manche waren Künstler, manche habe sehr erfolgreich Business gemacht, mit denen habe ich mich durch die Klubs und Hinterzimmer der Stadt treiben lassen. Ich war zu dieser Zeit selbst ein bunter Vogel, hatte blond gefärbte Haare und einen Beckham-Irokesenschnitt, und nachdem das japanische Fernsehen eine Reportage über mich gedreht hatte, war ich sogar einigermaßen bekannt und wurde immer wieder auf der Straße angesprochen.
Auf jeden Fall wurde ich überallhin mitgenommen. Eines Abends – und jetzt kommen wir zum, hmhm, Lebensmittelteil der Story – landeten wir in einem Undergroundlokal, wo eine ganz besondere Spezialität angeboten wurde. Dort gab es Mädchen, die eine Woche lang nichts als Erdbeeren gegessen hatten. Die kackten vor den Gästen auf den Tisch, und das Ergebnis wurde mit Reis gegessen.
Bis dahin hatte ich geglaubt, es gibt nichts, was ich nicht esse. Aber an diesem Abend habe ich gepasst.
Solchen Menschen – den Produktfetischisten jeden Zuschnitts – sollte ich die Vorzüge der deutschen Küche nahebringen. Es war sinnlos, aber es war spannend. Natürlich hat sich angesichts der vorhandenen Foodqualität die Sinnfrage gestellt, warum man den Japanern die Vorzüge der deutschen Küche nahebringen sollte. Aber ich möchte die Zeit auf keinen Fall missen, denn ich habe so viel über Produkte gelernt wie zu keiner anderen Zeit.
Mein Aufenthalt in Tokio endete abrupt. Ich musste wegen des „Hangar-7“-Projekts zurück nach Europa, und als ich dann wieder nach Tokio kam, wurde ich am Flughafen festgenommen. Ich hatte gegen die Visumvorschriften verstoßen. Ich war ohne entsprechendes Visum viel zu lange in Tokio geblieben und hatte nicht einmal den üblichen Abstecher nach Korea gemacht, um der Form halber ausgereist zu sein, damit die Frist für das Touristenvisum von Neuem anlaufen kann.
Ich wurde zuerst neun Stunden lang verhört und dann für zwei Tage ins Gefängnis gesteckt. Anschließend wurde ich abgeschoben. Sie haben mich in Handschellen zum Flieger gebracht und zu meinem Platz geführt, was vor allem meine Sitznachbarn begeistert hat. Meinen Pass hat der Flugkapitän übernommen, und in München wurde ich von zwei Polizisten abgeholt, die mich aus dem Flieger zum Ausgang gebracht und dann entlassen haben.Von diesem Augenblick an hatte ich vier Jahre Einreiseverbot in Japan.