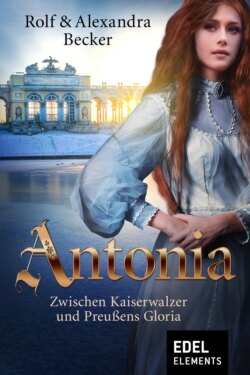Читать книгу Antonia - Rolf Becker - Страница 10
Gut Herrenhausen, Soldin
Оглавление»Niemand«, sagte der General, »soll sich unterstehen, mit ungeputzten Schuhen beim Frühstück zu erscheinen!«
Wen er damit meinte, wußte er nicht. Es war seine Gewohnheit, stets einen solcher markigen Sätze zu verkünden, sobald er eine Stuhllehne in die Hand nahm, um sich an den Tisch zu setzen.
Die Generalin, meist kühl und etwas mokant, sah nur kurz auf. Sie kannte die Kalendersprüche ihres Gemahls. Weiß der Himmel, welche Art innerer Befriedigung er beim Postulieren alltäglicher Notwendigkeit empfand!
Hanna von Kronburg saß bereits neben ihrer Mutter.
»Erstens«, sagte der General und sah Hanna streng an, »sollst du nicht sitzen, bevor ich sitze, und zweitens ist dieser Stuhl nicht für dich da!«
Hanna sah auf. »Warum soll ich denn nicht hier sitzen?«
»Weil dort dein Bruder sitzt.«
»Mein Bruder ist in Wien.«
»Dein Bruder ist nicht in Wien, sondern er befindet sich auf der Reise nach Wien. Das ist ein Unterschied!«
»Psst!« machte die Mutter in der Absicht, das gereizte Gespräch zwischen Vater und Tochter zu unterbrechen.
Der General sah sie aus großen, blauen Augen an.
»Ich werde mir doch wohl noch erlauben dürfen, die Denkfehler meiner Tochter zu korrigieren, ohne daß du mich gleich niederzischt!«
»Wenn du so willst, ist es kein Denkfehler, sondern ein Sprachfehler«, lächelte sie.
»Ein Sprachfehler ist, wenn jemand lispelt!« entgegnete der General und nahm wütend seine Serviette. »Thema durch. Ein Brötchen, bitte!«
Hanna seufzte und reichte ihrem Vater den Brotkorb.
So ging das nun jeden Morgen. Der Vater wurde erst leidlicher, wenn er von einer Rundfahrt über das Gut heimkam. Geputzte Schuhe oder nicht, falscher Stuhl hin und her – ihr war das völlig gleichgültig. Hauptsache, Vater ließ sie Minka reiten. Doch auch was dieses Pferd betraf, hatte Papa meist eine eigene Meinung, und die lief gewöhnlich darauf hinaus, daß nur ein Mensch die Stute reiten konnte, und das war er. Hannas übertrieben männliche Art, im Damensattel etwas zu groß gebaute Hindernisse zu überspringen, mißfiel ihm.
Ihm mißfiel überhaupt manches an seiner Tochter. Ihm war schleierhaft, wo sie ihre Erbanlagen herhatte. Seine Frau Melanie war schlank, zierlich und elegant, er selbst hochgewachsen und langbeinige Beide Eltern, wie man im Reiterjargon sagen würde, hoch im Blut stehend. Hanna dagegen glich mehr einem Kaltblüter.
Sie war ebenfalls groß, langbeinig, doch wirkte an ihr alles etwas zu groß, zu üppig, zu derb. Der schmale, dunkelhaarige Alexander mit den etwas engstehenden Augen war Melanie von Kronburg nachgeraten. Hanna hingegen war blond und... eben derb. Da halfen auch die hübschesten Schuhe und die zartesten Roben nichts, die ihre Mutter in Berlin für sie zu kaufen pflegte.
»Pommersche Beene und Pariser Schuh«, sagte der General und lachte.
Frau Melanie lachte nicht. Sie sah ihre Tochter meist etwas nachdenklich an. Wie sollte man dieses große, sportliche Mädchen unter die Haube bringen?
Am nächsten Tag hatte Melanie von Kronburg in Berlin einige Besorgungen zu erledigen. Es war ein heißer, schwüler Tag, und sie war froh, um einen Zug früher als ursprünglich vorgesehen, wieder zurückfahren zu können.
Die Fahrt nach Soldin war lang, ungemütlich und ohne Reiz. In den Sommerwagen der 4. Klasse saß viel einfaches Volk, Leute mit Körben, Tüchern und lebendem Federvieh.
Man spürte die Nähe des Landes, die Sprache der Bahnsteigbeamten klang von Station zu Station weniger berlinerisch. Man hörte mehr und mehr schlesische Betonungen, obgleich Schlesien noch weit entfernt war.
Der Eilzug führte nur einen Wagen der i. Klasse. Mehr hätte sich auf dieser Strecke nicht gelohnt.
Melanie von Kronburg fühlte sich jedesmal erleichtert, wenn sie Adolf Puttke auf dem Soldiner Bahnhof stehen sah. Adolf Puttke war breitbrüstig und dick, hatte eine rote Nase und große, fleischige Hände. Puttke behauptete zwar, die rote Nase von den Unbillen der ländlichen Witterung erhalten zu haben, doch glaubte ihm das außer seiner zahlreichen Kinderschar kein Mensch. Denn allzuoft sah man ihn zu seinem Taschenfläschchen greifen.
Puttke war Kutscher der Familie von Kronburg. Die roten, rissigen Hände hatte er von der Gartenarbeit. Hätte ihn seine Herrschaft beim Fahren jemals ohne Handschuhe erwischt, hätte es bestimmt Ärger gegeben.
Puttke also erschien Melanie von Kronburg als freundliches Zeichen heimatlicher Gefilde, vor allem aber Erlösung von einer langweiligen, staubigen Eisenbahnfahrt.
Soldin war ein winziges Städtchen, das kaum irgendwelche Bedeutung hatte – außer der Tatsache, daß das Gut und Schloß Herrenhausen dort stand. Daneben gab es noch eine winzige »Tüten- und Couvertfabrik«, eine Sattlerei und – moderne Errungenschaft des Jahres 1880: – einen Schlachthof. Dieser war nicht ohne das tatkräftige Einwirken des Freiherrn von Kronburg entstanden, obwohl Melanie es im Grunde ihres Herzens geradezu plebejisch fand, daß ihr Mann sich um solche Dinge kümmerte.
Ihrer Meinung nach hätte es völlig genügt, wenn sich Gutsdirektor Bergmann der Sache angenommen hätte. Direktor Bergmann bewohnte eine geräumige Wohnung im Gutshaus, hatte eine große, blonde Frau mit üppigem, wohlgeformtem Busen und sechs blonden Söhnen, von denen einer stets kränkelte.
Eitel Friedrich von Kronburg liebte die Gesellschaft des Gutsdirektors, der ein tüchtiger Mann war und den Preis der Gutsbutter von 88 Pfennig pro Pfund immerhin auf 90 gesteigert hatte.
Werner Bergmann spielte einen guten Skat und sein blondes Weib nicht minder. So oft der Freiherr die beiden auch zum Skat herüberholte, so wenig verloren sie den Sinn für Abstand und gebührende Anrede.
Melanie haßte Kartenspiele. Es langweilte sie dermaßen, daß sie sich nicht einmal imstande fühlte, auch nur den Versuch zu machen, irgendein Spiel zu erlernen. Sie hielt sich lieber an ihre Musik, Fingerübungen von Czerny, Etüden von Chopin und an gelegentliche Handarbeiten. Für sie blieben Bergmanns »die Leute«, und der pausbäckige Bauerncharme der Frau Gutsdirektor schien ihr in seiner allzu betonten Gesundheit geradezu peinlich. Diese Frau genierte sich nicht, ihr sonnenverbranntes Gesicht vorzuzeigen und beim Lachen sämtliche Zähne zu entblößen. Auf Melanies Frage, was sie denn gegen diese fatale Bräune tun wolle, hatte doch Frau Bergmann lachend «nichts!« geantwortet. Naja!
Melanie dachte sich ihr Teil und empfahl ihrer Tochter Hanna einmal mehr, sich nicht der Sonne auszusetzen; wenn aber das Unglück passiert sei, den Teint mit bleichender Quarkcreme zu behandeln und auch tagsüber Milchkompressen zu machen.
Solch wichtiger Dinge im Leben einer Frau gedenkend, hatte Melanie von Kronburg kaum bemerkt, daß die staubige Fahrt zum Schloß beendet war und Adolf Puttke in strammer Haltung vor dem geöffneten Wagenschlag stand, um der Frau Baronin herauszuhelfen.
Der General liebte die Bezeichnung »Schloß« nicht.
»Ein Schloß hat auf einem Berg zu stehen und mit vielen Türmen in den Himmel zu ragen«, sagte er gern. »Was wir hier haben, ist ein Haus!«
Er hatte nicht ganz unrecht: Schloß Herrenhausen stand weder auf einem Berg, noch ragte es mit Türmen in den Himmel. Es war ein langgestreckter, zweigeschossiger Bau mit zwei Flügeln und einem vorgebauten Mittelteil. Die Auffahrt war aus schlichtem Backstein. Nun ja, man hatte schon schönere und elegantere Auffahrten gesehen. Dafür entschädigte das breite Portal mit prächtigen, wertvollen Schnitzereien.
»Wer das mal angeschafft hat, weiß kein Mensch«, verkündete der alte Kronburg hin und wieder, »für mich ist das lauter unnötiges Tamtam!«
Das ›unnötige Tamtam‹ war indessen eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges, und Frau Melanie hatte bereits des öfteren versucht, ein gläsernes Vordach anbringen zu lassen, um die Schnitzereien vor der Witterung zu schützen.
Doch das erzürnte den General:
»Wenn diese Tür nur zum Angucken und nicht zum Auf- und Zumachen da ist, dann ist sie keine Tür und kommt weg!«
Melanie hatte zu schweigen, und sie wußte es. Vielleicht hatte sie ja unrecht, und die Behauptung ihres Mannes stimmte, daß Schäden in der Schnitzerei jederzeit repariert werden könnten. Ein wenig hatte sie die hausherrlichen Anordnungen jedoch umgangen, indem sie Linden vor der Auffahrt setzten und kugelrund stutzen ließ, so daß die Bäume zwar kein Licht nahmen, doch die Vorderfront des Portals schützten.
Auch der immer zur rechten Zeit erneuerte weiße Anstrich des Schlosses war ihre Idee. Sie liebte Helligkeit und Akkuratesse. Ihre Mutter, Baronin Wagenhausen, hatte lange in Frankreich gelebt und sie die Liebe zum Licht gelehrt.
Vielleicht wäre Melanie sehr glücklich geworden, hätte sie, wie ihre Eltern, in der Provence leben dürfen. Doch galt ihre Heirat mit dem begüterten Reichsfreiherrn von Kronburg als ein Glücksfall, und niemand hätte in damaligen Zeiten danach gefragt, was eine westpreußische Baronesse für seltsame Gelüste nach dem französischen Landsitz ihrer Eltern gehabt hätte.
Außerdem:
»Franzosen sind nun mal unsere Erbfeinde, meine liebe Melanie«, behauptete der General, »und so halte ich es für ein selbstverständliches vaterländisches Gebot, sich nicht nach ländlichen Ferien in Frankreich zu sehnen.«
Melanie hatte gehorsam und verschüchtert genickt. Nein, niemals würde sie wieder davon sprechen, niemals die strahlenden, jubilierenden Farben der Provence Wiedersehen, die geliebte, schon ein wenig harte Sprache hören oder gar ganz dort leben wollen. Sie hatte einen Mann, einen guten, ehrsamen, bedeutenden und zum Herrschen fähigen Gatten, und sie verstand es vollkommen, daß solche Gedanken zu unterbleiben hatten.
So jedenfalls hatte sie in den ersten Jahren ihrer Ehe gedacht.
Und doch hatte die Erinnerung an die Sommer ihrer Kindheit ihren Geschmack zu sehr beeinflußt, als daß sie nicht in der Einrichtung der Empfangsräume spürbar geworden wäre. Nannte ihr Mann das Meublement, die Tapeten und Vorhänge auch viel zu verspielt, so war es ihr doch wenigstens mit Hilfe von Voiles, Seiden und hellblauem Samt gelungen, den großen, dunklen Zimmern Freundlichkeit und Licht abzugewinnen.
Eitel Friedrich von Kronburg hatte seiner Frau gegenüber niemals auch nur den leisesten Zweifel darüber gelassen, daß männlicher Geschmack die Entscheidung über das »ob und wie« bedeute und ein Gespräch darüber ausschließe. Wenn er dennoch seiner Frau die Gestaltung der Empfangsräume überließ, so geschah dies mit jener amüsierten Gelassenheit, die das männliche Geschlecht gegenüber weiblichen Eigenmächtigkeiten den Standpunkt eines Herrn-und-Hund-Verhältnisses einnehmen läßt. Natürlich aber hätte Eitel Friedrich eine solche Beurteilung mit Empörung zurückgewiesen.
Melanie hingegen fand das meiste, was ihr Gatte tat und plante, wundervoll, und was nicht unter die Rubrik »das meiste« fiel, verbarg sie tief in ihren durchaus wachen Gedanken. Gehorsam, Einsicht und Zurückhaltung hatten nun mal die vornehmlichsten Eigenschaften einer deutschen Edelfrau zu sein! Eigenschaften, die nach Ansicht Eitel Friedrichs sehr viel zu dem glänzenden Aufstieg Preußens beigetragen hatten.
»Das Herz des Deutschen Reiches schlägt in Preußen«, war seine Meinung. »Und dieses Herz hat jederzeit am rechten Fleck zu schlagen.«
Melanie raffte ihre Röcke und seufzte ein wenig. Puttke lächelte ihr zu und half ihr behutsam beim Aussteigen.
›Die Frau Baronin ist ein schönes Frauchens dachte er bei sich. ›So überaus fein und sinnig. Eigentlich viel zu zart für den Baron !‹
Im Hause angekommen, kleidete sich Melanie um und erwartete, daß Hanna sie begrüßte. Doch Hanna hatte wieder einmal keine Notiz davon genommen, daß ihre Muter aus Berlin kam, hatte sieh gedankenlos, wie sie meistens war, auf einen längeren Ausritt begeben.
›Leer! Das Haus ist so oft leer‹, dachte Melanie und legte die silbernen Hutnadeln in ein längliches Schildpattkästchen. »Niemand außer dem Personal begrüßt mich. Immer sind alle mit irgend etwas beschäftigt. Und wenn sie nicht beschäftigt sind, spielen sie Skat... Der preußische Sommer ist eine mühselige, staubige Jahreszeit. In der Nachbarschaft gibt es kaum jemanden, den ich sehen möchte, wenn es nicht sein muß. .
»Bleiben Bergmanns und ihre Söhne. Und sie fangen auch schon an, Karten zu spielen...‹
Hanna hatte sich keineswegs auf einen so langen Ausritt begeben, wie sie im Gut gesagt hatte. Dazu war es zu schwül.
Sie war abgestiegen und führte ihr Pferd am Zügel. Die brave Minka trottete geduldig hinter ihr her.
Hanna hatte weder einen Hut auf dem Kopf noch ein Tuch umgebunden. Ungehindert brannte die Sonne ihr ins Gesicht. Irgendwie gefiel ihr das. Sie öffnete ihre Haare und schüttelte sie. Hanna hatte schönes, starkes Haar, doch der Vater liebte keine »Pferdemähne« an jungen Mädchen, und so mußte sie ihr Haar stets hochstecken. »Oder willst du wie eine Windsbraut mit flatternden Haaren reiten?« fragte er öfters.
Wenn er nur geahnt hätte, wie gern sie Windsbraut oder Hexe mit flatternden Haaren wäre!
»Ich darf nichts!« war ihre beständige Antwort, wenn ihre Eltern ihr wieder einmal etwas verboten.
›Mein ganzes Leben besteht aus Verboten und Gebotene hatte sie einmal in ihr Tagebuch geschrieben. Nichts von dem, was man von ihr verlangte, fand sie notwendig. Warum nicht die Haare offen tragen, warum nicht krumm sitzen, wenn man müde war, warum nur lächeln, warum den Blick senken, wenn man sich für etwas interessierte?
Warum, wie ihre Mutter, zu allem Ja und Amen sagen?
War denn ein Mann der Mittelpunkt der Welt? War es so schön, tagaus, tagein nichts als Befehle entgegenzunehmen und sich von morgens bis abends seines Deutschtums bewußt sein zu müssen?
Sie sehnte sich nach einem Internat. Oft genug hatte der Vater es als Drohung gesagt: »Wenn du so weitermachst, schicken wir dich in ein Internat!«
Wie denn »so« weitermachen? War ihre Art zu leben strafbar? Immer wieder wurde ihr vorgehalten, was sie falsch machte, was sie für Beine hatte, wie dämlich sie wieder gelacht hatte.
Einmal war ihr Zimmer zu unordentlich, das nächste Mal hatte sie einen ›Gang wie ein Dragoner‹ und wenn’s dem Herrn Vater besonders fröhlich zumute war, behauptete er, sie bekäme vom vielen Reiten einen richtigen ›Pferdehintern‹.
Wie anders war doch alles mit Mutter! Aber da gab es auch eine endlose Reihe von ›Das-tut-man-nicht‹, nur daß es bei der Mutter immer um die Schönheit ging.
»Ich bin nun mal nicht schön und werde es nie werden«, sagte Hanna oft und betrachtete ihre zarte, elegante Mutter liebevoll.
»Mutter paßt eigentlich gar nicht nach Soldin«, hatte sie einmal zu ihrem Vater gesagt. Der hatte nur geseufzt und »Weiß Gott!« gesagt. Und damit war das Gespräch beendet gewesen.
Das war überhaupt so eine Sache: Mit Vater konnte man sich nie unterhalten. Keiner konnte das. Wenn er seine Meinungen und Urteile bekannt gegeben hatte, begann er zu fragen. Doch diese Fragen waren niemals etwas anderes als Empörung über irgend etwas, das man ihm zumuten wollte. Und damit war dann jedes Gespräch im Familienkreis an jenem Punkt angekommen, den der General mit »Thema durch!« markierte.
Hanna blieb auf dem Feldweg, den sie mit Minka entlangging, stehen. Sah auf die Getreidefelder, den Waldrand, den kleinen Heuschober.
Wie gerne hätte sie sich ins Gras gelegt und einfach geschlafen.
»Kannst du nicht auf deine Bluse achtem, würde es dann wieder heißen.
Aber Vater und Mutter würden sowieso etwas finden. Warum sich also nicht einfach ins Feld legen, wenn in jedem Fall mit ihr herumgemeckert werden würde? Hanna lachte ein bißchen.
»Ich muß Schatten für Minka suchen. Dann werde ich sie anbinden und für mich einen Platz zum Ausruhen finden.‹
Sie sah sich erneut um. Sie war noch nicht oft in diese Richtung geritten. Die Wege waren nicht günstig für zarte Pferdebeine. Aber heute, wo sie das Pferd nur als Ausrede benützt hatte, um aus dem Haus zu kommen, hatte sie ihr Weg hierhergeführt.
Vielleicht, daß sie zu diesem Heuschober ging? Dort war auf jeden Fall Schatten genug für Minka.
Kaum hatte sie das Pferd festgemacht und sich an die Holzwand gelehnt, wurde sie stutzig. Sie hörte ein unterdrücktes, glucksendes Lachen. Ein Lachen, das sie kannte.
Sie setzte sich aufrecht.
»Du sollst mich in Ruhe lassen!« kicherte die Stimme. »Für heute ist es wirklich genug!«
»Das bestimme ich!« sagte eine andere Stimme. Auch die kannte sie.
Wieder das glucksende Lachen.
Dann war eine Weile nichts zu hören.
Plötzlich fragte die Frauenstimme: »Was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn mein Mann was merkt?«
»Dann wird er entlassen«, kam die Antwort.
Die Frau lachte nicht mehr.
»Kommst du heute abend?«
»Wahrscheinlich nicht.«
»Wir könnten eine Bowle machen!«
»Melanie kommt heute abend aus Berlin zurück.«
»Dann ist sie müde und geht früh ins Bett. Die ist doch immer müde!«
»Wie redest du denn? Sie ist schließlich deine Herrschaft.«
Und nun lachte die Frau wieder, ein girrendes Glucksen, das Hanna einfach widerlich fand.
Sie stand auf, nahm ihr Pferd und führte es zum Wald. Dort band sie es an einem Baum fest und versteckte sich im Unterholz. Niemand konnte das Pferd sehen, niemand das Fräulein von Kronburg.
Hanna saß da und starrte auf den Heuschober. Der Himmel bezog sich. Der Horizont wurde dunkelgrau, und ein Windstoß wirbelte Staub auf.
Bei dem Heuschober rührte sich nichts. Es war vollkommen unsinnig, hier zu sitzen und zu warten. Hanna wußte genau, wer da drinnen war. Aber sie wollte es sehen. Jawohl! Sie wollte dieses Liebespaar mit eigenen Augen sehen !
Dann endlich öffnete sich die Tür des Schobers um einen Spalt, ein Mann kam heraus und sah sich um.
Es war ihr Vater.
Hinter ihm stand die Frau des Gutsdirektors und legte ihm die Hand auf die Schulter. Mit einer kurzen Bewegung schüttelte er die Hand ab. Dann gingen sie beide waldeinwärts. Irgendwo mußte der Dogcart des Vaters stehen. Hanna machte sich nicht die Mühe, den beiden nachzusehen.
Der Wind hatte aufgehört, Staub über den Waldrand zu blasen. Die Ähren, sich eben noch dem Winde wie einer zugleich glättenden und aufwühlenden Hand beugend, standen grad und still. Alles außer diesen Ähren schien von einem klaren, tiefen Grau zu sein, in dem jeder Halm, jeder Stein und jede Blume in abgegrenzter Deutlichkeit den Sturm erwartete. Jedes Staubkorn schien sich zu sammeln, stark zu werden. Der Heuschober stand schmutzigbraun, das ausgedörrte Holz seiner Wände abgegrenzt zum weiten, dunklen Grau des heraufziehenden Unwetters.
Diese Deutlichkeit war es, die Hanna in ihrer erstarrten Ruhe verbleiben ließ. Sie machte keinerlei Anstalten aufzustehen.
Die ersten Regentropfen änderten daran so wenig wie der prasselnde Hagelschauer, der ihnen folgte.
Dann aber, durchnäßt und schmutzig, schwang sich Hanna auf ihr Pferd, trieb es zu heftigem Galopp. Und so, mit offenen, wehenden Haaren stürmte sie, Windsbraut unter hagelnden Wolken, zum Schloß.
Sie brachte Minka in den Stall, rieb sie mit Stroh trocken und ging die Auffahrt hoch. Das geschnitzte Portal war feucht und mißhandelt vom Hagel.
In der Halle sah sie die gestickte Reisetasche ihrer Mutter. Schnell ging sie die Treppe hinauf.
Da öffnete sich die Tür des Salons. Ihre Mutter stand auf der Schwelle und sagte freundlich:
»Oh, mein armes Kind! Was bist du naß geworden! Aber ich freue mich, dich wiederzusehen!«
Einen Augenblick nur verhielt Hanna ihren Schritt.
»Entschuldige bitte«, sagte sie, »aber meine Kleider sind feucht und verknittert, meine Haare sind auch in Unordnung! So möchte ich mich dir nicht zeigen.«
Und blitzschnell sauste sie in ihr Zimmer, um nach kurzer Zeit, hübsch gekleidet und frisiert, in Mutters Salon zu erscheinen.
»Ich dachte, du magst dieses Kleid nicht leiden?« sagte die Baronin.
»Ich weiß aber, daß es dir gefällt«, lächelte Hanna, setzte sich neben die Mutter und streichelte ihre Hand. »Es ist schön, daß du wieder da bist, Mama!«
»Ich glaube, du wirst allmählich erwachsen«, lachte Melanie und sah sehr hübsch aus in diesem Augenblick. »Du beginnst, dich adrett zu kleiden.«
»Ja«, antwortete Hanna und strich über ihr hochgestecktes, nasses Haar.