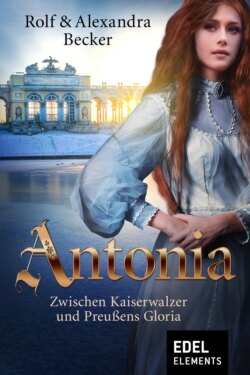Читать книгу Antonia - Rolf Becker - Страница 8
Frühherbst 1870
ОглавлениеAm 21. September, in einer stillen, mondklaren Nacht, verstarb Elisabeth von Blumenthal. Sie schlief einfach ein, war tot, als man sie wecken wollte.
Sie hinterließ außer dem kleinen Blumenthalschen Besitz fast nichts; keinen Schmuck, nur einen Granatring, den Antonia verächtlich beiseitelegte. Das Gut, recht und schlecht bewirtschaftet, würde gerade so viel erbringen, daß Antonia eine bescheidene Lebensgrundlage hatte.
In Engelhartstetten zu leben, erschien ihr jedoch völlig unmöglich. So zog sie, mit dem Einverständnis der Tante und des Onkels rechnend, endgültig nach Baden. Und tatsächlich, sie wurde dort mit Herzlichkeit aufgenommen. Berthold von Blumenthal sorgte für sie wie ein Vater, ihre kleine Cousine Constance hegte für sie eine zwar scheue, aber heimlich bewundernde Zuneigung, während Tante Marieluis sie mit großem Verständnis für Antonias Hang zu glanzvollem Lebensstil unter ihre Fittiche nahm.
Antonia, die schon nach wenigen Monaten ihre Trauerkleidung ablegte, freute sich auf die Ballsaison, nicht zuletzt deshalb, weil sie ihr ausreichend Gelegenheit bieten würde, mit dem jungen Ferdinand Karascz zusammenzutreffen.
Für die Jaskulkes war der Tod der Gutsherrin kein Unglück. Ihr Leben würde bleiben, was es war: dumpf, arm und von Arbeit erfüllt. Für wen sie schufteten, war gleichgültig. Hauptsache, sie hatten zu essen und wurden nicht davongejagt.
Minna hingegen war unglücklich. Sie hatte keine Nachricht von Antonia erhalten, daß sie in ihren Diensten bleiben solle. Sie besprach sich mit Lilly, überlegte, ob sie dem gnädigen Fräulein schreiben, oder – verwegener Gedanke – ob man sie gar besuchen solle.
Noch wurde Lohn ausgezahlt. Es war, als wäre nie jemand von der Herrschaft gestorben. Wie aber würde es sein, wenn der ältliche Gutsverwalter einmal nicht mehr da war?
Es waren Gedanken, die Minna bewegten, Lilly weniger. Warum sollte sie auch darüber nachdenken, wer ihren Lohn zahlte? Irgend jemand hatte ihn zu zahlen, und das genügte.
Als sich Antonias Beziehung zu Ferdinand Karascz festigte, benutzte sie gelegentlich die Sonntage, um mit ihm aufs Land zu fahren. Solchen Gelegenheiten, so fand Antonia, war Gut Erwenlauh dienlich.
Bei einer dieser Landpartien entschloß sie sich, Lilly und Minna mitzunehmen. Sie ordnete kurzerhand an, daß die beiden ihre Habe zu packen und sich in den nächsten Tagen auf die Reise nach Baden zu begeben hätten.
Es war bezeichnend für Antonia, daß sie nicht den leisesten Versuch unternahm, ihre Tante um Erlaubnis zu fragen, die beiden Dienerinnen nachzuholen. Zwar hob Marieluis leicht die Augenbrauen, als sie von Minnas und Lillys Ankunft hörte. Als sie jedoch erfuhr, daß die beiden aus den Einkünften des Gutes bezahlt werden sollten, war es ihr recht. Der Hochmut ihrer Nichte, so berechnete sie ihr Entgegenkommen, würde sich eines Tages in barer Münze und Ehrungen auszahlen. Außerdem konnten die Mädchen auch in ihrem Hause hilfreich sein.
»Ich liebe dich zärtlich«, sagte Ferdinand Karascz zu Antonia, »aber ich werde die Gräfin Stemblonska nicht verlassen.«
Antonia lächelte und küßte ihn. »Das will ich auch gar nicht.«
Das Leben des Herrn Karascz war, wie man allgemein bemerken konnte, für ihn selbst äußerst angenehm. Daß auf seinem Lebensweg ein paar zerbrochene Herzen lagen, erhöhte nur den Reiz der Liebe. Seine Beziehung zur Gräfin Stemblonska empfand er als angenehm und fördernd ; sie verwöhnte ihn. Daß sie viele Jahre älter war als er, machte sie nur um so geneigter. Zudem sah sie wirklich blendend aus, und er wurde oft um diese Liaison beneidet.
»Ich möchte sie nur kennenlernen«, sagte Antonia nach einer Weile. »Ich will wissen, mit wem ich dich teilen muß.«
Ferdinand sah sie an. Es erstaunte ihn, daß dieses Mädchen sich so selbstverständlich in sein Leben fügte, daß sie nicht die geringsten Anstalten machte, ihn für sich zu beanspruchen.
Antonia und teilen. Ein merkwürdiger Gedanke.
»Was geht in deinem Kopf vor? Du bist wirklich einmal anders als die meisten Mädchen.«
›Wenn du wüßtest‹, dachte Antonia und sah zum Fenster hinaus, ›wie anders, wie vollständig anders ich bin, du würdest nicht dastehen und lächeln. Du würdest nicht wagen, in meiner Gegenwart auch nur an eine andere Frau zu denken.‹
Doch sie schwieg, lächelte Ferdinand zu und bereitete ihm einen strahlenden, ländlichen Sonntag.
Natürlich erfuhr Tante Marieluis von Antonias Liebschaft mit Ferdinand.
»Ich hoffe«, sagte sie nur, »du wirst deinen Weg finden.«
Antonia lächelte.
»Hat dieser junge Mann ernste Absichten?« fragte Berthold von Blumenthal, der natürlich nichts von der wahren Gestaltung der ländlichen Besuche seiner Nichte in Engelhartstetten ahnte.
»Natürlich«, antwortete Marieluis überzeugt.
Das genügte.
Es sollte nicht lange dauern, und Antonia von Blumenthal war ein gern gesehener Gast im Hause der Gräfin Stemblonska.
Niemand ahnte etwas von ihren geheimen Beziehungen zu Ferdinand, am allerwenigsten die Gräfin selbst.
Antonia wurde verwöhnt, angebetet und allerseits als reizendes Geschöpf angesehen, ein Umstand, der Ferdinand nur noch mehr Liebe und Zärtlichkeit für sie empfinden ließ.
Gelegentlich nahm die Gräfin Antonia mit in ihre Schneidersalons, ließ sich von ihr bei der Putzmacherin oder bei der Auswahl von Spitzen und Stoffen beraten. Antonia erwies diese Gefälligkeit mit Freude und wurde meist mit einer neuen Robe, einem Hut, Schleier oder gar einem Spitzenschal beschenkt.
»Das macht man nicht«, sagte Tante Marieluis, deren immer wachem Blick die Neuerungen in der Garderobe Antonias nicht entgingen. »Es wird Zeit, daß man dir Schmuck schenkt. Für Unterröcke bist du zu schade!«
Es war ein Hieb, der saß.
Antonia wurde fast gelb im Gesicht.
Niemand anderer als Marieluis hätte so sicher, so nützlich und so vernichtend für Antonia urteilen können.
Es war am Morgen des Gründonnerstages, als Berthold von Blumenthal zu seiner Frau sagte:
»Es ist so schön – wir sollten zum Osterfest nach Engelhartstetten fahren. Laden wir doch den jungen Karascz dazu ein, vielleicht erklärt er sich, und wir könnten Antonia verloben.«
Der gute Mann hatte keine Ahnung, daß der Herr Karascz Engelhartstetten fast besser kannte als er selbst und daß von Verlobung keine Rede sein würde.
Doch: Was der Hausherr sagt, wird getan.
Constance, von ihrem Schweizer Pensionat zu Ostern beurlaubt, fand ein ländliches Fest ebenso reizvoll wie ihr Vater.
›Warum können sie mich nicht in Ruhe lassen?‹ dachte Antonia. »Warum müssen sie mich besuchen, ohne mich zu fragen, ob es mir gefällt, warum ihr Kind mitbringen?‹
Marieluis ging an ihr vorüber. Ganz leise strich sie ihr über die Schulter.
»Psst!« machte sie und streichelte sie wieder.
Diese Bewegung, ganz zart, fast unpersönlich und ohne Anspruch, berührte Antonia seltsam. Sie empfand etwas wie Dankbarkeit, Rührung und Zuneigung zu dieser hochmütigen Frau.
Einen Augenblick hielt sie die Hand der Tante in der ihren.
»Du bist viel mehr meine Verwandte«, sagte sie, »viel mehr, als es meine Mutter je war.«
Marieluis lächelte, schürzte ihr Kleid und ging schnell aus dem Zimmer.
Die Familie von Blumenthal verlebte ein sonniges, warmes Osterfest, umgeben von blühenden Obstbäumen, schnatternden Gänsen, aufgeregt gackernden Hühnern, frisch gelegten Eiern und dem ersten Spargel. Ferdinand Karascz zeigte sich liebenswürdig, unterhaltsam und erfüllt von neuestem Klatsch. Sein herrlicher Brillantring funkelte in der Sonne, wenn er, von großen Gesten begleitet, vom Wiener Gesellschaftsleben berichtete – geradeso, als wären die Blumenthals nicht ihrerseits oft genug in Wien.
Narzissen, Osterglocken und Tausendschönchen neigten sich in dichter Fülle dem wärmer werdenden Wind, die örtliche Vogelschar veranstaltete ein österliches Frühlingskonzert, und Birkenzweige wehten, von grünenden Knospen in Schleier verwandelt, über der ländlichen Szene.
Am Ostermontag schien die Sonne so stark, daß man unwillkürlich an die staubigen, heißen Sommer denken mußte, jene Sommer, da die Hitze über den hellen Feldwegen stand und alles ringsherum in der Unbewegtheit eines windlosen Tages erstarb.
Antonia beschloß, mit Ferdinand eine längere Spazierfahrt zu machen. Mochte es auch zu warm sein, sie zog es vor, mit Ferdinand aus dem Umkreis der Familie zu fliehen. Onkel Berthold war mit dieser Regelung sehr einverstanden. Hoffte er doch wieder einmal, daß der junge Mann diese Gelegenheit nützen würde, sich endlich zu erklären.
Es wurde eine lange Ausfahrt. Ferdinand kutschierte selbst.
Antonia hatte einen Picknickkorb mitgenommen, falls sie unterwegs rasten wollten.
Ferdinand fuhr weite, schattige Wege, und bald fanden sie einen Platz, der ihrer Liebe und ihrem Wunsch nach Kühle genehm war.
Noch nie war Antonia so glücklich wie an diesem Tage. Vergessen war alles Trennende : die Gräfin, die Familie, mangelndes Geld bei Antonia und mangelnder Adel bei Ferdinand.
Es dämmerte schon, als sie sich auf den Heimweg begaben, und Antonia fürchtete, daß man sie und Ferdinand rügen würde.
Der Himmel war dunkelgrau.
War es wirklich die Dämmerung? Oder waren es Regenwolken?
Antonia hatte diesen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, als auch schon die ersten Böen über die Felder fegten.
Ferdinand schlug mit den Leinen auf die Pferde, nahm die Peitsche und schnalzte zum Galopp.
Die unruhige Natur versetzte die Pferde in Angst, und sie jagten dahin.
Aus dunkler werdendem Himmel grollte es, und erstes Wetterleuchten kündigte ein schweres Frühlingsgewitter an. Kein Tropfen fiel vom Himmel. Ohne Regen peitschte der Sturm die Wälder und Sträucher.
Es schien, als wäre die Nacht hereingebrochen.
Fast schon hatten sie das Gut erreicht, als sich etwas Helles am Horizont zeigte. Der Himmel riß auf, wies zwei weißliche Streifen Tageslicht. Das Licht weitete sich, wurde heller.
»Da!« schrie Antonia auf und streckte die Hand aus.
Inmitten des hellen, grellen Lichtes stand, wie aus dem Himmel herabgestoßen, eine riesige graue Säule, deren Mitte so schwarz war, wie die Nacht kaum sein konnte.
Die Säule aber stand nicht still.
Als käme das Meer auf sie zu, so grollte es um sie herum, zischte zugleich in wütenden, hellen Tönen, ein sich erhebender Lärm überschallte alle anderen Geräusche.
Was eben noch wie eine Säule aussah, wirkte nun wie ein Trichter: Nach oben breit, ungeheuer breit und schwarz, spitzte er sich über der Erde zu.
Die Pferde rissen sich los, die Deichsel splitterte, die Tiere rasten davon.
Ferdinand schrie irgend etwas, stürzte vom Kutschbock, schubste Antonia fort und suchte, vom Wagen fortzukommen.
Vergeblich.
Während Antonia hinter einem Strauch Schutz suchte und fand, kam das Toben und Rauschen in grauenhafte Nähe.
Antonia sah, wie die dunkle Säule, dem Riesenfinger einer Teufelskralle gleich, den Wagen hochhob und zugleich Ferdinand erfaßte. Weit hinaus in den düsteren Himmel schleuderte die Kralle beides: Gefährt und Mensch – um sie mit eben solcher Gewalt auf die Erde zurückzuschleudern.
Antonia, auf dem Bauch liegend, schützend die Hände über dem Kopf haltend, sah das entsetzliche Schauspiel, dem augenblicklich die allertiefste Ruhe folgte.
Nichts war zu hören.
Kein Donner schlug, kein Baum rauschte, kein Zweig knackte. Stille. Nichts als Stille war um sie her.
Und Antonia wußte, daß dies die Stille des Todes war.
Die Windhose hatte den Wagen vollständig zertrümmert; nur Scheiterholz schien geblieben.
Langsam erhob sich Antonia.
Ging an dem Wagen vorbei.
Ging auf das Feld.
Zerschmettert, ohne Gesicht, mit verrenkten Gliedern lag Ferdinand Karascz zwischen großen, schweren Steinen.
Er war tot.
Antonia sah ihn an, kniete nieder und schloß ihm die weit aufgerissenen Augen.
Langsam, als könne sie dem Toten Schmerz bereiten, wandte sie seine fast abgerissene, verrenkt liegende rechte Hand um. Die Gebärde, mit der sie ihm den Brillantring abnahm, hatte etwas Feierliches, Ruhiges.
Als sie, noch kniend, aufsah, stand nur wenige Meter von ihr entfernt eines der beiden Kutschpferde. Antonia ging auf das Tier zu, nahm es beim Halfter und schritt neben ihm.
Es sollte nicht lange dauern, und auch das zweite Pferd fand sich ein. Antonia nahm in jede Hand ein Halfter und ging zwischen den Tieren zum Gut zurück.
Die Straße der Windhose war entsetzlich. Alles, aber auch alles, was sie erfaßt hatte, war vernichtet. Doch kaum einen Zentimeter neben dem Wirbelsturm war ebenso alles erhalten, nicht ein Blümchen geknickt, nicht eine Handvoll Erde bewegt.
Antonia war zu bewegt, zu erschüttert, zu sehr mit ihren Gedanken beschäftigt, als daß sie bemerkte, daß die Spur der Windhose geradewegs auf das Gut zuführte.
Erst als sie vor der Gutseinfahrt stand, sah sie, was geschehen war.
Die Macht der Zerstörung hatte sich voll entfaltet. Es schien, als wären Gutsmauern, Dächer, Fenster, Zäune aus Papier gewesen, so zerborsten und zerschlagen war alles.
Menschen, die zum Gut gehörten, rannten kreuz und quer, Befehle, Schreie und wildes Blöken herumlaufender Kühe und Ochsen erfüllten den Hof.
Verletzte wurden versorgt.
Schritt um Schritt, nur das Klappern der Hufe an ihrem Ohr vernehmend, ging Antonia voran.
Nahe den Gartentischen sah sie zwei Gestalten unter Leinentüchern.
Ging auf sie zu.
Hob jedes der Tücher langsam auf und sah auf die Toten, die darunterlagen.
Erst sah sie das entstellte Antlitz ihres Onkels Berthold. Dann betrachtete sie lange das erstaunte, unverletzte Gesicht ihrer Tante Marieluis.
»Adieu, Marieluis!« flüsterte sie und deckte das Leinen zurück.
Sie hörte ein Schluchzen und sah auf. Neben ihr stand Constance. Da nahm Antonia die Hand ihrer kleinen Cousine, zog das Kind zu den Toten auf die Knie und sprach leise:
»Gegrüßt seist Du, Maria, voll der Gnaden...«
Es folgten schlimme Jahre.
Das entsetzliche Geschehen des Ostermontags hatte Antonia und Constance aller Sicherheiten beraubt.
Die ungeheuren Schäden an den Gutsgebäuden, die Verwüstungen der Felder, die Verluste am Viehbestand waren kaum zu ersetzen. Das elterliche Vermögen war auf gebraucht bis auf den letzten Pfennig. Nur ein florierender Gutsbetrieb hätte Antonia ein verhältnismäßig günstiges Einkommen gesichert. Zudem war versäumt worden, das Gut ausreichend zu versichern.
Constance, ihrer Cousine, ging es nicht viel anders. Ihr Vater hatte gerade so viel hinterlassen, um ihr wenig mehr als eine gute, hausmännische Aussteuer zu besorgen. Von einer in adligen Kreisen selbstverständlich erscheinenden Mitgift würde man absehen müssen.
Constance, noch viel zu jung, um allein zu leben, wurde in das Haus ihrer Tante Belinda Petrouschek auf genommen und mit großer Herzlichkeit an Kindes Statt erzogen. Sie fügte sich gut in die Familie ein und wußte sich bescheiden zu geben. Schnell fand sie ein ausgezeichnetes, freundliches Verhältnis zu den Petrouscheks und ihrem Töchterchen Blanche.
Derart Erfreuliches war von Antonia nicht zu berichten. Von dem liebenswürdigen Angebot der Petrouscheks, mit ihnen im Hause zu leben, machte sie kühl und hochnäsig Gebrauch, so als erwiese sie den Gastgebern mit ihrer Anwesenheit eine hohe Gnade.
Es wurde für die guten Petrouscheks eine unangenehme und höchst unbequeme Zeit. So sehr sich Belinda mühte, ihr freundlich entgegenzukommen, so wenig gelang es ihr.
Antonia paßte nicht in das bürgerlich saturierte Haus der Petrouscheks. Zudem wußte sie durch eine kaum nachweisbare Arroganz den Klassenunterschied zwischen ihr und Petrouschek derart zu betonen, daß sich Belinda jedesmal aufs neue darüber ärgerte.
Was Antonia damals noch nicht wissen konnte, war, daß eben dieser Zuckerbäcker Petrouschek dank des kleinen Vermögens seiner Frau, einiger glücklicher Zufälle und eines über die Maßen geschickten Taktierens einen schnellen geschäftlichen Aufschwung nahm, so daß er nach einigen Jahren nicht nur als einer der reichsten Männer Wiens, sondern in späterer Zeit sogar als einer der wohlhabendsten Fabrikanten Österreichs bezeichnet werden konnte.
»Ich kann dir keine Vorschriften machen«, sagte Belinda Petrouschek zu Antonia, als diese ihr verkündete, sie wolle nun ihrer Wege gehen. »Ich weiß nicht einmal, was du vorhast.«
Antonia lächelte höflich. »Ich werde zu Gräfin Stemblonska ziehen. Sie bat mich darum.«
Belinda blickte zu Boden. »Ich verstehe nicht«, bemerkte sie leise, »was dich in das Haus dieser Dame zieht.«
»Gemeinsamkeiten«, antwortete Antonia kalt. »Wir haben beide denselben Mann geliebt.«
Belinda zog es vor, darauf nicht zu antworten.
»Wir werden dir stets ein offenes Haus bewahren«, sagte sie verabschiedend.
Antonia erhob sich, knickste.
»Küß die Hand, Frau Tant’«, sagte sie und rauschte hinaus.
»Sie ist frech«, sagte Belinda, als sie mit ihrem Mann allein war, »frech und dramatisch.«
»Sowas macht Karriere«, murmelte Petrouschek und betrachtete die Angelegenheit als erledigt.
Was Antonia mit der Gräfin verband, war tatsächlich die einstige Liebe zu Ferdinand Karascz. Die Gräfin, die gerade soviel von Antonia erfahren hatte, wie diese für nötig hielt, empfand mit Antonias Nähe noch den Zauber des geliebten Mannes.
Was sie wohl nicht einmal sich selbst zugegeben hätte, war der geheime Wunsch, Antonia lange, sehr lange in ihrem Hause zu behalten. Denn Antonia entfaltete immer größere Schönheit und Anziehungskraft. Dabei stellte sich heraus, daß sie keineswegs nur jungen, unbeschriebenen Männern ihr strahlendes Lächeln zuwandte, vielmehr bezauberte sie mit verständnisvollen, geistreichen Gesprächen auch ältere Herrschaften.
»Wüßte ich nicht, wie vergänglich Frauenschönheit und wie bleibend Charme ist, ich müßte auf soviel charmante Jugend eifersüchtig sein«, sagte die Gräfin, nicht ohne Spitze gegen Antonia.
So ließ sich für die schöne Comtesse von Blumenthal die Saison vorzüglich an. Bei Petrouscheks zuckte man zwar die Achseln, wenn von ihr die Rede war, doch das störte Antonia wenig. Was ihr fehlte, war die Tante.
Ohne es zu wollen, hatte sie Marieluis geliebt; weniger die Person selbst als das vollkommene Verstehen, das sich mit ihr verband.
Einsamkeit und Kälte hatten in Antonias Herzen mehr Platz, als man dem strahlenden, lebenssprühenden Geschöpf zugetraut hätte. Der Weg, den sie gewillt war zu gehen, war vorgezeichnet.
Für Minna und Lilly begann mit jenem entsetzlichen Ostererlebnis eine traurige Zeit. Zwar waren sie, die zum Helfen mitgenommen worden waren, unverletzt davongekommen. Vom Grauen gepackt, sahen sie dem schrecklichen Schauspiel zu, als Antonia mit Constance neben den Leichen ihrer Verwandten kniete.
Alles, was sie tun konnten, war, jedem, der sie brauchte, zur Hand zu gehen. Der Traum vom Leben in der Stadt aber schien ausgeträumt.
Die Blumenthals waren tot, und Antonia konnte ihnen nichts bieten als eine kärgliche Unterkunft auf dem zum Teil verwüsteten Gut. Mühsam wurde alles, so gut es ging, repariert. Handwerksrechnungen konnten kaum bezahlt werden.
»Warum wohnst du eigentlich nicht bei deinen Eltern?« fragte Minna eines Tages, als sie mit Lilly allein war.
Lilly schüttelte den Kopf. »Nie mehr!« antwortete sie und sah Minna trotzig an.
Minna wunderte sich über die Festigkeit des Ausdrucks in Lillys Gesicht. Mehr noch aber wunderte sie sich darüber, daß Lilly, die nun schon recht erwachsen aussah, bei diesen Worten ihren armseligen, alten Puppenbalg ganz fest an sich drückte.
Anderentags wurden sowohl Lilly als auch Minna zur Gutsverwaltung beschieden.
Der Verwalter, ein etwas grämlich und vertrocknet aussehender ältlicher Herr, den man mit›Herr Direktor anzureden hatte, zählte ihnen in langsamer und genauer Prozedur den ihnen zustehenden Lohn aus.
»Zuzüglich eines Abschiedsgeldes«, sagte er abschließend und sah sie aus seinen wässrigen Augen triumphierend an. «Minna erhält 20 Taler, und du, Lilly, bekommst sogar 30 Taler.«
Minna und Lilly starrten den alten Mann an.
»Was soll das denn?« fragte Lilly keß.
»Das soll heißen«, antwortete der Gutsdirektor, »daß ihr entlassen seid, aber noch eine prächtige Abschlußzahlung erhaltet.«
»Entlassen kann man uns erst zu Lichtmeß«, murmelte Minna und strich das Geld ein.
»Was wollt ihr machen?« sagte der Gutsdirektor und zuckte die Achseln. »Ich kann nicht einmal die Reparaturen bezahlen. Wie soll es da eine Dienerschaft geben?«
»Was ist mit den Jaskulkes?« fragte Minna schnell.
»Liebe Frau«, antwortete der Gutsdirektor, »das sind Tagelöhner.« Er betonte das Wort ›Tagelöhner‹. »Die braucht man immer, ebenso die Mägde. Was sollen wir aber mit einer Zofe und einer Schneiderin, wenn wir keine Gutsherrin haben?«
»Wir haben eine Herrin!« entgegnete Lilly trotzig, »oder zählt das Fräulein Antonia nicht?«
»Nein«, sagte der Gutsdirektor und ordnete seine Bücher in eine breite Schreibtischschublade ein, »Fräulein Antonia zählt nicht. Sie kann gerade so viel bekommen, daß sie leben kann. Auf euch muß sie verzichten. Und nun Adieu!«
Damit war die Unterredung beendet. Minna und Lilly verließen das Büro.
Draußen sagte Minna: »Wir sollten zu deinen Eltern gehen.«
»Das sollten wir nicht!« widersprach Lilly beharrlich. »Wir gehen nach Wien. Da wird man uns am ehesten brauchen.«
Sie fuhren nach Wien. Doch niemand brauchte sie.
Sie waren in einer kleinen Dachwohnung untergekommen, aus der Lilly mit unglaublichem Geschick eine gemütliche Bleibe zauberte. Doch die Gemütlichkeit hörte spätestens im Winter auf, als es kalt wurde und das ihnen verbliebene Geld zur Neige ging.
»Was soll aus uns werden?« jammerte Minna.
»Aus uns wird schon etwas werden«, antwortete Lilly. Sie sah an Minna vorbei, und ihre Worte klangen nicht mehr ganz so trotzig und zuversichtlich wie sonst.
Noch am gleichen Tage ließen sie Antonia wissen, wo sie wohnten, und daß sie »alleruntertänigst zur Verfügung stünden«.
Gräfin Stemblonska, nicht müde, Gesellschaften von mittlerer Langeweile zu geben, machte Antonia eines Tages auf die Rückkehr eines alten und einflußreichen Verehrers aufmerksam: Baron Koloman von Halmay.
Hatte Antonia einen typischen Vertreter des ungarischen Adels erwartet, sah sie sich angenehm enttäuscht. Der Baron machte eher den Eindruck eines französischen Edelmannes, dezent und von großer Bildung. Im Gegensatz zu vielen Ungarn war er ein guter Zuhörer und selbstloser Freund.
»Wahrscheinlich macht sich die Gräfin Hoffnungen auf ihn‹, dachte Antonia und beobachtete den Baron.
Sie mußte feststellen, daß er sie mit der gleichen ruhigen Anteilnahme ansah wie sie ihn.
Antonia mußte lachen.
Irgend etwas war an ihm, das ihr das Gefühl gab, er kenne, verstünde sie. Er lächelte zurück, kam langsam auf sie zu und küßte ihr die Hand.
»Sie sollten diesen Brillanten in eine Brosche umarbeiten lassen«, sagte er leise und küßte ihre Finger. »Man sieht zu sehr, daß es ein Herrenring ist.«
»Dazu fehlen mir die passenden Steine«, gab Antonia geistesgegenwärtig zurück.
»Dann wollen wir sie schnell besorgen.« Er hatte eine angenehme, weiche Stimme. »Wann darf ich Ihnen meine Equipage schicken und wohin?«
»Ich wohne im Hause«, entgegnete Antonia und entzog sich ihm. »Man wird um Erlaubnis fragen müssen.«
Der Baron verneigte sich und ging zur Gräfin, während Antonia schnell und hastig den Salon verließ.
Vierzehn Tage später mietete Antonia ein kleines, teures Haus in der besten Gegend Wiens, verließ die Gräfin in gutem Einvernehmen und achtete strengstens darauf, daß sie nicht, von allzuvielen Verehrern umgeben, jenen schlechten Ruf bekam, der ihr erst als verheirateter Frau nützlich sein konnte.
Antonia hatte Lillys Billet empfangen und sofort in ihrem Sekretär verschlossen. Kaum hatte sie das schöne, teure Haus gemietet, sandte sie den Kutscher des Barons zu Lilly und Minna, um sie wissen zu lassen, daß sie schnellstens umzusiedeln hätten.
Mit welcher Freude und Begeisterung bewerkstelligten die beiden den kleinen Umzug! Als sie in ihre Dienstbotenkammer bei Antonia einzogen, erschien es ihnen, als hätten sie das Paradies auf Erden. Dabei waren die Kammern nicht annähernd so hübsch und gemütlich wie jene Dachgeschoßwohnung, die sie verließen.
Aber: Sie waren wieder in Lohn und Brot. Und sie waren bei ihrer so bewunderten und geliebten Herrin. Von nun an pflegten und hegten sie Antonia, eiferten um ihre Gunst.
»Wir brauchen einen Silberdiener«, sagte Antonia zu Lilly, »jemand, den wir anlernen können. Am besten einen jungen, hübschen für dich.« Sie lächelte Lilly zu.
»Nein«, antwortete Lilly und machte ein sehr braves, ergebenes Gesicht. »Mit Eurer Erlaubnis werde ich meinen Bruder Hans holen.«
»Wie du willst«, entgegnete Antonia schroff. »Wenn er sich als Bauerntrampel erweist, fliegt er raus!«
Vierzehn Tage später erschien Hans Jaskulke in Wien. Viel mehr als ein Bauerntrampel schien er jedoch nicht zu sein.
Grinsend beherzigte er Lillys Belehrungen, zog vorschriftsmäßig weiße Zwirnhandschuhe zum Silberputzen an, wienerte an den Kostbarkeiten herum, daß sie glänzten und strahlten, als seien sie mit Diamantenpolitur überzogen.
Sein breites Grinsen verging ihm schnell. Die Herrschaft bekam er nur selten zu Gesicht und wenn, dann nahm es ihm schier den Atem.
»Dieser Duft...« konnte er einmal nur noch murmeln, als er in die Küche kam und sich auf einen Stuhl fallen ließ. »Sie duftet so herrlich!«
Gemeint war Antonia, die übrigens die Neigung hatte, sich zu stark zu parfümieren.
Hans wurde eingekleidet: schwarze Hose, grünes Satinjackett für die Arbeit, ein Dutzend weiße Zwirnhandschuhe, ein halbes Dutzend grüne Hausmannsschürzen, zwei schwarzweiß gestreifte Westen und zwei schwarze Jacketts.
Staunend betrachtete er diesen für ihn unglaublichen Reichtum.
Hemden nähte Minna für ihn. Die Garderobe war keineswegs so komplett und üppig, wie es ihm vorkam. Schuhe und Strümpfe fehlten, ebenso ein Mantel oder wenigstens eine warme Jacke mit Taschen, in denen man die Hände verstecken konnte. Sein Lohn war nicht schlecht, doch brauchte Minna jeden Taler für seine Ausstattung, ja, sie und Lilly legten sogar noch etwas drauf.
Antonia stieß sich nicht daran. Ihr war es recht. Sollten die Dienstboten ruhig etwas dazutun, daß sie in einem feinen Hause leben durften.
Sie, die herrliche, schöne Antonia, brauchte dafür um so mehr Geld.
Und der Baron gab es ihr. Er betete sie an.
Es war eine Form von Anbetung und Verehrung, die Antonia ausgesprochen gefiel. Nichts Larmoyantes, Schwaches lag in der Art des reifen, älteren Mannes, keinerlei kindische Hingebung kennzeichnete seine Beziehung zu ihr.
Es gab Augenblicke, da fühlte sich Antonia an Marieluis erinnert, soviel Verständnis fand sie bei ihm.
Ihn entzückten ihre Bosheiten, mit denen sie, oft zum Entsetzen mancher Damen, gern um sich warf; er kannte die Wurzel ihres Wesens.
Und: Er verwöhnte sie.
Sein Reichtum, das Savoir vivre, seine Umgangsformen waren für Antonia ein Quell der Freude. Im Vergnügen schier endloser Wünsche und ihrer Erfüllung fand sie in Koloman einen ebenbürtigen Partner.
Was für Koloman von Halmay als Amour begann, als Liaison gemeint war, wurde für ihn zur tiefen, lebensbestimmenden Liebe.
Als er Antonia eines Tages zur Soiree des Grafen Bajar mitnahm, ahnte Koloman von Halmay nicht, daß dieser Schritt Antonias in ein altehrwürdiges, prächtig ausgestattetes Adelspalais von so großer Bedeutung für alle Beteiligten sein würde, daß selbst ein so toleranter und freisinniger Mann wie er später viel darum gegeben hätte, diesen Schritt ungeschehen machen zu können.
Allein, das Schicksal, und vornehmlich solches, das ehrgeizige Frauen in ihre Hände nehmen zu müssen glauben, solches Schicksal ist nicht rückgängig zu machen.
Die Gräfin Bajar, eine reizlose, etwas langweilige Dame gesetzteren Alters, der die Natur Kinder versagt hatte, war entzückt von Antonia. Ihr Entzücken sollte sich jedoch bald in Verbitterung umwandeln, als sie bemerken mußte, mit welch leidenschaftlicher Verehrung ihr Gatte Antonia entgegenkam.
Der Graf, fast hager zu nennen, mit typisch österreichischem Witz begabt, schien um Jahre jünger als seine kurzsichtige, dickliche Gemahlin.
Vier Wochen nach ihrer ersten Begegnung mit dem Grafen hatte Antonia bereits die innigsten Beziehungen zu ihm und ließ jedermann wissen, daß sie ihn – und nur ihn! – liebe. Der Graf fühlte sich geschmeichelt, rügte sie ihrer allzu beredten Phantasie wegen durchaus nicht, sondern gestand ihr seinerseits seine Liebe.
»Ich sollte Sie begreifen«, murmelte Koloman von Halmay, als er Antonia in ihrem hübschen gelben Salon gegenübersaß, »und ich sollte wissen, wie nötig Ihnen dieses Begreifen ist. – Immer sein wird«, ergänzte er. Er blickte sie traurig an. »Sie wissen, Antonia, daß Liebe so gleichbleibend wie die Sonne ist – ihren Strahlen ist es gleichgültig, wen und warum sie treffen.«
»Sollte die Liebe so wahllos sein?« fragte Antonia.
»Sie ist es«, nickte Koloman. »Vielleicht sollte man nicht von der Sonne sprechen, sondern nur von einem Strahl. Wissen Sie, was Goethe in den ›Vier Jahreszeiten‹ schreibt?«
»Nein«, meinte Antonia, obwohl sie wußte, was er sagen würde. »Denn das ist die wahre Liebe«, zitierte der Baron leise, »die immer und immer sich gleich bleibet – ob man ihr alles versagt, ob man ihr alles gewährt.«
Antonia sah ihn an. »Vielleicht so eine Art Mutterliebe?«
»Oh nein!« Koloman von Halmay schüttelte den Kopf.
»Keinerlei Art von Liebe; nur: die Liebe. Ob von Vater, Mutter, Schwester oder Wahlverwandten gegeben ... genommen.«
Antonia streichelte seine Hände.
»Sind Sie mir sehr böse?«
»Natürlich nicht«, antwortete der Baron, »obwohl ich bis zum Überdruß deutlich ahne, warum Sie den Grafen erhören.«
»Gehört es nicht zur Liebe, daß man das Wesen, das man liebt, um seiner selbst willen liebt?«
Der Baron stand auf.
»Vielleicht wäre es ein bißchen angenehmer, den Charakter des geliebten Menschen zum Positiven formen zu dürfen.«
»Ein Vorrecht des Alters«, entgegnete Antonia spitz, »von dem ich keinerlei Gebrauch machen möchte.«
»Ich weiß«, lächelte Koloman von Halmay. »Erlauben Sie mir dennoch, Ihnen zu sagen, daß sich Ehrgeiz, Verlogenheit und Charme in Ihnen zu teuflischer Vollendung getroffen haben.«
»Kann sein.«
Antonias Miene zeigte deutliche Abweisung.
»Wenn ich Kritik wünsche, werde ich mich melden.«
»Somit wäre ich verabschiedet?« fragte der Baron.
»Somit wären Sie verabschiedet«, antwortete Antonia und lächelte ihr zauberhaftes Lächeln, »aber Sie dürfen immer wiederkommen, Sie dürfen bei mir bleiben, aber: Sie dürfen mich niemals stören!«
Koloman küßte ihre Hand, sie antwortete mit einem zärtlichen Kuß auf seine Wange.
Dann war er entlassen.
Koloman von Halmay war unglücklich, ja verzweifelt. Wäre ihm ein junger, hübscher Mann in die Quere gekommen, er hätte es verstehen können.
Doch dieser hagere, ebenfalls schon leicht angegraute Graf? Nicht nur sein Gefühle, auch sein Stolz war verletzt.
Und doch würde Halmay nicht von Antonias Seite weichen. Er liebte sie und war in hoffnungslose Schwärmerei verfallen.
›Auch das ist ein Vorrecht des Alters,‹ sagte er sich und lächelte seinem eleganten Spiegelbild mokant zu, als er das Haus Antonias verließ.
»Ganz Wien spricht von dieser Affäre«, sagte Belinda Petrouschek ärgerlich zu ihrem Gatten, »sie benimmt sich, als gehöre ihr der Graf!«
»Denkt denn niemand dabei an die Gräfin?«
Petrouschek goß sich Wein ein und zerbrach eine Brezel. »Wahrscheinlich nicht.«
»Außerdem ist die Gräfin ja weiß Gott nicht hübsch!«
Das hätte er nicht sagen sollen.
»Petrouschek!« empörte sich Belinda. »Kein Mensch wird im Alter schöner, auch so ein Kerl von Mann nicht – obwohl ja alle Welt zu glauben scheint, ein Bauch, eine Glatze oder ein Hals wie ein alter Truthahn wäre ein hübscher Anblick für ein junges Ding!«
»Ja, ja!«
Petrouschek sah seine Eheliebste beschwichtigend an.
»So war’s ja nicht gemeint.«
»So ist es aber gemeint!« fauchte sie auf niedliche Art weiter. »Soll man eine Frau schlachten, wenn sie dreißig wird, oder darf sie bis zum Vierzigsten leben bleiben, damit die Herren der Schöpfung nur ja immer das frischeste Obst aus Gottes Gemüsegärtlein bekommen?«
Petrouschek trank seinen Wein in schnellen Schlückchen.
»Nun ja ... äh...« sagte er und wußte selbst nicht, wie es weitergehen sollte, spräche er weiter. So entschloß er sich kurzerhand, seiner lieben Frau Recht zu geben – ein Recht, nach dem sie allerdings nicht verlangt hatte.
»Sehr richtig!« sagte er mit Nachdruck. »An diese arme, dicke, alte Gräfin denkt kein Mensch, jeder gönnt dem Grafen die schöne Antonia.«
»Petrouschek, du bist durchschaubar!« rief Belinda. »Aber«, fügte sie freundlich hinzu, »weil du mein lieber Petrouschek bist, will ich nicht widersprechen. Warum ist die Gräfin auch so dick und alt, hat keine Kinder und jammert den ganzen Tag über verlorene oder verlegte Spitzentücher?«
»So? Tut sie das?« fragte Petrouschek scheinheilig. »Woher weißt du denn das, Madame Petrouschek? Hörst du dir etwa gräflichen Klatsch an?«
»Ooch, man hört doch allerlei«, antwortete Belinda Petrouschek und legte ihrem Gatten eine Scheibe besten Tafelspitz vor. »Auch daß der Koloman von Halmay bei jeder Narretei Antonias dabei ist – das erfährt jedes Kind!«
»Wohl kaum die Kinder«, schmunzelte Petrouschek, »sondern nur liebe, pummelige Frauen, die nicht möchten, daß ihnen das Neueste entgeht.«
»Hältst du mich für neugierig?« fragte Belinda spitz.
»Ja«, nickte Petrouschek mit Würde und Nachdruck. »Jawohl. Sehr.«
Darauf entstand ein Schweigen, das Petrouschek nur allzugut kannte und von dem er wußte, daß es alsbald wieder gut gemacht werden mußte.
»Ich hör’ mir so etwas auch immermal ganz gern an«, räumte er ein. »Mich erinnert so eine feine Liebesgeschichte ein bißchen an die heiteren Schäferspiele vergangener Zeiten.«
»Ich hoffe nur, daß du mich bei dieser Vorliebe für Schäferspiele nicht zum Schaf degradieren möchtest!« entgegnete Belinda, immer noch ein wenig gereizt. »Es geht bei dieser Geschichte weniger um Pikantes als um eine Verwandte, die sich unmöglich aufführt, und...«
»...und um eine arme, dicke, alte Gräfin«, ergänzte Petrouschek und lächelte seine Gemahlin an.
»Hoffentlich bleibt die G’schicht’ amüsant«, sagte Belinda und schenkte ihm neuen Wein ein.
Die Geschichte blieb alles andere als amüsant.
Die amouröse Heiteretei der beiden verliebten Adligen mit Antonia glich zwar äußerlich einem eleganten Schäferspiel, doch wurden die Einsätze nur allzu schnell erhöht.
Stand für Koloman von Halmay noch seine tiefe und hoffnungslose Liebe zu Antonia zu Buch, so wurde es für den Grafen Bajar bald ernsthafter.
Es war am 14. Februar 1882, als Antonia von Blumenthal dem Grafen Bajar eröffnete, daß sie ein Kind von ihm erwarte.
Sie machte diese Eröffnung nicht nur ihm, sondern – in scheinbarer Vertraulichkeit – auch anderen Personen, von denen sie genau wußte, daß sie für die Verbreitung der Nachricht sorgen würden.
Erregung, Seligkeit und Freude des Grafen ob dieser Nachricht waren so groß, daß er Antonia versprach, das Kind, das sie erwartete, anzuerkennen und ihm seinen Namen zu geben.
Doch Antonia blieb kühl und reagierte kaum auf diese, für den Grafen Bajar zweifellos schwierige Entscheidung.
»Das, mein Lieber«, sagte sie leise und bestimmt, »genügt nicht.
Ich will deinen Namen, und nicht nur für das Kind!«
Der Graf fühlte sich unglücklich und verlangte von ihr Bedenkzeit.
»Gut«, antwortete Antonia im gleichen leisen und entschlossenen Tonfall, »du kannst über meine Wünsche nachdenken. Ich werde dasselbe tun.«
Ihre Geste und Haltung drückten unmißverständlich aus, daß sie allein zu sein wünschte.
Der Graf verstand und erhob sich.
»Ich werde zu Koloman gehen«, sagte er und sah Antonia liebevoll an. »Mit ihm zu sprechen, wird mir wohltun.«
Er küßte sie und ging.
Kaum hatte er das Haus verlassen, ließ Antonia ihre Kutsche anspannen und fuhr im eiligen Trab zum Palais Bajar. Sie ließ sich der Gräfin melden und bat unverzüglich um eine Unterredung.
Die Gräfin, hilflos jeder schnellen Forderung gegenüber, ließ sich nicht lange bitten und erschien im Salon.
Antonia grüßte ehrerbietig und liebenswürdig wie stets.
Die Gräfin, deren Vorname Rosali in Antonias Ohren wie der Name einer Bauernmagd klang, reichte ihr die Hand und versuchte, sich in ein harmloses Gespräch über das Wetter, rheumatische Beschwerden und den Verlust eines Spitzentüchleins zu flüchten. »Sie wissen sehr wohl, Madame«, sagte Antonia plötzlich mit erhobener Stimme, »daß ich Ihnen zu dieser Stunde keine gesellschaftliche Aufwartung mache!«
»Ach ja?« bemerkte Rosali und blinzelte ein wenig.
»Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen, Gräfin!« Antonia machte eine wohldosierte Pause.
Wieder kam dieses halblaut fragende »Ach ja?«, wieder ein verlegenes Blinzeln.
Antonia schwieg. Sie erwartete, daß die Gräfin, aggressiv und von genügend Wissen um die Liebesaffäre ihres Gatten erfüllt, sie attackieren würde.
Doch nichts dergleichen geschah.
Gräfin Rosali wartete höflich, ohne jede Überheblichkeit, aber auch ohne jedes Interesse für Antonia.
Antonia konnte nicht einmal feststellen, worauf diese Frau wartete. Vielleicht nur darauf, den Raum wieder verlassen und allein sein zu können.
»Ich habe soeben mit Ihrem Gatten gesprochen.«
Antonias Stimme klang heller, um ein weniges lauter als sonst.
Zum dritten Mal folgte dieses unverfängliche, uninteressierte: »Ach ja?«
Antonia erhob sich. Sah die Gräfin starr an.
»Möchten Sie denn nicht wissen, was ich Ihnen zu sagen habe?«
Die Gräfin blinzelte, schüttelte den Kopf, zupfte an ihrem Spitzentuch und sagte:
»Nein.«
»Wie Sie wünschen. Ich teile Ihnen dennoch mit, daß ich ein Kind des Grafen Bajar unter dem Herzen trage. Der Graf hat sich bereit erklärt, diesem Kind seinen Namen zu geben.«
»Hat er das?« fragte Rosali müde.
»Ich habe verlangt«, fuhr Antonia mit heller Fanfarenstimme fort, »daß der Graf seine Ehe wegen Kinderlosigkeit annullieren läßt und mich heiratet.«
Immer noch stehend, wartete Antonia die Wirkung ihrer Worte ab.
Nun erhob sich auch die Gräfin. Ruhig, ohne zu blinzeln, sah sie Antonia an.
»Ich wünsche Ihnen zu Ihrem Vorhaben alles Gute, Comtesse!«
Die Hand mit dem Spitzentuch streckte sich ihr entgegen.
Antonia versank in einem tiefen Knicks, wollte die Hand küssen. Um den Hauch einer Sekunde aber entzog sich ihr diese weiße Hand, deren Haut welk, deren Fingernägel brüchig waren.
»Verzeihen Sie mir, Gräfin«, versuchte Antonia zu sagen.
Es gelang ihr kaum. Sie flüsterte fast.
Die Gräfin ging zur Tür.
»Pas de quoi«, sagte sie im Hinausgehen. »Es macht nichts.«
Dann schloß sich die hohe, weißgoldene Tür hinter einer Frau, die sechzehn Jahre lang Gräfin Bajar gewesen war.
Eine Viertelstunde nach der Abfahrt Antonias kleidete sich die Gräfin um.
Es war Winter, und sie rüstete sich zu einer Ausfahrt. Sie wählte sorgsam ein von ihr sehr gerne getragenes lila Kleid mit dem dazugehörigen zobelgefütterten Mantel. Toque, Muff und Cape des Mantels waren ebenfalls aus Zobel.
Mit langsamer Gebärde, fast feierlich, legte Rosali Gräfin Bajar einen kostbaren Schmuck an.
Dann betrachtete sie sich einen Augenblick im Spiegel. Ihre weiße, pergamentartige Haut wirkte müde, die schmalen, grauen Augen abgeklärt.
Was Antonia soeben in dem Gespräch empfunden hatte, schien von dem ganzen Menschen Besitz ergriffen zu haben: ein tiefes, abgrundtiefes Desinteresse, eine Apathie.
›Es stimmt‹, dachte Rosali, ›nichts bewegt mich mehr, läßt mein Herz schneller schlagen, meine Haut erröten. Es ist mir gleichgültig. Alles gleichgültig! Den Mann, den ich liebte, das Haus, in das ich als Fremde einzog und das mir doch mehr bedeutete als Schlösser und Palais, die ich einst besaß.
Ich gehöre diesem Haus nicht mehr, gehöre diesem Mann nicht mehr ...‹
Sie klingelte.
Ließ anspannen.
Als sie das Palais Bajar verließ, wandte sie keinen Blick zurück.
Es war Abend, und die Kälte schnitt ins Gesicht. Die Augen tränten vom scharfen Wind.
Rosali ließ den Kutscher bis zu einer Schenke am Wiener Wald fahren, hieß ihn halten und umkehren.
Der Kutscher, dumpfen Gehorsam der Herrschaft gegenüber gewohnt, tat, wie ihm befohlen.
Rosali kehrte in die Schenke ein.
Nie zuvor war sie in einer solchen Gaststätte gewesen. Niemand kannte sie, sie kannte niemanden – zu groß war der Unterschied zwischen der reichgekleideten Gräfin und dem einfachen Volk, das sich hier bei Schnaps und Wein erwärmte.
Eine vornehme Dame ohne Begleitung erregte zwar Aufsehen, doch hatte man sich Launen und Allüren der hohen Herrschaften ohne Frage und Nachdenken zu fügen.
Rosali bestellte etwas zu trinken. Der Wirt brachte ihr roten Landwein.
Ruhig, gelassen, freundlich um sich blickend, trank sie mehr als einen halben Liter.
Dann entlohnte sie Kellner und Wirt zu deren Entzücken reichlich, erhob sich und verließ gelassenen Schrittes die Schenke.
Es war das letzte Mal, daß man Rosali Bajar lebend gesehen hatte.
Die Dienerschaft des Palais’ Bajar wußte hernach zu berichten, daß der Graf um Mitternacht in Begleitung des Barons von Halmay eingetroffen sei. Beide Herren hätten erregte Gespräche geführt und Mutmaßungen über das Ausbleiben der Gräfin angestellt.
Zu ungewöhnlich früher Stunde erschien am Morgen des anderen Tages die Comtesse von Blumenthal und beteiligte sich an der bald darauf einsetzenden Suche nach der Gräfin.
Eine Suche, die nicht lange erfolglos bleiben sollte.
Der Weg der Gräfin von der Schenke in die Tiefe des Wiener Waldes war bald gefunden.
Ihr erfrorener Leichnam lag in einer Schneewehe.
Als habe der von ihr so sehr geliebte Wald ihr die Bahre bereitet, habe ihr Frieden und Ruhe gegeben, so lag sie, in ihren Zobel gehüllt, da. Der Tod war zum endlichen Maßstab ihrer Leiden geworden.
Gegen Nachmittag machte die Schreckensnachricht in Wien die Runde. Doch nicht allein sie erregte die Gemüter anteilnehmender Menschen, mehr noch das begleitende Gerücht über einen Selbstmord und seine Gründe.
Antonias Name, bisher fast unbekannt, erfuhr zum ersten Male schaudernde Erwähnung.
Das Leichenbegräbnis ließ an Pomp nichts zu wünschen übrig und sollte geeignet sein, Klatschmäulern, die dem Grafen Schuld am Tode seiner Frau zu geben versuchten, eben jenes vorlaute Maul zu stopfen.
Selten sah man einen so gebrochenen, verzweifelten Ehemann.
Seine Majestät der Kaiser selbst bekundete dem Grafen sein Mitgefühl durch sein Erscheinen bei der Trauerfeier.
Es war das erste Mal, daß Antonia sich, in tiefem Hofknicks versinkend, der Aufmerksamkeit seiner Majestät gewiß sein konnte.
Schwarze Spitzen, das Fehlen jeglichen schmückenden Beiwerks ließen ihre große Gestalt fast majestätisch erscheinen.
Graf Bajar, in österreichischer Husarenuniform, kniete auf dem Betpult. Mit trostloser Miene blickte er während der Messe auf den Sarg.
Erkenntnis seiner Unliebe, Wissen um die Schuld und die Unfähigkeit, diese Schuld mit seinen Gefühlen Antonia gegenüber in Einklang zu bringen, machten ihn ratlos und verzweifelt. Tiefes Mitleid mit der Verlorenheit der Toten, ihrer Einsamkeit inmitten glänzendster Gesellschaft bewegte ihn.
Sein Blick traf Antonia.
Sie sah hinreißend aus. Die zart zur Schau gestellte Trauer kleidete sie ebenso wie das schuldbewußte Lächeln, mit dem sie seinen Blick erwiderte.
Als der Sarg eingesegnet wurde, brach sie, nun nur noch Freundin der Verblichenen, weinend zusammen.
Nur der stets gegenwärtige Koloman von Halmay bewahrte Haltung. Sein gelassener Gesichtsausdruck gab nicht einen der bitteren Gedanken zu erkennen, die ihn erfüllten.
Allein, der so unermeßlich scheinende Schmerz des Grafen Bajar schien bereits acht Wochen nach dem Hinscheiden seiner Gemahlin getröstet. Anläßlich einer Audienz bat er um allerhöchste Erlaubnis, Antonia von Blumenthal ehelichen zu dürfen. Majestät empfing den Verlobten und erteilte die Heiratserlaubnis entgegen den Bestimmungen der Bajarschen Hausgesetze, die eigentlich eine Eheschließung nur im gleichen Adelsrang gestatteten.
Antonia war am Ziel ihrer Wünsche.
Der Pomp der Hochzeit war dem Pomp des Leichenbegängnisses durchaus ebenbürtig, Antonia eine Braut von so unbeschreiblich märchenhafter Schönheit, daß sich kaum einer der Gäste ihrem Zauber entziehen konnte.
Koloman von Halmay indes suchte und fand eine Gelegenheit, die Gräfin allein zu sprechen.
»Sie sind, meine Liebe«, sagte er lächelnd, »beachtlich schlank. Dem Verehrer Ihrer Schönheit sei diese Bemerkung erlaubt.«
Antonia sah ihn an. Nun lächelte auch sie. »Ich bin sicher, daß meine schlanke Taille Sie auch weiterhin erfreuen wird, Baron... sofern ich Ihre Anwesenheit gestatte.«
Sprach’s und ging, sanft mit dem Fächer auf seinen Arm tippend, an ihm vorüber.
Antonia Gräfin Bajar hatte die Wahrheit gesagt. Ihre Taille war schlank und würde es auch bleiben. Sie bekam kein Kind. Mit einer Lüge hatte sie die Gräfin in tiefste menschliche Verzweiflung gestürzt, mit einer Lüge sich selbst zur neuen Gräfin erhoben, mit beständigen weiteren Lügen würde sie ihre Stellung beim Grafen festigen.
So sehr man von seiten des Hauses Bajar auch bestrebt war, nichts von den Ereignissen bekannt werden zu lassen, so sehr bemühten sich Neugierige, Klatschsüchtige, Übelwollende und Redliche um Erkenntnis und Gewißheit. Was übrigblieb, waren Vermutungen und Gerüchte, an denen jedoch niemand zweifelte.
Es nützte nichts, daß Kaiser Franz-Joseph den Graf und die Gräfin bevorzugt an der Tafel plazierte, sie zum Tee empfing und sich gelegentlich von der Gräfin bei Ausfahrten begleiten ließ – hinter vorgehaltener Hand war der Skandal perfekt.
Als Belinda Petrouschek davon hörte, ließ sie anspannen und fuhr zur Gräfin, die sie widerstrebend empfing.
»Ich möchte gerne wissen«, frage Belinda nach einigen einleitend ausgetauschten Höflichkeiten, »was an den Gerüchten wahr ist.«
»Alles«, antwortete Antonia lächelnd, »alles ist wahr, liebe Belinda. Du solltest jedoch weder meinen Gemahl noch mich eines schuldhaften Verhaltens anklagen. Hier hat bei allen nur das Herz gesprochen.«
»Danke für diese Art von sprechenden Herzen!«
Belindas Lippen zitterten vor Empörung.
»Es hat sich gefügt, daß ich die Gräfin Bajar bin. Du kannst darüber denken, wie du magst. Aber nimm bitte zur Kenntnis, daß ich niemanden, auch nicht einer entfernt Verwandten, wie Du es bist, Rechenschaft abzulegen gewillt bin!«
Die Hofrätin Petrouschek holte tief Atem.
»Die Ereignisse zwingen mich«, sagte sie sodann mit leicht erhobener Stimme, »Sie auf das dringendste zu bitten, die uns miteinander verbindende Verwandtschaft geheimzuhalten...«