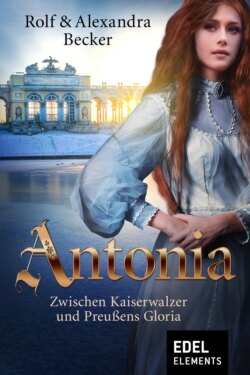Читать книгу Antonia - Rolf Becker - Страница 12
Wien, Soiree im Hause des Grafen Bajar
ОглавлениеEin schmales, elegantes Haus mit reicher Barockfassade, mehr ein Palais als ein Haus. Hier war alles von jener geschmackvollen, heiteren Üppigkeit, die den Gedanken an Prunk und Reichtum gar nicht erst aufkommen ließ. Kaum einer konnte das Palais betreten, ohne nicht zugleich der Hausherrin das Kompliment zu machen, daß der heitere, sprühende Geist, der dieses Haus umfing, den unauffällig glanzvollen Rahmen bildete, der die Gräfin nicht nur schmückte, sondern ihr gebührte.
An diesem Abend bot der Graf Bajar seinen Gästen von der deutschen Botschaft zeitgenössische Musik, ein damals modisches Unternehmen, das bei manchem jungen Manne und mancher Demoiselle ein tiefes inneres Gähnen bewirkte.
Der Graf, ein etwas hagerer Mann von großer Noblesse und trockenem Wiener Humor, stand selbst einigermaßend fremd inmitten einer Gesellschaft, die einander fast bis zum Überdruß kannte.
Die Gräfin hatte sich zunächst entschuldigen lassen; sie habe noch allerhöchsten Verpflichtungen am Hofe nachzukommen und würde, sobald Majestät sie entließe, ihre Gäste begrüßen.
Alexander von Kronburg, der zu den Eingeladenen gehörte, langweilte sich herzlich. Zwar war er musischen Dingen durchaus aufgeschlossen, hatte eine ausgeprägte Liebe zur Klaviermusik, doch waren die hier gebotenen Darbietungen keineswegs so gelungen, daß sie ihm genügten.
Die Musikanten hatten auch nicht jenen naiv-rührenden Charme, den bettelnde Geiger, heitere Dilettanten oder heruntergekommene Genies haben können. Vielmehr wurde hier mit Ambition und ohne Verve musiziert, was Alexander ausgesprochen öde fand. Hinzu kam, daß seine allgemeine Stimmung nicht dazu angetan war, kleine Mängel zu übersehen.
Wien gefiel ihm nicht. Von der Küche bis zu den berühmten Wiener Madeln war ihm alles zu süßlich, zu oberflächlich. Sein Sinn für die Heiterkeit jugendlichen Übermutes war so völlig vom Emst seiner preußischen Erziehung unterdrückt, daß er für seine Empfindungen hielt, was bereits Vorurteile waren.
Ohne von sentimentalem Heimweh gepackt zu sein, hatte er doch Sehnsucht nach Soldin. Er liebte das Klavierspiel seiner Mutter, die ruhige, klare Atmosphäre, die sie um sich zu verbreiten verstand, ihre stets etwas erstaunt blickenden grauen Augen, in denen immer etwas Mädchenhaftes lag.
Zudem hätte es ihm viel mehr gefallen, seinen Vater bei der Realisierung seiner politischen Ideen zu erleben, am Handeln und Denken des neuernannten Reichstagsabgeordneten teilzunehmen.
Während sich seine Gedanken so mit einer gewissen kühlen Wehmut nach Berlin und Soldin wandten, betrat Antonia Gräfin Bajar den Salon.
Es war ein Augenblick, der sein Leben veränderte.
Was er zuerst wahrnahm, war ihre Stimme. Sodann wandte er sich ihr zu, sofort eingenommen von ihrem spöttischen Charme, der keineswegs unweiblich war. Ihre Schönheit, ihre hinreißende Weiblichkeit verzauberten ihn vom ersten Augenblick an.
Noch ehe er den ersten freundlichen Blick von ihr auffing, wußte er, daß mit seinem Leben etwas geschehen war, daß er angerührt worden war von einer Macht, die ihm bis zu dieser Stunde völlig fremd gewesen war: der Liebe.
Zugleich aber mußte er über sich selbst lachen, schalt sich einen Narren, dem Heimweh und Fremdheit gleichermaßen einen Gefühlsschabernack spielten. Seine ihm allzu dramatisch erscheinenden Gedanken wie lästige Eindringlinge verbannend, ging er geradewegs auf die Gräfin zu, verneigte sich und ließ sich vorstellen.
In der Nähe schien sie ihm noch schöner, noch atemberaubender als bei ihrem Auftritt. Sie sah ihn freundlich an, unterhielt sich ein wenig mit ihm und überließ ihn dann seinen Bekannten von der deutschen Botschaft.
Es war ihm unmöglich, ein zusammenhängendes Gespräch zu führen; immer wieder sah er sich gezwungen, dorthin zu schauen, wo ihr helles, kupfernes Haar mit dem dunklen Rosenschmuck leuchtete. Er fühlte sich elend und lächerlich.
Was sollte er tun?
Den ganzen Abend hinter ihr herlaufen, ihr sagen, wie schön sie sei, daß ihre Augen so hell und strahlend waren wie die seiner Mutter?
Ihr sagen, als sie bald darauf die Marie d’Agoult gewidmeten Etüden Nr. 25 von Chopin mit jener Wärme und Romantik im Anschlag spielte, deren sie bedürfen, daß sie in diesem Augenblick für ihn das nächste, lebendigste, verständnisvollste Wesen zu sein schien, dem er je begegnet war?
Er versuchte, sie anzusehen und dem ihn treffenden Blick ihrer Augen standzuhalten.
Die Grenze des Albernen schien ihm erreicht, als er den tiefen Wunsch verspürte, die Hände vors Gesicht zu schlagen und davonzustürzen. Sich so als Werther in preußischer Uniform zu sehen, kam ihm ebenso haltlos wie undiszipliniert vor, und so verschränkte er denn die Arme über der Brust, wie er es gelernt hatte, und sah sie ruhig und gelassen an.
Diese gespielte und dennoch so ernste Gelassenheit aber war es, die ihm einen langen, erstaunten Blick Antonias eintrug.
Sie musizierte sehr sicher und souverän, hielt zwischen den einzelnen Etüden die Spannung, so daß niemand seine Anerkennung durch Beifall zu äußern wagte.
Und wieder sah sie ihn an.
Ihm war, als striche sie ihm über die Stirne, kühle seine aufgebrachten Gedanken mit ihrem Lächeln.
Dieses Lächeln aber entschied über seine Empfindungen zu ihr. Er fühlte sich in all seinen Lebensregungen, seinem Denken und seinen Phantasien verstanden, obwohl ihm niemals zuvor der Gedanke gekommen war, daß es überhaupt so etwas in seinem Leben geben könne, das unverstanden, unerlöst und wie ein Seelenschatz zu entdecken sei. Bei diesem Gedanken mußte er über sich selbst lachen; sein Lachen teilte sich Antonia mit, die es erwiderte.
Allerdings: Dieser große, schlanke, von Haltung und jugendlicher Ernsthaftigkeit geprägte preußische Adlige war eine durchaus elegante, ja, schön zu nennende Erscheinung. Er hatte nicht die heitere Verwegenheit seiner unglaublich charmanten österreichischen Kameraden, nicht die pommersche Junkerunverfrorenheit und den breiten Hurra-Teutonismus akademischer Verbindungen. Sein ganzes Wesen strahlte etwas Freiheitsuchendes, Idealistisches aus.
Plötzlich war die leidenschaftliche, herausfordernde Musik Chopins verklungen, und Antonia stand vor ihm.
»Ich weiß«, sagte sie mit ihrer spöttischen Stimme, »wie ich Sie nennen werde: Den zwölften Schill’schen Offizier. Sie sehen so aus, als täte es Ihnen leid, nicht bei einer ähnlichen Gelegenheit gestorben zu sein wie die anderen elf.«
»Bei solchen Gelegenheiten, Erlaucht, stirbt man nicht, bei solchen Gelegenheiten wird man erschossen.«
Sie sah ihn an und lachte. »Meinetwegen«, sagte sie. »Mir läge nur sehr viel daran, daß Sie öfters lachen. Sie gefallen mir dann so viel besser.«
Kaum hatte sie ihre Worte beendet, als sie auch schon wieder am Flügel saß und mit viel Pathos die C-moll-Etude Nr. 12 spielte, eine Etüde, die er noch nie von seiner Mutter gehört hatte.
Ihm war, als vereinten sich ihre und seine Empfindungen in dieser Musik.
Wenn dies Liebe ist, dachte er, so ist sie schneller über mich gekommen als irgendeine Naturkatastrophe.
Antonia...
Für Minna und Lilly hatte indessen eine höchst angenehme Zeit begonnen. Antonia hatte ihnen zwei größere Räume im Souterrain angewiesen, Räume, die freundlich möbliert und mit Klingelkästen versehen waren. Es waren dies breite Holzkästen, die neben der Tür angebracht waren. Schwarzes, fein mit goldenen Strichen verziertes Glas rahmte kleine, viereckige Felder ein, auf denen nach dem Klingelzeichen eine Zahl erschien, welche dem also herbeigeklingelten Bediensteten die Nummer des Zimmers anzeigte, in dem man ihn erwartete.
Derart feine Klingelkästen hatte es in Engelhartstetten natürlich nicht gegeben. Hier jedoch stellten sie für Minna und Lilly eine Quelle des Entzückens dar. Nie kam ihnen der Gedanke, daß es mühsam sei, eiligst vom Souterrain des Seitenflügels über die gelblich-weiß-gestrichene Hintertreppe in die Beletage zu hasten und die Wünsche der Gnädigen zu erfüllen. Es kam ihnen auch nicht der Gedanke, daß es sehr beschwerlich für sie war, sich niemals gemütlich hinsetzen zu können, da man die gestreifte Schürze, das feine, rosa-weiß gestreifte Kleid nicht knautschen wollte, um so stets frisch und adrett vor der Herrschaft zu erscheinen.
Sie hatten hier einen Majordomus, einen kühlen, stets gleichbleibend freundlichen Mann von etwa vierzig Jahren. Er wurde nicht einfach beim Vornamen genannt, vielmehr sagte man ›Herr‹ zu ihm, und das Kleinmädchen war sogar gehalten, einen kurzen Knicks vor ihm zu machen. Er nannte sich ›Herr Joseph‹, einen Nachnamen schien er nicht zu haben.
Herr Joseph sprach jeden Morgen um sieben Uhr die Arbeit des Tages mit dem Personal durch. Jedenfalls die Arbeit, die auf jeden Fall getan werden mußte. Was die Herrschaft noch zusätzlich verlangte, blieb offen.
Das Personal aß gemeinsam in der Küche und verfügte über sein eigenes Geschirr und Besteck. Aus den gleichen Tassen zu trinken, von denselben Tellern zu essen wie ›die Leut‹, wäre für die Herrschaft unmöglich gewesen. Das war in Wien so, in Engelhartstetten, und in Soldin war es auch nicht anders.
Im Palais Bajar war die Köchin eine Böhmin, die, wortreich in ihrer eigenen Sprache redend, von einigen verstanden, von anderen nur angestaunt wurde. Sie war – das wurde auch in der Beletage bestätigt – eine Meisterin am Herd und durfte vor größeren Ereignissen die Wünsche der Herrschaft im Salon entgegennehmen, ja, es kam sogar vor, daß ihr ein Platz angeboten wurde, wenn die Besprechung gar zu lange dauerte.
Für Minna und Lilly waren dies alles derart neue Erlebnisse, daß ihnen gelegentlich ein Schauer über den Rücken lief ob der Tatsache, in einem solchen feinen Hause dienen zu dürfen.
Der Köchin gingen eine Servierfrau und ein Lehrmädchen zur Hand. Die Servierfrau versah ihren Dienst an der Tafel, das Lehrmädchen hinten in der Ecke, an einem besonderen Tisch. Dort schnitt sie Zwiebeln, Petersilie, Kräuter und Lauch, putzte Gemüse, schälte Kartoffeln, entsteinte Kirschen, Pflaumen und Marillen. Meist hatte sie geschwollene Augen vom reichen Tränenfluß beim Zwiebelschneiden. Es verstand sich von selbst, daß die Herrschaft eines solchen Unglückswesens niemals ansichtig wurde.
Lilly und Minna hatten mit dem übrigen Personal wenig zu tun. Außer dem Majordomus und der Köchin wechselten hier die Leute auch öfter als in Engelhartstetten, wo jeder jeden kannte.
Eine richtige Gemeinschaft wollte sich nicht herstellen lassen, und so war Lilly froh, daß wenigstens ihr Bruder Hans als Silberdiener untergekommen war.
Ob er zufrieden oder gar glücklich war, danach fragte niemand.
Es wäre weder Minna noch Lilly in den Sinn gekommen, etwas anderes zu denken, als daß diese Stelle ein Glücksfall für den Sohn eines böhmischen Tagelöhners sein mußte.
Hans vermißte das Land. Es machte ihm Freude, auf dem Feld zu arbeiten, und er sah gerne seine Familie um sich. Die Armut und das kärgliche Essen waren ihm gleichgültig.
Lilly war ihm die liebste Schwester.
Sie hatte es ihrerseits am leichtesten mit ihm, weil er sich einfach kommandieren ließ und zu allem, was sie sagte, meistens nur freundlich lachte.
Was die beiden Geschwister verband, war ihre Geschicklichkeit. Hatte es Lilly bis zur Anfertigung feiner Garderobe gebracht, konnte sie Frisuren auftürmen und mit Bändern und Blüten schmücken, so gelang ihrem Bruder Hans alles, was er biegen, drehen, stutzen, hobeln und schnitzen konnte. Seine Fähigkeit, alle möglichen Dinge zu reparieren oder ihnen zu einem funktionellen Sinn zu verhelfen, schien wahrhaftig grenzenlos.
Zwar konnte er beim Silberputzen diese Fähigkeiten weniger einsetzen, doch wurde auch seine Art, Leuchtern und Silberschüsseln, Bestecken, Tabletts und Tafelaufsätzen unvergleichlichen Glanz zu verleihen, allerseits sehr bewundert.
»So einen Silberdiener hatten wir noch nie!« ließ sich sogar Herr Joseph vernehmen, was in den Augen der anderen Bediensteten fast einem Orden gleichkam.
Hans war es egal. Ihm paßten der ganze Herr Joseph und sein höfisches Gebaren nicht. Wichtig war ihm nur, mit Lilly und Minna zusammenzusein. Wenig Gelegenheit gab es dazu, denn Minna und Lilly hatten unaufhörlich zu nähen, zu bügeln und sticken, ihre Herrin zu kämmen, zu schmücken, an- und umzukleiden.
»Wann hätte ich jemals Zeit, ein Tagebuch zu führen?« sagte Lilly spöttisch zu Minna. »Etwa mitten in der Nacht?«
Die Füße taten ihr weh, die Finger waren vom Nähen zerstochen – und doch hätte sie niemals anders leben wollen, als wie es ihr in dieser Zeit geschenkt war.
Sie dachte tatsächlich ›geschenkt‹ und drückte sich auch Minna gegenüber so aus. Und Minna, die dürre, vertrocknete Minna, gab ihr mit begeisterter Überzeugung recht. Auch sie empfand Lillys Stellung als glückhaftes Schicksalsgeschenk.
Als sei sie diejenige, welche all diese Herrlichkeit herbeigezaubert hatte, so wachte sie über Lilly. Und wußte nicht, daß es eine in Urtiefen ihres Wesens vergessene Mütterlichkeit war, die ihr dies eingab, eine Mütterlichkeit, der sich eine arme Weißnäherin niemals hatte hingeben dürfen.
Hans hockte in seiner Kammer. Sein Zeug war bestens hergerichtet, wobei das meiste von Lilly getan worden war, denn Hans verstand sich nicht sonderlich auf das Ausbürsten, Bügeln und Waschen seiner Kleidung.
Da saß er nun auf seinem Holzstuhl und starrte vor sich hin. Er hätte noch dreimal so viel Silber putzen können, als er es an diesem Tage getan hatte.
Man schrieb den 24. Juni, es war Johanni.
Die Herrschaften hatten eingeladen, und ihm oblag nun eine zusätzliche Arbeit: den Gästen aus der Kutsche zu helfen. Später, wenn sie heimfuhren, hatte er ihnen noch einmal dieselben Dienste zu erweisen.
Servieren durfte er nicht. Herr Joseph wachte eifersüchtig darüber, daß diese Arbeit nur von Dienern in Livree versehen wurde, Diener, die man sich auslieh oder lediglich für eine Saison beschäftigte. Und in ganz reichen Häusern waren sie fest angestellt.
So also kam es, daß Hans, während er auf die Abfahrt der Gäste wartete, in seiner Kammer saß, den Kopf in die Hände gestützt, und an die Johannisfeuer auf Erwenlauh dachte. Oder an jene Feuer, die nach der Ernte entzündet wurden, von Asten, Tannenzapfen, Kartoffel- und Rübenkraut, Feuer, in denen frische Kartoffeln geröstet wurden, die sie genußvoll aßen, Feuer, über die sie mit ihren Mädchen sprangen, um dann schnellstens mit ihnen im Buschwerk des Feldrandes zu verschwinden.
Damals hatte er Schwielen an den Händen und Blasen an den Füßen. Hier aber saß er, in schwarzer Hose und seidig glänzendem Satinjackett, und wußte nicht, was er mit sich anfangen sollte.
Aus den Salons klang Musik bis zu ihm herauf, hin und wieder auch die Singstimme einer Dame, die sich mit irgend etwas Ergötzlichem produzierte. Das waren nicht die halb gebrummten und gesummten Lieder der Feldarbeiter oder der aufmunternde Gesang hübscher Mädchen...
Das machte alles nur einsam und traurig.
Und Lilly würde ihm wieder und wieder sagen, welch großes Glück ihm zuteil geworden sei, ihm, dem Tagelöhnerssohn Hans, der nichts anderes vor sich gehabt hätte, als ebenfalls ein Tagelöhner zu werden, jemand, den man jederzeit hinausschmeißen konnte, wenn er einem nicht mehr paßte, krank oder unbotmäßig war.
Als ob sie ihn hier nicht genauso hinausschmeißen könnten!
Rausschmeißen konnten sie einen wie Hans überall.
Er war eben keiner von Adel, von Besitz oder Wissen. Da hieß es, den Buckel krumm machen, egal, wo man arbeitete, schuftete oder diente.
Hans zündete eine Kerze an.
Feine Lampen hatten sie nicht in den Dienstbotenkammern. In der Frühe genügte eine Kerze zum Anziehen, abends eine zum Ausziehen. So dazusitzen und nichts zu tun, war eine Ausnahme.
Er hatte auch keinen Hunger. In der Küche fielen genügend Reste von der herrschaftlichen Tafel an, und morgen würde es sowieso wieder lauter Excellentes geben, das übrig geblieben war.
Einmal wieder geröstete Kartoffeln essen oder Liwanzen wie zu Weihnachten...
Hans stand auf und legte sich auf sein Lager. ›Bett‹ konnte man zu den mit Seegras gefüllten und bunter Karowäsche überzogenen Kissen kaum sagen.
Frische Wäsche würde es auch erst in vierzehn Tagen geben. Vielleicht dann die blau- oder rosageblümte. Die gefiel ihm besser als das bunte Karo.
Hans hörte nicht das Tröpfeln der Wachskerze, die schief herunterbrannte.
Er hörte auch nicht das leise Geräusch, mit dem die Kerze umfiel.
Die Gäste hatten sich im Musiksalon eingefunden, um Antonias Spiel zuzuhören. Alles verhielt sich mustergültig still, keiner hüstelte, niemand tuschelte mit dem Nachbarn. Antonia spielte hingebungsvoll eine Chopin-Etude.
Da schrillte eine laute und mißtönende Glocke durch das Haus. Antonia brach ihr Spiel ab, alles horchte auf, zunächst gestört, verärgert, dann mit Schrecken.
Schreie wurden laut, Rufe, langgezogen und undeutlich zuerst, dann artikuliert und von Entsetzen geprägt.
»Feuer!« riefen die Bediensteten im ganzen Haus, und immer wieder: »Feuer!«
Was im ersten Augenblick noch unbegreiflich schien, war plötzlich bitterer Ernst.
Die Gäste hasteten zu den Türen, niemand nahm Anstand daran, sich jeglicher Verabschiedung zu enthalten; man stürzte zu den Ausgängen, die breite Treppe hinunter, gerade noch mit Entsetzen erkennend, daß der linke Flügel des Palais’ in Flammen stand. Der Brand kam aus dem Dachgeschoß, hatte sich in unbewohnte Räume gefressen und brach nun, durch Zugluft angefacht, vollends aus. Das Personal war bereits in vollem Einsatz, und mit bemerkenswerter Geschwindigkeit stellten sich auch benachbarte Helfer ein.
Mit einem Schlage schienen Eleganz, Heiterkeit und musisches Schwelgen erloschen. Unbarmherzig drängten sich Feuer und Rauch in die Rolle des Allesbestimmenden, Allesbeherrschenden. Frauen kreischten, Männer riefen, andere gaben Befehle, es war eine unvorstellbare Aufregung. Vor dem Palais knallten Hufe davontrabender Pferde, ratterten Räder auf dem Pflaster.
Alexander von Kronburg stand in einer Nische im Vestibül. Er hatte sich äußerst nützlich gemacht, indem er, kräftig, wie er war, sofort begonnen hatte, wertvolles Mobiliar aus den Zimmern zu schleppen. Er war dabei etwas außer Atem geraten, seine Uniform sah reichlich mitgenommen aus.
»Ich würde mein Leben nicht für ein Sofa riskieren«, hörte er eine Stimme hinter sich sagen.
Er wandte sich um. Er wußte genau, daß es Antonia war.
Ihr hatten der Brand und die damit verbundenen Aufregungen und Strapazen nicht das geringste anhaben können. Weder ihre Garderobe noch ihre Frisur waren in Unordnung geraten.
Alexander kam sich deklassiert vor in seiner ramponierten Aufmachung.
Antonia musterte ihn lachend. »Haben Sie denn gar kein Vertrauen in andere Leute?«
»Sie hätten Schaden nehmen können, Gräfin!«
»Ich?« fragte Antonia amüsiert. »Seien Sie versichert, daß ich durchaus in der Lage bin, so etwas zu übersehen. Ehe mir etwas passiert, bin ich längst fort.« Sie lachte wieder.
Alexander starrte sie an. Da stand sie, als sei der Brand eine Angelegenheit fremder Leute in fremdem Hause.
»Kommen Sie mit, wir musizieren weiter«, sagte sie und nahm ihn bei der Hand. »Im Musiksalon riecht es höchstens ein bißchen, sonst nichts.«
»Aber ... das Feuer ...«
»Das Feuer wird bald gelöscht sein. Haben Sie kein Gefühl dafür?« Sie zog ihn förmlich in den Musiksalon. Wie ein Verurteilter, Geblendeter oder wie ein Träumender ging er hinter ihr her.
Und tatsächlich, sie setzte sich an den Flügel. Noch einmal klangen die leidenschaftlichen Chopin-Etüden an sein Ohr.
Sie waren allein. Antonia spielte nur für ihn. Und wenn sich ihre Blicke trafen, lachte sie.
Er trat zu ihr, lehnte sich an den Flügel. Plötzlich, mitten im Akkord, faßte er nach ihren Händen und zog sie zu sich hoch.
Als er sie küßte, hatte er das Gefühl einer unendlichen, in nichts gestörten Einheit.
Er spürte kaum, daß sie sich ihm entzog. Erst als die ersten Takte einer neuen Etüde erklangen, kam ihm das Außergewöhnliche seiner Situation zum Bewußtsein. Er wollte zu ihr sprechen, wollte sie erneut an sich ziehen.
Doch da lächelte sie plötzlich. »Sie möchten sich verabschieden, Leutnant? Sie sehen derangiert aus und brauchen dringend einen Wagen.«
Sie reichte ihm die Hand, als habe sie ihn nie gekannt.
Er verließ den Salon, stolperte über Treppen, verkohlte Balken und in den Weg gestelltes Mobiliar ins Freie.
Es war tiefe Nacht, und der Schein glimmender Fensterbalken, schwelender Portieren und flackernder Laternen durchdrang die Dunkelheit.
In einer Seitengasse gelang es ihm, einen Fiaker zu bekommen. Verdreckt, unordentlich und mit zerrissenem Uniformrock erreichte er sein Quartier.
In dieser Nacht öffnete er zum ersten Mal eine Cognacflasche und trank sie halb aus, ehe er erschöpft auf sein Bett sank.