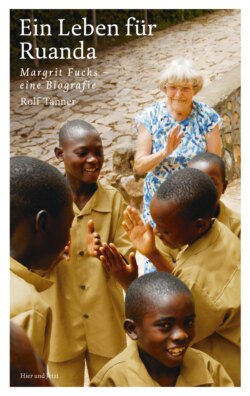Читать книгу Ein Leben für Ruanda - Rolf Tanner - Страница 16
Religiöse Prägung
ОглавлениеNach der Rückkehr aus Vilvoorde pflegte Margrit weiterhin Briefkontakt mit ihren Bekannten in Belgien, vor allem mit Schwester Berchmans und Louise Marijmissen. Beide berichten ausführlich über das religiöse Leben in Vilvoorde und machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich einen nachträglichen Eintritt von Margrit in den Orden wünschen. Louise fantasiert, wie das doch wäre, wenn sie gemeinsam die Ausbildung zur Nonne durchlaufen könnten. Sie schildert das Leben in der religiösen Gemeinschaft, berichtet von der Freude und dem Stolz, zum ersten Mal das Kleid der Ursulinen, Habitat genannt, zu tragen, bezeugt die Liebe der älteren Schwestern für die Postulantinnen und Novizinnen und wünscht sich, dass Margrit so viel wie möglich für sie betet – sie werde es umgekehrt auch tun. Allerdings schreibt sie auch in aller Unschuld, dass sie manchmal von anderen Schwestern gehänselt und ausgelacht werde, was einen gewissen Kontrapunkt zum ansonsten offenbar glücklichen Leben hinter Klostermauern setzt. Schwester Berchmans dagegen erkundigt sich vor allem nach Margrits Befinden, erwähnt die Weihen junger Frauen, die Margrit während ihres Aufenthalts in Vilvoorde kennengelernt hat, zu vollwertigen Ursulinen und tönt immer wieder an, wie gut man sie in Belgien brauchen könnte. Und anschliessend an die Schilderung der Aufnahme von drei Postulantinnen im Frühjahr 1936 fragt sie: «Voudriez-vous faire le no. 4 ?» Immer wieder taucht in den Briefen die Frage auf, ob sie den Willen Gottes für sich kenne: «Est-ce que vous soyez bien tous les jours pour savoir ce que le Bon Dieu veut de vous ?» Beide, Schwester Berchmans und Louise, waren sich einig, dass keine der im Institut neu angekommenen Schweizer Schülerinnen das Format von Margrit hatte.
Anfang 1936 gab es Pläne, dass Margrit im Sommer nach Vilvoorde auf Besuch gehen sollte. Doch die Mutter intervenierte schliesslich mit Hinweis auf den eben in Spanien ausgebrochenen Bürgerkrieg, die Reise sei zu gefährlich. Louise äusserte weiterhin die Hoffnung, Margrit werde doch noch einmal nach Vilvoorde kommen. Im Jahr, in dem Margrit 20 Jahre alt und damit volljährig wurde, schrieb ihr Louise, sie wünsche sich inständig, Margrit könne nun die Mutter überzeugen, die Reise zu gestatten. Louise anerbot sich in ihrer kindlichen Art sogar, Deutsch zu lernen, um an die Mutter zu schreiben! Doch wieder wurde nichts daraus. Margrit bot nun Louise an, sie solle sie doch zusammen mit ihrer eigenen Mutter in der Schweiz besuchen kommen. Doch das wiederum lehnte Louise ab.
Der Briefkontakt wurde seltener. Louise schwor, sie werde Margrit nie vergessen und ihr immer treu sein. Ein letztes vorhandenes Schreiben stammt aus dem Januar 1942, in welchem Schwester Berchmans darüber berichtet, dass Louise nun Schwester Virginie sei. Daneben dominieren aber die Schilderungen über die schwierige Situation im von Deutschen besetzten Belgien. Es herrschte mittlerweile Krieg. Die Ursulinen hatten beim Ausbruch der Kämpfe im Mai 1940 das Institut verlassen, waren aber danach relativ schnell zurückgekehrt – zum Glück unversehrt. Versorgungsschwierigkeiten bestimmten den Alltag. Auswärtige Pensionärinnen konnten nicht mehr aufgenommen werden. Alle Schülerinnen aus der Schweiz waren im Herbst 1939 evakuiert worden, zuerst mit dem Autobus nach Paris, von dort mit der Eisenbahn in die Heimat. Für die Bedürftigen und Kriegsgeschädigten hatten die Ordensfrauen eine Suppenküche eingerichtet. Schwester Berchmans hoffte und betete, dass im Januar 1943 endlich Frieden einkehre und die Schweiz weiterhin vom Krieg verschont bleibe. Sie musste sich noch zwei weitere Jahre gedulden. Wenn auch der Kloster- und Ordenseintritt für Margrit offenbar an Bedeutung verlor, blieb das Thema mit dem Eintritt der Schwester Elisabeth bei den Ingenbohler Schwestern und der Cousine Bertha Mettauer doch präsent.
Margrit las religiöse Erbauungsliteratur, wie sie damals unter frommen Katholikinnen weit verbreitet war, später auch die historischen Romane des ungarisch-britischen Schriftstellers Louis de Wohl. Sie schilderten auf moderne Art das Leben von Heiligen und christlichen Helden. Vor allem religiöse Frauengestalten hatten es Margrit angetan – allerdings eine besondere Art: nämlich solche, die sozial und karitativ tätig waren. Mit vergeistigten Mystikerinnen und Wundertäterinnen konnte Margrit wenig anfangen. Louise schreibt ihr einmal, sie erwäge als Schwesternnamen entweder Virginie nach ihrer eigenen Mutter oder Imelda, da ihr die selige Imelda besonders Eindruck mache. Margrit zeigte Interesse, sodass sich Louise anerbot, Literatur zur seligen Imelda herauszusuchen. Der Imelda-Kult hatte damals in Belgien eine gewisse Verbreitung. Die Heiligenlegende geht auf das 14. Jahrhundert zurück. Imelda war ein Mädchen aus einer adeligen italienischen Familie, das schon sehr früh die Kommunion zu sich nehmen wollte, was man ihr aber mit dem Hinweis auf ihr Alter verweigerte. Darauf schickte ihr der Himmel eine Hostie, die vor Imelda in der Kirche schweben blieb. Nachdem Imelda diese Hostie zu sich genommen hatte, starb sie, überglücklich, auf der Stelle. Später wurde sie selig gesprochen, ihr Kult wurde von der Kirche im 19. Jahrhundert anerkannt und sie zur Patronin der Erstkommunikanten erhoben; ihr Leichnam ist angeblich nie verwest. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der praktisch denkenden Margrit, bei aller jugendlichen Schwärmerei, diese fantastische Geschichte besonders Eindruck machte. Auf jeden Fall erwähnt Louise in der späteren Korrespondenz das Thema nicht mehr.
Eher entsprach Margrit das Leben der Schwester Maria Theresia Scherer. Sie war die Mitbegründerin der Ingenbohler Schwestern und eine Pionierin der sozialen, karitativen und pädagogischen Frauenarbeit. Als ein Zürcher Verlag gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Sammlung von Lebensbildern bedeutender Schweizer Persönlichkeiten herausgab, war sie unter Dutzenden Männern die einzige Frau. 1825 im luzernischen Meggen in einfache bäuerliche Verhältnisse geboren, begegnete sie 1844 dem Kapuzinerpater Theodosius Florentini. Dieser genoss damals einen Ruf als Sozial- und Schulreformer. Florentini betrieb zahlreiche Projekte zu Verbesserungen im Kranken-, Armen- und Schulwesen; diese liessen sich aber nur verwirklichen, wenn ihm entsprechend geschultes Personal zur Verfügung stand. Seine Idee war, speziell auf diese Aufgaben zugeschnittene Ordensgemeinschaften von Frauen und Männern einzusetzen. Er gründete deshalb die Menzinger Schwesterngemeinschaft. Als sich diese aber auf ihre Aufgaben im Bereich der Mädchen- und Töchterausbildung konzentrieren wollte, trennte er sich von ihr und rief als neue Kongregation die Ingenbohler Schwestern ins Leben. Eine von Florentinis engsten Mitarbeiterinnen war von Anfang an Schwester Maria Theresia. 1857 wurde sie zur ersten Generaloberin der Ingenbohler Kongregation gewählt und betrieb systematisch deren Aufbau, zuerst in der Schweiz, anschliessend auch im benachbarten Ausland. Als sie 1888 starb, umfasste die Kongregation fast 1700 Schwestern weltweit, 80 Schulen, 28 Waisen- und Erziehungsheime, 25 Kinderheime und -horte, 87 Armenhäuser und 149 Spitäler und Krankenpflegestationen. 1995 wurde sie von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen.
Da ihre Schwester Elisabeth in den Ingenbohler Orden eintrat, dürfte Margrit die Geschichte von Schwester Maria Theresia früh und gut gekannt haben. Die Parallelen zwischen beiden Frauen sind frappant: Beide gaben sich der Hilfe für die Armen, die Kranken und die Waisen hin, mit grösster Selbstverständlichkeit und oft (fast) bis zum Punkt der Selbstaufopferung; beide hatten einen eisernen Willen und konnten sich durchsetzen; beide waren tiefgläubig und sahen in ihrer Aktivität den Tatbeweis der Liebe; beide hatten, wenigstens in ihren Anfängen, einen kirchlichen Mentor, von dem sie sich aber mit der Zeit auch emanzipierten – bei Schwester Maria Theresia war das Theodosius Florentini, bei Margrit Erzbischof André Perraudin. Beide Frauen besassen einen guten Sinn für Humor. In Schwester Maria Theresias umfangreicher Korrespondenz finden sich Wortspiele wie «Sie machen Fortschritte wie ein alter Schuh». Oder, an eine Schwester gewandt, die von einer Sammelreise zurückkehrte: «Im Falle Sie so viel Geld sammeln, dass Sie es von Brunnen bis ins Institut hinauf nicht schleppen können, so telegrafieren Sie in Luzern, damit man Ihnen Pferd und Wagen entgegenschicken kann» – Sätze, die so auch von Margrit hätten geschrieben werden können. Und wie später von Margrit hiess es damals von Schwester Maria Theresia: «Sie galt als Mutter der Waisen.» Nur die Tatsache, dass Margrit schliesslich keinem Orden beitrat, unterschied sie.
Margrit war eine fromme Christin und treue Katholikin, aber keine Frömmlerin. Während Jahrzehnten ging sie jeden Tag in Brugg zur Frühmesse. Und am Sonntag gingen die weiblichen Mitglieder der Familie Fuchs geschlossen in die Kirche zum Gottesdienst. Vater und Bruder scheinen dagegen am religiösen Leben wenig bis gar nicht teilgenommen zu haben; doch das war ein altbekanntes Phänomen: Durch all die Jahre hindurch ziehen sich die Klagen seitens der Kirchenoberen, dass sich die Männer kaum am Pfarreileben beteiligten. Dass die Gebote der Kirche und des Glaubens nicht hinterfragt wurden, war selbstverständlich im katholischen Milieu (siehe «Kontext: Die katholische Pfarrei St. Nikolaus», S. 84). Doch Margrit hatte ihre eigene Meinung zu vielen Dingen. Sie war keine kritische Intellektuelle, aber was sie für gut befand, das befand sie für gut, unabhängig von der Doktrin der Kirche. So wurde in der Festschrift zum Aargauer Katholikentag von 1953 noch davor gewarnt, die Frauen ins berufliche Erwerbsleben zu schicken, da ihnen sonst das Frausein abhandenkomme. Margrit kümmerte diese Gefahr wenig. Ihr Urteil über ihr Erwerbsleben war eindeutig: «Ich liebte meinen Beruf!» Geschiedene waren im katholischen Milieu kaum geduldet und wurden zum grossen Teil wie Aussätzige behandelt. Margrit kümmerte sich nicht um diese Vorbehalte und Vorurteile. Die schwierige Ehe ihrer Mutter vor Augen, hatte sie wohl Verständnis dafür, dass es manchmal sinnvoller ist, sich zu trennen, als einfach weiterzumachen um den Preis der seelischen und oft auch körperlichen Schädigung und Zermürbung der Involvierten. Sie pflegte den Kontakt zu Geschiedenen weiterhin, ob katholisch oder reformiert, und hörte sich ihre Sorgen und die oft vor allem bei Frauen wegen der Scheidung auftretenden psychischen Probleme geduldig an. Und während sie religiöse Erbauungsliteratur las, hatte sie auch eine Affinität zum kirchenkritischen bis kirchenfeindlichen Rainer Maria Rilke, den sie in ihren späteren Rundbriefen aus Afrika immer wieder zitierte. Diese Eigenständigkeit im Urteil koppelte sich mit einer sehr persönlichen und eigenen Beziehung mit Gott – «sie hatte einen eigenen Draht zum Himmel».