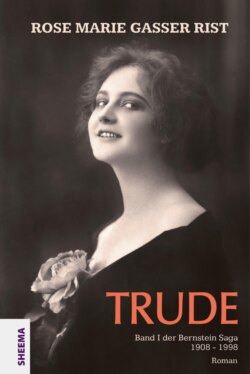Читать книгу Trude - Rose Marie Gasser Rist - Страница 13
Оглавление1929 Das tägliche Brot
Wenige Tage nach der Hochzeit brachen die Neuvermählten nach Leningrad auf. Olga, die Mädchen und Freunde begleiteten das Paar zum Bahnhof. Auch Lena. Es war ein feierlicher Moment. Und gleichzeitig war es ein wehmütiger Abschied von den Menschen, die Trude durch all die Jahre getragen und begleitet hatten. Sie sah ihre Lieben dem wegfahrenden Zug mit Taschentüchern nachwinken, bis eine Kurve den Blickkontakt abbrach. Ihre Wangen glänzten tränennass.
So schwer es ihr fiel, Olgas sicheren Hafen zu verlassen, so sehr freute sie sich auf die neue Zukunft. Es war ihr einerlei, wo sie diese gestalten würden. Hauptsache Valentin und sie waren zusammen. Die beiden verband vom ersten Augenblick an ein entspanntes Wohlbefinden in der Gegenwart des andern, das nur durch den Bruch in Berlin erschüttert worden war. Wie Valentin sich am Ende gegen alle Konventionen und Autoritäten für sie entschieden hatte, zeigte seine Entschlossenheit. Einen größeren Liebesbeweis gab es für Trude nicht.
Mit großem Behagen an der Seite ihres frisch angetrauten Mannes machte sie sich auf nach Leningrad. Das Paar richtete sich die lange Fahrt auf den harten Holzbänken so bequem wie möglich ein. Die meiste Zeit saßen die beiden schweigend, die eine Hand entspannt in der des anderen ruhend. Mit Blick auf die vorbeifliegende Landschaft ließen sie sich von der russischen Eisenbahn in die Zukunft fahren.
Leningrad war Trude bis zu diesem Zeitpunkt nur eine Idee auf der Landkarte und würde nun zu ihrem Lebensmittelpunkt werden. Valentin an seinen Arbeitsort zu folgen bedeutete eine trittsichere Ausgangsposition für alle zukünftigen Schritte.
Trude trat ihren neuen Lebensabschnitt selbstbewusst an. Ihre russischen Sprachkenntnisse würden ihr helfen, Kontakte zu knüpfen. Sie würde die Wohnung ausstatten, die Valentin im Vorfeld gefunden hatte. Irgendwann würde sie einem Kind das Leben schenken – und in den folgenden Jahren eine weiterführende Schule besuchen, studieren und Arbeit finden. Trudes Kopf war voller Pläne, ihr Herz voller Zuversicht.
Nach Tartu und Berlin war Leningrad erst ihre dritte Stadt. Da sie an Berlin keine guten Erinnerungen knüpfte, war Trude einfach zu begeistern. Es war eine prächtige Metropole. Mit den imposanten Palästen und goldenen Kuppeln hatte Leningrad für sie etwas Märchenhaftes. Die Lage am Meer verlieh ihr wie allen Hafenstädten Weltoffenheit. Trude erforschte die Stadt zu Fuß und mit Straßenbahn. Ein in schwarzes Leinen gebundenes Tagebuch, mittlerweile schon das fünfte, war ihr ständiger Begleiter. In ihm hielt sie alle Eindrücke in Worten und Skizzen fest.
Die ersten Monate verflogen wie im Flug. Sie nahm alle neuen Eindrücke durch eine rosarote Brille wahr. Im Rausch der Begeisterung übersah sie die unschönen Flecken der Stadt großzügig. Trude vermied es zu Beginn, genauer hinzusehen. Erst nach und nach schärfte sich ihr Blick und sie konnte die Arbeitslosen, die sich in den Gassen an offenen Feuern die Finger wärmten, und die schmutzigen Kinder, die barfuß und in Lumpen gekleidet für ihre Familien bettelten, nicht mehr ignorieren.
Trude und Valentin standen auf der Sonnenseite des Lebens und brauchten sich keine existenziellen Sorgen zu machen. In den Häfen wurden emsig Schiffe gebaut, um Weltmeere und Überseeländer zu zivilen und militärischen Zwecken zu erobern. Valentin war als Schiffsingenieur ein gefragter und gut bezahlter Mann.
Tagsüber war Valentin weg, verschluckt von einer Arbeitswelt, zu der Trude keinen Zugang hatte. Die Werft lag dreißig Minuten mit der Straßenbahn von der Zweizimmerwohnung entfernt. Am Abend berichtete er, dass er gerade an einem Eisbrecher arbeitete. Trude hörte zu, viel mehr als die technischen Details interessierte sie, mit wem er seine Mittagspause verbrachte, worüber er mit seinen Kollegen sprach, was kulturell in der Stadt passierte, welche politischen Ereignisse die Menschen umtrieben. Valentin war Trudes Informationsbrücke zur Welt.
Ihre selbst auferlegte Aufgabe war, sich ihr neues Territorium zu erobern. Wo und in welchen Entfernungen waren Brot und andere Lebensmittel zu beschaffen? Trude hätte selber backen können, doch sie erachtete es als wichtig, sich mit dem täglichen Gang zum Bäcker eine Dosis Menschenkontakt zu sichern. So wurde Einkaufen zur Forschungsreise. Aus drei Möglichkeiten, die in Fußdistanz lagen, wählte sie die Bäckerei Schmitz für das tägliche Brot. Der Schriftzug über der Markise verriet deutsche Herkunft. Fast eine Bürgschaft für gute Qualität. Trude erfuhr, dass Bäckermeister Schmitz mit seiner Familie im Zug der antideutschen Hatz bereits im Ersten Weltkrieg vertrieben worden war. Nur der Name blieb auf der Markise. Ob aus Kalkül – auch Trude ließ sich ja vom Versprechen auf deutsches Backgut ködern – oder Achtlosigkeit, erfuhr Trude nie.
Hinter „Schmitz“ verbarg sich ein netter russischer Familienbetrieb. Richtig hießen die Leute Dowski. Es waren Vadim und Svetlana mit ihren fünf Kindern. Trude konnte sie nicht auseinanderhalten und machte sich deshalb auch nicht die Mühe, sich deren Namen zu merken. Allesamt waren sie gemütliche Menschen mit rundlichem Körperbau. Die Gesichtsbacken waren weich wie Semmeln und verrieten, dass kein Mangel herrschte.
Die Dowskis hielten nicht viel von der Politik. Vadim und Svetlana hatten für alle und jeden immer ein nettes Wort. Wozu politisieren? Wer satt ist, braucht nicht missgünstig zu sein. Ein zufriedener Mensch hat keine Feindbilder und keinen narzisstischen Ehrgeiz, sich öffentlich zu profilieren. Wer bei Schmitz eintrat, streifte die Gesinnung an der Fußmatte ab. Der Verkaufsraum war eine kleine heile Welt. So war schon beim ersten Besuch besiegelt, dass sich Trude die Mühe ersparen konnte, eine andere Bäckerei zu suchen. Sie blieb Schmitz alle Jahre treu.
In Leningrad lernte Trude, aus der Brotauslage den Wohlstand der Bevölkerung zu lesen. In den ersten Jahren von 1929 bis 1930 war die Vitrine dürftig mit wenigen Brotlaiben bestückt, welche von der Kundschaft im Nu leer gekauft war. Wie alle Großstädter in Europa hatten auch die Leningrader unter der Wirtschaftskrise Ende der Zwanzigerjahre zu leiden. Später kamen neue Brotsorten hinzu und nach und nach füllte sich das Schaufenster mit bunter Konditoreikunst. Zuckerzeug demonstrierte protzig: „Es geht uns gut!“
Manchmal ließ sich Trude von den süßen Leckereien verlocken, doch meist wählte sie Brot für sich und Valentin. Am Anfang gab es nur das eine dunkle Roggenbrot. Als die Auswahl größer wurde, kosteten sie sich durch das Sortiment. Doch allmählich kristallisierte sich ihr tägliches Brot heraus.
An den Abenden und Wochenenden zu zweit arbeiteten sie sich zum anderen durch. Da sie bis dahin kaum geteilte Zeit verbracht hatten, wurden sie sich nicht überdrüssig, aus ihrer Vergangenheit zu erzählen. Abendfüllend waren die Geschichten der Kindheit, von Freundschaften und von Entbehrungen. Valentin brachte seinen Bücherfundus mit in die Ehe, aus dem sie sich gegenseitig vorlasen.
Neugierig erforschten sie auch ihre Körper. Fern aller Konvention waren sie frei, sich ohne Scham kennenzulernen. Sie kannten keinen gültigen Maßstab, wie man sich als Mann und Frau sittlich zu verhalten hatte. Für sie war es das Natürlichste der Welt, sich gegenseitig bei der Morgentoilette zuzuschauen. Es wurde ihr allabendliches Ritual, sich gegenseitig die Kleider abzustreifen, herumzualbern und sich wie Welpen zu balgen. Sie jagten sich durch die Wohnung bis ins kalte Schlafzimmer, um sich dort unter der klammen Decke aneinander zu wärmen. Manchmal hatte das Spiel eine Fortsetzung und manchmal schliefen sie einfach geborgen ineinander verschlungen ein.
Jeder Abend an Valentins Seite war für Trude ein Heimkommen. Über alle Jahre. Wie sehr auch die Welt draußen tobte und sich ihnen Widrigkeiten in den Weg stellten, die Kindersorgen ihnen über den Kopf wuchsen oder sie sich heftig zankten. Beim Hinübergleiten vom Alltag in den Schlaf, wenn die Körper einander wärmten, wenn sich Gedanken langsam verflüchtigten und sich die Emotionen zur Ruhe legten, kam Trude an, bei sich, bei Valentin, beim stillen Glück.
Mit ihrer Ehe verhielt es sich so wie mit dem Gang zum Bäcker. Unerfahren kostete sich das Paar langsam durch die Auslagen des anderen. Es gab üppige und karge Zeiten. Sie ließen sich vom Zuckerguss des anderen verführen. Manchmal betrieben sie Völlerei. Und mit der Zeit wurde offenbar, was im Zusammenleben taugte und was nicht. Allmählich erkoren sie sich wie von selbst die Lieblinge: die Lieblingsmahlzeiten, der Lieblingsplatz am Tisch, die Lieblingsseife, die Lieblingsredewendungen und die Lieblingsliebesstellung.