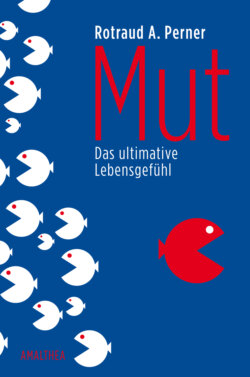Читать книгу Mut - Rotraud A. Perner - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gleichmut
ОглавлениеWankelmut wird meist dann vorgeworfen, wenn jemand zu schnellen Entscheidungen drängen will – und meist hat diese Person geheime Gründe, weswegen sie Nachdenken und Nachfühlen verhindern möchte und daher eine Entweder-Oder-Positionierung einfordert. Jemanden zu bedrängen, zählt zu den vielen Formen von Gewalt. Wer kennt nicht die spürbare Aggression und Irritation, den ausgelösten Stress, wenn jemand (Männer!) auf der Autobahn korrekt vor ihm Fahrende zum Ausweichen auf die daneben liegende Fahrspur zwingen will? Wie Giftwolken dampft es da von hinten, so lädt sich der Nachkommende mit Wuthormonausschüttungen auf (und schädigt nicht nur die Gesundheit des Vorausfahrenden, sondern auch seine eigene). »Der Klügere gibt nach und der Esel fällt in den Bach« wurde in der Zeit, als Sprichwörter noch zur Kindererziehung genutzt wurden, geunkt. In östlichen Verteidigungstechniken beschreibt Eugen Herrigel diese Weisheit als »die in ein System gebrachte Selbstverteidigung, welche den Gegner dadurch zu Fall bringt, dass man seinem leidenschaftlich vorgetragenen Angriff unvermutet und ohne jeden Kraftaufwand elastisch nachgibt und so erreicht, dass sich seine Kraft gegen ihn selbst kehrt ...«.
Was an dieser Stelle hinsichtlich des Körperlichen angesprochen wird, funktioniert ebenso psychisch und mental: Es gilt die Balance zwischen aggressivem und resignativem Reagieren zu finden – wie überhaupt im Leben Balance, Gleichgewicht – Gleichmut – eine wesentliche Lebens- und Überlebenskompetenz darstellt. Wenn man sich vorstellt, dass man körperlich attackiert wird, dann fallen meist nur zwei Verhaltensweisen ein: nach vorne stürmen – aggressiv, vom lateinischen aggredio, ich greife etwas oder jemanden an – oder nach hinten weichen – regressiv, vom lateinischen regredio, ich gehe zurück. Dem davon abgeleiteten Begriff Regression werden wir später nochmals begegnen – als bewusste Taktik oder Strategie oder unbewusste Überlebenstechnik.
Eine dritte Möglichkeit bestünde im »Sowohl – als auch« bzw. »Weder – noch«. Jene wird zwar als respektable Neutralität oft verteidigt, während diese als unehrenhaftes Sich-von-Verantwortung-Wegschwindeln missbilligt wird. Dahinter steckt die unausgesprochene Forderung, sich einer von mehreren Streitparteien anschließen zu sollen – ein Dilemma, Trilemma etc., das Scheidungskinder nur zu gut kennen. Es bedarf einigen Mutes, diesen Verlockungen zur Parteilichkeit zu widerstehen. Deswegen finde ich auch, dass die Frage »Wen hast du lieber – den Papa oder die Mama?« wohl die böseste ist, die man einem Kind stellen kann. Ich habe daher mit großer Freude wahrgenommen, dass ein TV-Werbespot des Jahres 2015 für zwei Sorten Fischstäbchen von der ursprünglichen Fassung mit der bloß hörbaren Frage des männlichen Kindes, welche davon die Eltern lieber hätten, und der Antwort der Mutter, sie habe beide gleich gern so wie ihre beiden Kinder, worauf die kleine Tochter stolz – hochmütig! – protestiert »Der Papa hat aber gesagt, er hat mich lieber!«, auf diese Antwort geändert wurde: »Der Papa hat gesagt, er kann sich auch nicht entscheiden!«, worauf man dessen Stimme hört: »Muss ich auch nicht!«
Gleichmut stellt im Leben eine wesentliche Lebens- und Überlebenskompetenz dar.
Es liegt nicht nur an Gedankenlosigkeit, auf offen dargelegter Parteinahme zu bestehen, sondern an dem von alters her gewohnten Aufteilen der Welt zwischen Siegern und Verlierern. Sieg wird dabei immer wieder bloß quantitativ gedacht: Wer sind die Mehreren, Stärkeren, Schnelleren … »Citius, altius, fortius« – schneller, höher, stärker – lautet demnach die Parole in sportlichen Wettkämpfen bzw. den Olympischen Spielen, und diese Suggestion des endlosen Steigerungspotenzials führt immer häufiger zu schwersten Körperverletzungen und Lähmungen. Die Hardware Körper ist nun mal begrenzt und nicht unentwegt fortschreitend der geistigen Software Wunschvorstellungen anpassbar! (Wohin solches finanzgierige Wunschdenken führen kann, zeigte sich am sogenannten VW-Abgas-Skandal.)
Deswegen ist Gleichmut auch so wichtig: Er balanciert zwischen Selbstunsicherheit und Selbstüberschätzung, zwischen Unterforderung und Überforderung. Alle, die Auto fahren, wissen wohl, dass ständig untertourig zu fahren genauso den Motor ruiniert wie übertouriges Fahren. Man braucht daher ein Gespür für das jeweils richtige Maß – oder ein regelmäßiges Screening. Als ich einmal an Borreliose erkrankt war, wollte meine damalige Allgemeinmedizinerin unbedingt vorher den chemischen Nachweis einholen und erst dann mit der Therapie beginnen. Ich protestierte: Die wachsenden ringförmigen roten Male auf meiner Haut, die Müdigkeit etc. bewiesen doch eindeutig diese Diagnose – und außerdem hatte am Wochenende vor meinem Arztbesuch eine Hautärztin, die an der Kommunikations-Werkstatt teilnahm, die ich in Vorarlberg abgehalten hatte, und der ich die Flecken auf meiner Haut gezeigt hatte, Borreliose diagnostiziert – und an einen Zeckenbiss Tage vorher konnte ich mich auch erinnern. Mir war klar: Die Ärzteschaft ist sich bewusst, dass sie auch in Österreich zunehmend mit »amerikanischen Zuständen« rechnen müsse, dass nämlich ärztliche Kunstfehler gesucht oder auch nur behauptet und mithilfe von Anwälten in bare Münze verwandelt werden würden. Ja, manche trauen sich sowas – und versuchen, so ihre Trauer oder Wut zu heilen. In solch einem Fall hilfreiche Gespräche zu führen, was unter anderem auch bedeutet, darauf zu verzichten, sich zu verteidigen, können leider nur wenige – aber das kann man lernen (beispielsweise in eben diesen meinen Kommunikations-Werkstätten).
Ähnlich klagte einmal ein angehender Onkologe, der bei mir an einer Supervisionsgruppe für Turnusärzte teilnahm, dass die Geschwindigkeit, mit der eine Vielzahl von Patienten »abgefertigt« werden müsse, es fast unmöglich mache, korrekt zu diagnostizieren. Dafür brauche man ja eine intensive Wahrnehmung, Fühlen und Denken gleichzeitig – und er wolle nicht auf Screenings ausweichen, das vermindere die Arzt-Patient-Beziehung.
Gleichmut beinhaltet auch einen gelungenen Ausgleich zwischen beschleunigender Geschwindigkeit und beruhigendem Innehalten. Im militärischen Modell gibt es die Ruhe nur beim Wachen und Lauern, aber sie bedeutet keine wirkliche Entspannung, sondern angespanntes Hören und Lugen. Gleichmut hingegen ist »absichtslose Absicht«, wie es im Buddhismus heißt. Man müsse lernen, in »gelockertem Gleichmut darüber zu stehen, sich also so zu freuen, wie wenn ein anderer« und nicht man selbst das Ziel erreicht habe, präzisiert der in Deutschland wie in Japan unterrichtende Philosoph Eugen Herrigel das, was Daisetz Suzuki die »nicht gekonnte Kunst« nennt. Sie zeigt sich auch im rechten Wartenkönnen.
Ein Beispiel, das ich dazu gerne zitiere, weil es viele Fernsehzuseher kennen, stammt aus der zweiteiligen Sendung über Odysseus, den sagenhaften König von Ithaka, der gut zehn Jahre auf dem Meer umherirren musste, weil er den Zyklopen Polyphem, einen Sohn des Meeresgottes Poseidon, geblendet hatte. Von seiner Schutzgöttin Pallas Athene in einen Bettler verwandelt, kann er nach vielen Abenteuern endlich in sein Königshaus zurückkehren, wo ihn niemand erkennt außer seinem Hund und seiner alten Amme, als sie eine Kindheitsnarbe an seinem Bein erblickt. In seinem Haus verfressen und versaufen etliche Freier seiner Gattin Penelope die Früchte seiner Ländereien, denn sie möchten die Frau und das Königreich gerne erlangen, da doch Odysseus als tot gilt. Penelope jedoch will auf ihren Mann warten – deshalb webt sie an einem Teppich, den sie nächtens wieder auftrennt. Gerade als der unerkannte Odysseus heimkehrt, ist die Geduld der Freier zu Ende, sie randalieren und bedrohen Penelope, sie müsse sich endlich für einen von ihnen entscheiden. Odysseus offenbart sich nun heimlich seinem halbwüchsigen Sohn Telemachos und lässt diesen seiner Mutter raten, sie solle doch verkünden, sie würde denjenigen erwählen, der den Bogen des Odysseus zu spannen vermöchte. Das konnte nämlich nur er. Und dann kommt die Szene, die ich so gerne in Erinnerung rufe: Während der ungestüme Jüngling den getarnten Vater drängt, die Freier zu erledigen, beruhigt ihn Odysseus, er möge noch warten – der rechte Augenblick, der »Kairos«, sei noch nicht da. Erst als der letzte der Freier vergebens versucht hat, den Bogen zu spannen, bittet er bescheiden, ob er es nicht auch probieren dürfte … und erntet Spott und Hohn, was sich der Bettler wohl einbilde. Aber in Erwartung eines belustigenden Schauspiels gestatten sie es ihm doch. In diesem Moment, als Odysseus den Bogen ergreift und spannt, fällt seine Tarngestalt von ihm ab und der König von Ithaka steht vor den bestürzten frevelhaften Freiern, die er nun Pfeil auf Pfeil hinrichtet (und die mit ihnen buhlenden Dienerinnen gleich dazu).
Gleichmut ist nicht zu verwechseln mit Wurschtigkeit, wie man auf Österreichisch die Geisteshaltung der absichtlichen Verweigerung irgendeiner Bezugsnahme benennt. Wurscht – die Dialektaussprache von Wurst – deutet auf einen in einer glatten Hülle eingeschlossenen Mix verschiedener Zutaten. Man weiß nicht, was darin ist, will es aber auch gar nicht wissen. Ähnliche Verwechslungsgefahr besteht gegenüber dem Gebrauch des Wortes »egal«, das eigentlich »gleiche Gültigkeit« aufzeigt, nicht aber die pejorative Bedeutung von distanzierter Gleichgültigkeit. Viele Menschen sind leider in ihrer Jugend im Deutschunterricht nicht darauf hingewiesen worden, wie stark Fehlformulierungen die eigene Befindlichkeit und damit unser Gemüt beeinflussen.
Wir denken ja meist in Sprache – im sogenannten »inneren Dialog« – und wählen gewohnheitsmäßig unpassende Worte, wie wir sie eben von denjenigen gehört haben, die sie uns als Kleinkindern vorsagten. Deswegen ist es wichtig zu üben, sich im Gespräch klar auszudrücken – und dazu brauchen wir einerseits den Frage-Mut, damit meine ich, bei Unklarheiten nachzufragen, andererseits aber auch den Selbstkritik-Mut, wenn man auf Unklarheit hingewiesen wird, dafür zu danken – wir arbeiten damit daran, einander besser zu verstehen und schaffen ein Vorbild sowie einen Beitrag zu sozialem Frieden.
Wir brauchen einerseits den Frage-Mut, andererseits aber auch den Selbstkritik-Mut.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Unterschieden, die üblicherweise als Charaktereigenschaften beschrieben und für unveränderlich gehalten werden. Es will aufzeigen, dass das mit der Unveränderlichkeit nicht stimmt, sondern nur eine beharrliche Willenskundgebung ist, sich nicht ändern zu wollen – was bedeutet, eigene Unvollkommenheit zu verleugnen, weil ihr Zugeständnis etwas Unerträgliches wäre. Man hat nicht den Mut, sich infrage zu stellen – und anderen, die es wagen, einem einen Spiegel vorzuhalten, geht man aus dem Weg. Damit wird aber möglicher Verbesserungsbedarf nicht entdeckt und schon gar nicht verwirklicht.
Dabei kann man solche »angeblichen« Charakterzüge auch ohne therapeutische Hilfe ändern – vorausgesetzt man ist dazu bereit und kennt die Methode.