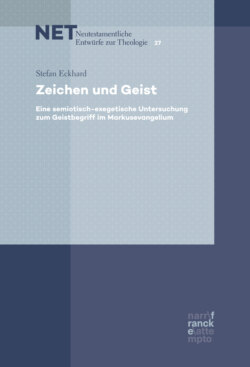Читать книгу Zeichen und Geist - Stefan Eckhard - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4. Wahrheit und Finalität
ОглавлениеDas dynamische oder reale bzw. wirkliche oder mittelbare Objekt existiert unabhängig vom Denkvorgang. Es besitzt ontologischen Status und wirkt in logischer Form auf die zeichengebundene Erkenntnisbildung ein. Folglich ist das Zeichen dem Objekt logisch untergeordnet. Der Interpretantenaspekt – das Bedeutungsmoment – bezieht sich auch auf die Frage nach dem Wahrheitskonzept der Peirce’schen Zeichentheorie. Peirce geht grundsätzlich davon aus, dass man mit den zeichenförmig ermittelten Begriffen wahre Aussagen erzielen kann. Seine relationenlogisch strukturierte Zeichenlehre ist Epistemologie. Sie ist – wie schon erwähnt – teleologisch aufzufassen. Im triadischen Zeichenmodell von Peirce werden Objekt, Zeichen und Bedeutung vereinigt. Sie bringen in ihrer Gesamtheit eine „Darstellungsperspektive“1 als Ergebnis der Semiose zur Geltung. Es muss aber auch gesagt werden: Innovative Bedeutungsbildungen, die sich vom Kontext lösen, aber notwendigerweise in gewisser semantischer Abhängigkeit dazu stehen müssen, um dechiffrierbar zu bleiben, bilden das überschießende Potential des unmittelbaren Interpretanten.2 Sie führen zum Begriffs- und Bedeutungsfortschritt, das heißt zum Zuwachs an Erkenntnis und Wissen.
Der Peirce‘ sche Zeichenbegriff ist linear-teleologisch orientiert.3 Hypothetisch anzunehmen ist dann zusätzlich ein finaler Interpretant, der ein Objekt im Ganzen erschließt. Diesem Gedanken zugrunde liegt der „Grenzwert“ als mathematische Deutung der theoretisch beschreibbaren Unendlichkeit. Negativ formuliert heißt das, dass Nichterkennbares auch nicht existent ist.4 Die Leistung des vollständigen Erfassens eines unabhängigen Gegenstandes schreibt Peirce der unbegrenzten Forschergemeinschaft zu.5 Zwar ist jedes menschliche Erkenntnisurteil der Fehlbarkeit (Fallibilität) unterworfen, wovon Peirce selbstverständlich auch ausgeht, es findet jedoch in der Ausrichtung auf das Telos endgültiger Wahrheitserkenntnis, die in der Eigenschaft des Objektes liegt, sich selbst mitzuteilen, eine korrigierende und leitende Größe. Die These der Finalität – sozusagen die Annahme der „unendlichen Endlichkeit der Erkenntnis“ – scheint dem Punkt der Rekursivität oder Kontinuität – also der „endlichen Unendlichkeit6 der Erkenntnis“ – zu widersprechen. Dies ist jedoch nur auf den ersten Blick so. Die Peirce’ sche Philosophie steht unter folgender Prämisse: Wissenschaftliches Denken und damit menschliches Denken müssen zweckgebunden interpretiert werden, wenn die Erkenntnis eines unabhängigen, realen Objektes prinzipiell möglich sein soll. Für Peirce ist es – wie gesehen – eine unannehmbare Vorstellung, dass es einen Gegenstand geben könnte, der nicht erkennbar sein soll. Hingegen erfasst der Vorgang der Bedeutungserschließung im Zeichen die „Bedeutung“ des Objektes – und das heißt nichts anderes als seine Wesenseigenschaft –, die im Zeichenprozess buchstäblich intellektuell „nach-vollzogen“ (die nachträgliche Bedeutungszuschreibung) wird. Mit der Vorgabe prinzipieller Erkennbarkeit des Objektes – der Korrespondenztheorie – steht und fällt die Erkenntnislehre, wie sie Peirce versteht, nämlich als nicht-metaphysische, semiotisch-logische Konzeption. Der Gedanke des infiniten Regresses bildet daher die Voraussetzung für das Ergebnis – den Zielpunkt – der Finalursachen oder der Finalität. Die Rekursivität leistet die sukzessive Annäherung an den unabhängigen Gegenstand in der Wirklichkeit. Sie setzt die Evolution des Denkens frei. Das Konzept des unendlichen Zeichenereignisses benötigt daher zusätzlich eine Richtung, damit diese kognitive Näherung an das Objekt gelingen kann. Wissen und Sinn werden dadurch erzeugt. Die Aspekte „Rekursivität“ bzw. „Kontinuität“ einerseits und „Finalität“ andererseits stehen somit in Komplementarität zueinander. Das eine ohne das andere wäre im Gegenteil gerade ein Widerspruch bei Peirce. Auf diese Finalität richte sich – so Peirce – das wissenschaftliche Streben des Menschen. Vorausgesetzt wird dabei, dass Wissenschaft zum einen zweckgebunden interpretiert wird, und zum anderen das zweckgerichtete menschliche Denken mit diesem letzten Zweck übereinstimmt. Diese Prämissen wiederum gründen sich in der Annahme prinzipieller Erkennbarkeit von Gegenständen. Konkret gesagt heißt das, dass zwischen Forschungsgegenstand und Forschungserkenntnis ein Verhältnis der Komplementarität im Sinne der Korrespondenz besteht. Der Zweck von wissenschaftlicher Betätigung besteht im zukünftigen Erwerb von (Wahrheits-) Erkenntnis. Auf diese Weise könne – so Peirce – auch eine „letzte Meinung“ („final opinion“)7 erzielt werden8, die ein Objekt im Ganzen beschreibt. Die Rationalität des erkennenden Subjektes und die Realität des zu erkennenden Objektes konvergieren in diesem utopisch gedachten Punkt. Wissenschaft als teleologisch bestimmte – das heißt methodisch geleitete – Form des Erkenntnisgewinns läuft auf dieses futurisch-utopische Ereignis zu.9 Dieser Erkenntnisfortschritt geschieht in der steten Bewegung der Näherung an diesen durch den letzten Zweck der vollkommenen Objektbestimmung geregelten Punkt (Approximationstheorie). In der „letzten Meinung“ wird dieses „End-Ziel“ (vgl. τέλος) der Herstellung eines verbindlichen Konsenses erreicht (Konsensustheorie). Man kann also sagen, dass Korrespondenz- und Konsensustheorie im Finalitätsaspekt als mathematisch-theoretischem Grenzwert in eins fallen. Die Korrespondenztheorie bildet die Voraussetzung der Approximationsvorstellung, die in der Konsensustheorie – der Vorstellung von der „final opinion“ – gipfelt.10
Ausgangs- und Endpunkt der Semiose ist das dem menschlichen Denken im Allgemeinen und dem wissenschaftlichen Forschen im Besonderen vorausgehende reale Objekt. Somit schließt sich der triadisch-semiotische Erkenntnisweg: Er führt vom Objekt weg und zugleich zum Objekt hin. Dargestellt wird das im semiotischen Prozess, der die Erkenntnissuche und den Erkenntnisgewinn formal-logisch in der in einer Relation stehenden Kategorientrias von Objekt, Zeichen (Repräsentamen) und Interpretant abbildet („semiotisches Dreieck“). Epistemologie ist Logik, und Logik wiederum ist Semiotik.11