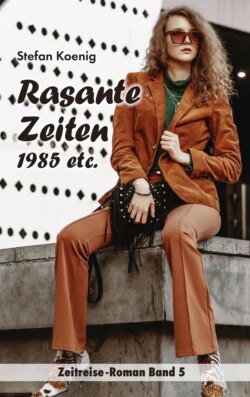Читать книгу Rasante Zeiten - 1985 etc. - Stefan Koenig - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Über sieben Brücken …
ОглавлениеEmma hatte eine Platte aufgelegt. Wir tranken einen Weißwein zum Abendbrot und im Hintergrund sang Peter Maffay »Über sieben Brücken musst du gehn«.
Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick,manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück.Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh,manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu.
„Das ist doch der Maffay, nicht unsere Karat-Band!“, rief Tamara mit unterschwelliger Empörung.
Emma lächelte und sagte: „Der Maffay kupfert gerne ab. Immerhin aber nur die besten Songs.“
„Reg‘ dich nicht auf“, wendete ich mich schmunzelnd an Tammi. „Wir wissen ja, dass der Superhit in der DDR und nicht im Westen das Licht der Welt erblickte. Aber er hat halt alle Grenzen überwunden. Zeugt doch vom Weltniveau sozialistischer Musikproduktion!“
„Mach‘ dich nur lustig!“ Tamara nahm es heiter, stupste mich an und grinste. Dann erzählte sie uns, wie der Song von Herbert Dreilich, dem Sänger der DDR-Rockgruppe Karat, innerhalb von nur zwei Stunden in einem mickrigen Übertragungswagen aufgenommen worden war. Vorher hatte er zwei Wochen lang über dem Text gebrütet, aber keine Melodie wollte ihm einfallen. Und dann, am Morgen im Übertragungswagen, ging es wie durch eine höhere Eingebung ruckzuck. Dass der Song später zu einem Welthit werden sollte, hatte 1978 noch keiner geahnt.
„Als der Song ein Jahr später im Abspann des gleichnamigen Films verklang, klingelten im Fernsehstudio der DDR schon die Telefone Sturm“, sagte Tamara.
„Arbeitet dein Vater immer noch bei der DEFA in Babelsberg?“
„Ich glaube, da bleibt er noch bis zum Umfallen. Filmen, Kameraführung, das ist sein Ein und Alles. Jedenfalls hat er erzählt, dass nach der Erstaufführung des Films eine Anfragewelle über sie hereinbrach. Ob Ost- oder Westbürger, jeder wollte wissen, wo man den Titel kaufen könne.“
Wir prosteten uns zu und hörten die musikalische Interpretation von Maffay.
Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß,manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß.Manchmal bin ich schon am Morgen müd,und dann such ich Trost in einem Lied.
Über sieben Brücken musst du gehn,sieben dunkle Jahre überstehn,siebenmal wirst du die Asche sein,aber einmal auch der helle Schein.
Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehn,manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehn.Manchmal ist man wie von Fernweh krank,manchmal sitzt man still auf einer Bank.
Manchmal greift man nach der ganzen Welt,manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt.Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt,manchmal hasst man das, was man doch liebt.
Während wir zuhörten und aßen, ging mir allerlei durch den Kopf. War der Song ein Abgesang auf die DDR, aus der man über sieben Brücken flüchten konnte? Ging es also um die Überwindung der Mauer? Oder war es nur eine Reflexion über unsere allgemeinen menschlichen Hoch-und-Tief-Gefühle, die uns manchmal überkamen?
Meiner jungen Familie und mir ging es im Moment gut, sehr gut sogar. Aber wie würde es uns in Zukunft gehen? Musste ich nicht auch schon bald nach neuen Wegen, nach Brücken suchen, um berufliches Neuland zu betreten, damit ich meine vierköpfige Familie mit einem sicheren Beruf ernähren konnte?
In den vergangenen Wochen hatte ich immer wieder daran denken müssen, dass mein Zeitvertrag an der Uni schon in sechzehn Monaten, im Mai 1986, auslaufen würde. Was dann? Ein gewisses, sogar ein sehr gewisses Krisengefühl konnte ich vor mir selbst nicht mehr länger verleugnen. Vor Emma schon.
„Glaubst du, dass der Karat-Song mit der Reisebeschränkung zu tun hat? Und zurück zu meinen Fragen: Wäre es vernünftiger, die Grenze wäre durchlässiger? Wären die DDR-Bürger dann vielleicht zufriedener und der Sozialismus »freier«?“
„Mensch, du kannst aber auch Fragen stellen!“ Tamara schnickte ihren Pferdeschwanz zur Seite. „Weißt du, mit dem Lied kann vieles gemeint sein. Aber eines ist sicher – die Karat-Band steht zur DDR. Ob alle Bürger zu ihrem Staat stehen, das allerdings kann man bezweifeln.“
„Die Gründung der beiden deutschen Staaten geschah durch einen Akt der Besatzer“, sagte ich. „Die Meinung des Volkes spielte damals wohl keine allzu große Rolle.“
„Was ich im Geschichtsunterricht gelernt habe, ist, dass nach dem Krieg Volksbefragungen stattfanden und sich große Mehrheiten für die Enteignung der Kriegsverbrecher und für neue demokratische Mitbestimmungsrechte fanden, jedenfalls bei uns im Osten war das so. Oder wie siehst du das?“, fragte mich Tamara.
„Es gab im Osten wie im Westen keine Mehrheit, die gegen den Faschismus gekämpft hatte. Und es gab keine Mehrheit, die den Sozialismus auf die Tagesordnung gesetzt hatte“, antwortete ich.
„Die antifaschistische Gesellschaftsordnung stand aber als Vorstufe des Sozialismus auf der historischen Tagesordnung“, erwiderte Tammi.
„Ja, ja, ich weiß, zum Gründungsmythos der DDR gehörte, dass der Faschismus allein ein Problem in der BRD sei, womit man die Auseinandersetzung um eine postfaschistische Gegenwart in der damals jungen DDR leugnete – und dabei genauso zum Verschweigen verdammt war, wie hier, im nur zum Schein entnazifizierten Westdeutschland. Die SED tat dabei so, als wäre der DDR-Zustand bereits der verwirklichte Sozialismus. Und du wie ich tun so, als würden wir es glauben.“
Emma war mit dem Thema nicht ganz so vertraut wie ich, hatte aber während ihrer Schwangerschaft das Buch »Wie wir wurden. Was wir sind« von Bernt Engelmann mit größtem Interesse gelesen. „Die DDR ist eben nicht »sozialistisch« geworden, weil die Menschen dort anders waren, sondern weil der Faschismus militärisch besiegt wurde“, meinte sie. „Die Menschen in der jungen DDR waren so nationalistisch, so faschistisch geprägt wie die im Westen. Sie sind also nicht über Nacht zu Sozialisten geworden. Sie haben es hingenommen.“
„Da ist etwas dran“, antwortete Tamara. „Es war ein langer, langsamer Überzeugungsprozess.“
„Der Sozialismus musste also von »oben« dekretiert werden. Ebenso konnte er nur von oben »verteidigt« werden – gegen eine Mehrheit, die damals zu keinem Zeitpunkt für einen Sozialismus, welcher Art auch immer, gekämpft hatte.“ Ich ahnte, dass es Tamara schwer fiel, hierzu etwas zu sagen. Zu sehr war sie in ihrer postfaschistischen Sozialisation befangen. Sie hatte ja ebenso wie Emma und ich keinerlei Gemeinsamkeit mehr mit der Generation der alten braunen Säcke.
„Wir haben in der DDR halt einen »realen Sozialismus«, was so viel heißen soll: Man kann in der Gegenwart nur das an Zielen erreichen, was realistischer Weise materiell und vom Bewusstsein der Massen her machbar ist“, sagte Tamara. „Immerhin gibt es in unserem System genug Arbeit für jeden. Obdachlosigkeit, Drogenkonsum und Kriminalität sind auf unterstem Level. Unser Gesundheitssystem ist hervorragend und steht jedem offen; unser Wissenschafts- und Bildungssystem, unser Breitensport und die Friedenspolitik unserer Regierung stehen im Systemvergleich weit vorn.“
„In der entscheidenden Mikrochip-Forschung hinkt die DDR nach“, bemerkte ich etwas beiläufig, um dann auf Tamaras Arbeit zu sprechen zu kommen und wiederholte meine Frage: „Nun sag‘ doch mal – bist du jetzt hauptberufliche Funktionärin?“
„Nein, ich gebe doch meinen sicheren Beruf in der Maschinenbaubranche nicht für einen politischen Job auf. Aber für unsere Gewerkschaftssektion bin ich schon sehr aktiv. Bin mal gespannt, was ich hier über die DGB-Aktivitäten erfahre. Ein Erfahrungsaustausch ist immer gut, um Brücken zu schlagen.“
„Genau“, sagte Emma, „da wären wir wieder beim Karat-Song: »Über sieben Brücken musst du gehn, sieben dunkle Jahre überstehn, siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein«. Hoffen wir mal, dass unsere westdeutschen Gewerkschaften ihre dunklen resignativen Zeiten hinter sich haben und eurer Delegation einen etwas helleren Schein mit auf den Weg geben können.“
„Oder umgekehrt“, sagte Tamara lachend.
Emma ging mit ihr hoch in die Mansarde, um ihr die Schlafstube und das klitzekleine Bad zu zeigen. Oben flüsterte sie ihr zu: „Hier drunter wohnt unsere neugierige Tante Ria. Sie ist schon achtundsiebzig, sieht und riecht und hört aber noch alles. Manchmal hört sie sogar die Flöhe husten. Wenn du ihr morgen Früh zufällig begegnen solltest und sie dich verwundert fragt, wer du bist, dann sag einfach, dass du unsere gute Freundin aus Berlin bist. Mehr muss sie nicht wissen.“
Tammi lächelte wissend. „So Leute gibt’s in jeder Gesellschaft“, flüsterte sie zurück.
Als ich neben Emma einschlief, gingen mir der sichere Arbeitsplatz von Tammi und mein unsicherer Uni-Job durch den Kopf. Meine leisen Existenzängste waren in der Stille der Nacht ernsthaft spürbar. Es gab keinerlei Chance, meinen Zeitvertrag an der Uni zu verlängern.
Nichts, absolut gar nichts stand perspektivisch in Aussicht. Ich hatte auch keine Idee – außer wieder ins Journalistengeschäft einzusteigen, diesmal vielleicht in den »großen Journalismus« der Massenpresse. Wollte ich aber wirklich dort landen? In einer Branche voller Ungewissheiten, voller geheuchelter Liebedienerei, einem Handwerk mit beschränkter Haftung, dafür mit beschränkter Berichtsfreiheit und mit äußerst beschränktem Einkommen? Freier Journalist in der freien Wildbahn der Konzernpresse?
Ich schlief ein, aber schon nach drei Stunden wurde ich wieder wach, und die bedrückende Frage rotierte in meinem Schädel: Wie konnte es bei mir nur weitergehen? Sollte ich es demnächst mit Emma besprechen?
Ich drehte mich von einer Seite auf die andere, bis ich endlich wieder eingeschlafen war. Am Morgen war ich mir ganz sicher: Ich wollte es nicht mit Emma besprechen, wollte meine Sorgen nicht auf ihr abladen, obwohl es ja hieß, geteiltes Leid sei halbes Leid. Aber noch war das Leid ja nicht so groß, noch lagen achtzehn einkommenssichere Monate vor mir. Ich musste kreativ sein und musste bald schon handeln. Könnte ich nur in die Glaskugel gucken!
Weihnachten holten wir die Christkugeln raus. Wir schmückten die Wohnung festlich und stellten die von Opa Otto ausgesägten und bemalten zwanzig bis dreißig Zentimeter hohen Holzfiguren auf die Fensterbänke – Märchenfiguren wie die Sieben Zwerge und Schneewittchen, Rotkäppchen und der Wolf, dazu drei Tannenbäume. Zwei typische Weihnachtsmänner mit Rauschebart und Rute und den Geschenksäcken auf dem Buckel durften nicht fehlen. Diese von Otto bunt bemalten Holzfiguren hatten mich schon in meiner Kindheit und Jugend zum Weihnachtsfest erfreut.
Es war das erste Weihnachten zu Viert – im weiteren Verlauf natürlich mit Oma und Opa, mit meinem Bruder Günter samt seiner Kleinfamilie, die am zweiten Feiertag zu Besuch kamen. Meine Schwester Ursula und ihre Familie blieben aus fadenscheinigen Gründen fern. Sie kamen irgendwann nach Weihnachten, als Emma und ich nicht zu Hause waren. Schwager Claus war immer noch ein Stänkerer, aber immerhin hatte er nun seine Bestätigung als Ortsbeirat in der CDU gefunden. So verblasste seine NPD-Vergangenheit immer mehr, und er wurde trotz seiner persönlichen Macken offensichtlich immer besser in das integriert, was sich normale Gesellschaft nannte.
Zum Jahreswechsel fanden die USA allerlei Vorwände, um aus der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auszutreten. Schon ein Jahr zuvor hatten sie ihre Zahlungen eingestellt, weil ihnen einfach die humanitäre Ausrichtung der UNESCO-Politik nicht in den Kram passte. Dass diese erpresserische machtpolitische Einstellung zur Gewohnheit werden würde, dachte man damals noch nicht.
Im Radio lief ein Rückblick, und die Toten des öffentlichen Lebens wurden aufgezählt. Der britische Blues-Musiker Alexis Korner war schon Anfang des Jahres gestorben. Er war sechsundfünfzig Jahre alt geworden. In seiner Band »Blues Incorporated« hatten britische musikalische Stars wie Mick Jagger, Ginger Baker, Dick Heckstall-Smith, Charlie Watts, Cyril Davis, Jack Bruce, Brian Jones und Duffy Power gespielt.
Ich erinnerte mich an den »Summer of Love«, an unser deutsches Woodstock auf Fehmarn im Jahr 1970. Da hatte uns Alexis Korner als Moderator in Deutsch und Englisch durch das verregnete Konzert-Programm geführt. Wie sich herausstellte, sollte Alexis während des Festivals weit mehr als nur ein Ansager sein. Immer wieder musste er, um lange Pausen zu überbrücken, einige Lieder auf seiner Gitarre zum Besten geben, musste die Zuschauer vertrösten. Doch trotz aller Pannen war es ihm irgendwie gelungen, »good vibrations« zu verbreiten.
Lange war es her. Eineinhalb Jahrzehnte waren vergangen. Jugend ade.
Jetzt war Alexis Korner tot. Es führte einem die Vergänglichkeit vor Augen. Ein Kommen und Gehen auf dieser Welt.
Karola und Luca schliefen in der Silvesternacht tief und fest. Emma, Lollo, Otto und ich tranken vorab schon einen Mumm und schalteten langsam aber sicher in den Jahres-Abschiedsmodus. Mein Vater zündete ein kleines Tischfeuerwerk.
Im Radio hörten wir zufällig auf einem nebulösen Sender nebulöse astrologische Voraussagen für 1985. Der amerikanische Präsident würde ermordet; Erich Honecker würde gestürzt; Helmut Kohl würde sich scheiden lassen; ein Sonnensturm würde die Stratosphäre durcheinanderwirbeln und zu nervösen Störungen führen.
„Noch mehr nervöse Störungen?“, fragte meine Mutter, und wir lachten und schworen uns, diesmal alle Voraussagen zu notieren, um sie Ende des kommenden Jahres auf ihre Trefferquote zu überprüfen. Dann schalteten wir auf den allerletzten Drücker den Fernseher an.
Der ARD-Moderator zählte gerade die Sekunden, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei zwei, eins, und der Zeiger sprang auf null Uhr. Das Orwell-Jahr war zu Ende. Die Mittachtziger begannen.