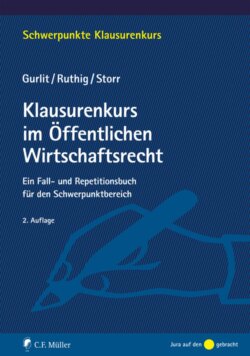Читать книгу Klausurenkurs im Öffentlichen Wirtschaftsrecht - Stefan Storr - Страница 72
На сайте Литреса книга снята с продажи.
bb) Eingriff
Оглавление57
Die Niederlassungsfreiheit verbietet zunächst die Diskriminierung gegenüber den Staatsangehörigen des Bestimmungsstaates. § 7 NRSG gilt aber unterschiedslos für Aus- und Inländer. Eine versteckte Diskriminierung ist anzunehmen, wenn durch eine an sich unterschiedslose Vorschrift faktisch Ausländer stärker betroffen werden, weil die Voraussetzungen der Norm sie stärker belasten[48]. Das Rauchverbot des § 7 NRSG erfasst alle Gewerbetreibenden im Gaststättengewerbe und verlangt EU-Ausländern wie S, die im Inland eine Gaststätte eröffnen, nicht mehr ab, als einem Inländer[49]. Eine Diskriminierung scheidet somit aus. Nach der Dassonville-Formel sind darüber hinaus jedoch alle Maßnahmen gleicher Wirkung verboten. Darunter fallen alle Handelsregelungen eines Mitgliedstaates, die geeignet sind, den zwischenstaatlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern[50]. Indem das Gaststättengewerbe einem Rauchverbot unterliegt und S seine Tätigkeit als Gaststättenbetreiber nicht einfach beliebig gestalten kann, stellt § 7 NRSG folglich eine wirtschaftshemmende Regelung dar, die die durch den AEUV verbürgte Niederlassungsfreiheit einschränkt.
Allerdings hat das BVerwG unter Hinweis auf die Keck-Rechtsprechung bereits einen Eingriff in den Schutzbereich verneint. Mit dieser Rechtsprechung hat sich der EuGH, zunächst bei der Warenverkehrsfreiheit, angesichts seines weiten Eingriffsbegriffes um eine Begrenzung des Schutzbereiches bemüht. Danach fallen „bestimmte Verkaufsmodalitäten“ dann nicht in den Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit, wenn sie für alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer gelten, die ihre Tätigkeit im Inland ausüben und außerdem den Absatz in- und ausländischer Waren in rechtlich wie tatsächlich gleicher Weise berühren[51]. Obschon dies der EuGH nur für die Dienstleistungsfreiheit ausdrücklich entschieden hat[52], dürfte sich der Grundsatz auch auf die anderen Grundfreiheiten anwenden lassen, soweit es sich um nichtdiskriminierende und marktverhaltensbezogene Vorschriften handelt[53]. Andererseits hat der EuGH zur Niederlassungsfreiheit lapidar entschieden, dass alle „nationalen Maßnahmen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantierten grundlegenden Freiheiten behindern oder weniger attraktiv machen“, einer Rechtfertigungspflicht unterliegen[54]. Etwa bei Regelungen über Öffnungszeiten, die unter die Keck-Rechtsprechung fielen, hat er eine Beschränkung mit dem Argument abgelehnt, dass die jeweils geltend gemachten Behinderungen zu ungewiss und rein hypothetischer Natur seien. Dogmatisch sind diese Ausführungen allerdings nicht ausgereift: „Dieser Ansatz weist aber einen letztlich rein tatsächlichen Charakter auf, ist dogmatisch kaum konturiert und trägt damit insbesondere nichts zur Frage bei, ob und inwieweit die Grundfreiheiten tatsächlich darauf begrenzt sind, spezifische Behinderungen des grenzüberschreitenden Wirtschaftens in Frage zu stellen“[55]. Schwieriger zu bewerten ist die Frage, was bei der Niederlassungsfreiheit als Äquivalent zu den „Verkaufsmodalitäten“ anzusehen ist. Zu diesen gehören anerkanntermaßen Verkaufsbeschränkungen, etwa die Apothekenpflichtigkeit bestimmter Arzneimittel[56]. Mit einem solchen könnte man das Rauchverbot vergleichen. Wie ein Verkaufsverbot, das für sämtliche Waren (aus dem In- und Ausland) gilt, betrifft es alle Dienstleistungsanbieter gleichermaßen, erschwert also nicht den Zugang gerade von Ausländern. Andererseits könnte man dies gerade bei der Konzeptgastronomie auch anders sehen, wird es doch dem S durch die Vorschrift unmöglich gemacht, sich mit seinem (im Ausland erfolgreichen) konkreten Konzept auf dem deutschen Markt zu etablieren, so dass sich das Rauchverbot jedenfalls wie eine produktbezogene Vorschrift auswirkt. Dies spricht eher gegen eine Anwendung der Keck-Grundsätze.