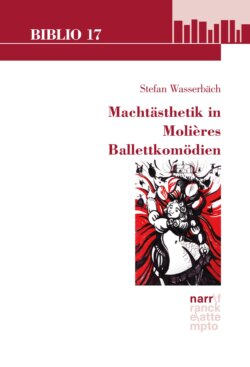Читать книгу Machtästhetik in Molières Ballettkomödien - Stefan Wasserbäch - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеDie Blütezeit der Ballettkomödie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Frankreich erklärt sich durch die kulturelle und politische Funktion, die diesem Unterhaltungsmedium zuteilwird. Die Ballettkomödie entspricht dem Wunsch der Zeit nach einem Universaltheater, das heißt nach einer Theatergattung, die sowohl tänzerische als auch musikalische Elemente in den Rahmen einer Komödie integriert und alle drei Kunstarten zu einem Gesamtkunstwerk vereinheitlicht: „Comme nous sommes dans un siécle“, so Donneau de Vizé, „où la Musique & les Balets ont des charmes pour tout le monde, & que les spectacles qui en sont remplis sont beaucoup plus suivis que les autres“1. Diesem Verlangen kommt Molière mit seinen Ballettkomödien nach, die einen Großteil (ca. 40 Prozent) am Gesamtwerk des Dramatikers ausmachen.2 Das Innovative an diesem hybriden Genre ist, dass Molière gewillt ist „de ne faire qu’une seule chose du Ballet, et de la Comédie“ (LF3, 150), wie er im Vorwort zu Les Fâcheux, seiner ersten comédie-ballet, programmatisch erläutert. Er verwirklicht damit das antike Ideal der Künstefusion in seinem klassischen Gesamtkunstwerk. Es ist letztlich der multimediale Charakter, der maßgeblich zur Lebhaftigkeit der Ballettkomödie beiträgt und für einen hohen Unterhaltungswert am königlichen Hof sorgt.
Ferner ist im Zuge der Etablierung des absolutistischen Staates eine zunehmende Monopolisierung der Kultur zu konstatieren, infolgedessen den eingesetzten Künsten eine unmissverständliche politische Funktion zugesprochen wird. Vor dem Hintergrund dieser, bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts von Kardinal Richelieu etablierten Kulturpolitik repräsentiert die Geschlossenheit der Ballettkomödie die absolutistische Herrschaftsform und verhilft ihr zu einem national-einheitlichen Kulturbild Frankreichs. Molières Ballettkomödien sind nunmehr Teil der absolutistischen Machtostentation und tragen zur Kulturpolitik Ludwigs XIV. bei. Die Korrelation von Staatsführung und Kunst soll als Leitgedanke der vorliegenden Studie dienen und unter dem Begriff der ‚Machtästhetik‘ zusammengefasst werden. Dieses duale Konzept subsumiert die machtverklärenden wie auch ästhetischen Ansprüche der Ballettkomödie; es ermöglicht eine interdisziplinär ausgerichtete, dem Untersuchungsgegenstand angemessene Betrachtung mithilfe literatur-, theater- wie auch kulturwissenschaftlicher Methoden: Die Studie beleuchtet im Kontext absolutistischer Kulturpolitik eingehend die politischen Machtdiskurse und gesellschaftlichen Machtstrukturen sowie deren artistische Repräsentation und Funktion in Molières Ballettkomödien. Sie ist gewillt, ein neues Verständnis von Molières Kunst unter der Prämisse eines aktiven Beitrags zum System der absolutistischen Repräsentation Ludwigs XIV. – einer Ästhetisierung der Macht – aufzuzeigen. Obschon des Öfteren in der traditionsreichen Molière-Forschung versucht wurde, die klassische Gesellschaft mithilfe von Molières Komödien zu rekonstruieren, wurde lediglich bei gelungenen Interpretationen der Hintergrund der klassischen Kultur respektive Politik miteinbezogen. Jedoch wurde bislang eine soziokulturelle Lesart speziell der Ballettkomödie, ihre genrebedingte Performance wie auch ihr politisches Wirkungsspektrum im Sinne einer auf dem Phänomen der Komik sich konstituierenden Machtästhetik nicht ins Zentrum der Analysen gerückt. Diese Desiderate sollen mit vorliegender Studie erschlossen werden.
Molières hybrides Genre fordert seit jeher – und bis heute – Philologen heraus, wenn es darum geht, dieses zu definieren beziehungsweise eine Gattungspoetik für dieses zu verfassen. Der Grund hierfür ist im Mangel einer Poetik zu finden; es existiert kein von Molière geschaffenes literaturtheoretisches Regelwerk, sodass sich die Poetik der Ballettkomödie aus der Gesamtheit aller aus dem Dramentext selbst und aus dessen Paratexten erschließbaren Spezifika herleiten muss. In der aktuellen Ausgabe des Dictionnaire de l’Académie Française von 2005 erscheint die comédie-ballet als Untereintrag zu comédie mit einer ungenauen Definition und einem falschen Beispiel: „Comédie-ballet, comédie entremêlée de danses. Psyché est une comédie-ballet.“4 Die Ballettkomödie ist weit mehr als eine Komödie mit Tanzeinlagen und Psyché ist eine tragédie-ballet. Diese stiefmütterliche Betrachtung der Ballettkomödie schlägt sich auch in der Tatsache nieder, dass erst in jüngster Zeit5 die umfangreichen Texte der Tanz- und Musikeinlagen in den Molière-Editionen erscheinen. Trotz einiger Schriften zur Gattung der Ballettkomödie – hierzu zählen insbesondere diverse Publikationen von Maurice Pellison6, Charles Mazouer7 und Stephen H. Fleck8 – liegt eine umfassende Gattungspoetik bis heute nicht vor. Hinsichtlich dieses Desideratums schickt sich die vorliegende Studie an, eine Gattungspoetik der molièreschen Ballettkomödie zum ersten Mal in umfassender Weise zu erstellen, mit dem Ziel einer Präzisierung der Definition wie auch einer Verortung des Genres in der aktuellen Gattungslandschaft. Dabei wird ein Hauptaugenmerk auf der Verzahnung der diversen Kunstsprachen liegen, die in ihrem Zusammenwirken zu einem facettenreichen Darstellungsrepertoire führen und eine neue Theatersprache im klassischen Theater herausbilden. Zudem interessiert in diesem Kontext die Intermedialität, der Homogenisierungsprozess von Komödie und Intermedium, die Dramatisierung und Theatralisierung von Musik- und Tanzeinlagen.
Nach Bestimmung des Forschungsgegenstandes wird zu klären sein, was die Machtästhetik konstituiert und wie sie sich auszeichnet. Hinsichtlich des eben Erwähnten spielt das der Komödie inhärente komische Moment eine Schlüsselrolle, wenn ich davon ausgehe, dass Komik als eine Schnittstelle zwischen Macht und Ästhetik fungiert. Ein fundamentaler Gedanke zu dieser These, der die Komikforschung von der Antike bis in die Neuzeit trotz sämtlicher Differenziertheit der Ansätze leitmotivartig durchdringt, lässt sich als ‚Theorie einer Normabweichung, des Fehlerhaften‘ im Sinne von etwas in verschiedengestaltiger Art und Weise ‚Atypischem‘ resümieren.9 Sonach ist das Komische Ausdruck einer Normabweichung, die sich in den Ballettkomödien im nichtkonformen Betragen einiger Figuren manifestiert. Diese opponieren mit den gültigen bienséance-Vorstellungen des Hofes und liefern sich untereinander wie auch mit den Vertretern der sozialen Schicklichkeit komische Agone. In einem der Gattungstypologie Rechnung tragenden Strukturmodell, bei dem die Assoziation von Sprache, Gesang und Tanz als Grundlage dient, werden die agonalen Strukturen hinsichtlich der Dramen- respektive Sujetstruktur aufgezeigt und das Möglichkeitsspektrum des komischen Agons festgelegt. Zudem soll das Wesen der klassischen Komik anhand dieses theoretischen Konzepts bestimmt und die lebensweltliche Reaktion des Lachens im funktionsgeschichtlichen Kontext von la cour et la ville eruiert werden. Diese strukturalistische Herangehensweise wird sodann mit einer anthropologischen Perspektivierung vertieft und komplettiert. Hierzu bedarf es einer detaillierten Analyse der komischen Helden mittels der Ideen zeitgenössischer französischer Moralisten, da ich davon ausgehe, dass der entfesselte amour-propre dieser Protagonisten als Urheber der konfliktreichen Intrigen bestimmt werden kann, ergo das zentrale komische Moment generiert, das sich in Form einer Normdivergenz in der Handlungswelt manifestiert. Das Etappenziel dieser Studie ist schließlich die Bestimmung der Komik in den Ballettkomödien anhand sozialanthropologischer Hintergründe und deren Verquickung mit der generischen Struktur der Ballettkomödie. Diese Ausführungen fügen sich unter nachstehender Prämisse in den Leitgedanken der Studie ein: Wenn die comédie-ballet für ideologische Zwecke eingesetzt wurde, dann müssen im Dramentext gewisse Strukturen insbesondere in der Konstitution der Komik – dem zentralen Phänomen dieser Ballettkomödien – auffindbar sein, welche die Instrumentalisierung der Ballettkomödien zur Machtostentation und -konsolidierung sicherstellen.
Auf diesen gewonnenen Erkenntnissen aufbauend wird eine gattungsspezifische Komikästhetik anhand des Dualismus von Ästhetik und Ethos unter Berücksichtigung artistisch-performativer, satirischer als auch anthropologischer Aspekte herausgearbeitet, womit die Überlegungen zur Machtästhetik fortgesetzt werden. Funktion und Wirkungsweise der Komik werden unter der Hypothese betrachtet, dass Molières Komik ein ästhetisches Konstrukt klassischer Ganzheit im Spannungsverhältnis von niederer und hoher Kunst widerspiegelt, von reinem Divertissement und tiefsinniger Belehrung – wie die divergenten Haltungen in der Molière-Forschung immer wieder erkennen lassen.
Zum Schluss der Studie werden die Überlegungen zur Komikästhetik in den Ballettkomödien fortgeführt, indem sie in den Kontext absolutistischer Kulturpolitik gesetzt werden. Die Ausführungen orientieren sich hierbei an Michel Foucaults Analytik der Macht10 wie auch an den Forschungsarbeiten zu den absolutistischen Repräsentationstechniken von Jean-Marie Apostolidès11, Peter Burke12 und Louis Marin13 und eruieren die machtpolitische Bedeutung im gattungspoetologischen Spektrum der Ballettkomödien. Diese Abschlussbetrachtung liefert letztlich ein Verständnis zur Machtästhetik in den Ballettkomödien.