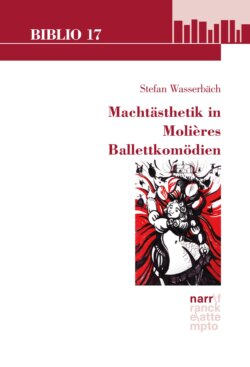Читать книгу Machtästhetik in Molières Ballettkomödien - Stefan Wasserbäch - Страница 9
1.2 Antike und frühneuzeitliche Quellen der Gattung
ОглавлениеDie historische Fragestellung darf bei einer Gattungspoetik nicht fehlen, denn sie eruiert die kulturellen Wurzeln und gattungshistorischen Traditionen, die unter dem Gesichtspunkt einer Gattungsfusion1 entscheidend für den Stellenwert der Innovation sind: Die Ballettkomödie stellt im Zeitalter der Querelle des Anciens et des Modernes die aristotelische Mimesis im Sinne einer auf Imitation basierenden Dichtkunst infrage, wenn sie mit einer selbstbewussten aemulatio antwortet. Die Neuartigkeit der Gattung für das französische Theater der Klassik betont Molière im Avertissement von 1661 explizit. Zugleich schränkt er seine Entdeckung ein, wenn er sich im Konjunktiv vage auf mögliche antike Autoritäten beruft: „[C]’est un mélange qui est nouveau pour nos Théâtres, et dont on pourrait chercher quelques autorités dans l’Antiquité […].“ (LF, 150) Charles Mazouer sieht in den fehlenden Angaben etwaiger antiker Autoritäten eine Witzelei Molières. Für ihn handelt es sich um den Spott eines Autors, der selbstbewusst der Regelbesessenheit der gelehrten Pedanten trotzt: „Ce genre tout moderne, apparu dans un contexte bien particulier et bien daté, n’a pas de référence dans l’Antiquité.“2 Wenn Molière tatsächlich eine Witzelei im Sinn gehabt hätte, so ist Mazouer darin zuzustimmen, dass diese auf die Pedanterie der Regelvertreter abzielen wollte. Jedoch schließt das Vorwortzitat mögliche Vorformen der Ballettkomödie nicht aus. Dass Molière selbstsicher die Innovation seines geschaffenen Genres nach außen tragen kann und nicht explizit auf antike Autoritäten zurückgreifen muss, um jenes als ‚neu‘ zu rechtfertigen, liegt unter anderem daran, dass bei aller Neuheit gewisse ästhetische, poetologische und gattungstypologische Regeln der gängigen doctrine classique im weitesten Sinne nicht verletzt werden.3 Ferner bekräftigt er stets die vernünftige Seite seiner Komödien, wie beispielsweise im Premier Placet au Roi von Le Tartuffe: „Le Devoir de la Comédie étant de corriger les Hommes, en les divertissant.“ (LT, 191)
Doch wo liegen die antiken Wurzeln, die Molière in konjunktivischer Form andeutet? In welche literaturgeschichtliche Gattungstradition ließe sich die Ballettkomödie einordnen? Antworten auf diese Fragen findet man zunächst im Ursprung der Komödie, bei den Feierlichkeiten um den Dionysos-Kult in der Stadt Megara im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus.4 Der Gott des Weines und der Fruchtbarkeit wurde in den nach ihm benannten Dionysien mehrere Tage lang mit burlesken Prozessionen gefeiert, die mitunter Phallusdarstellungen, tanzende und singende Chöre, Satire- und Sketchspiele enthielten. Die Etymologie des griechischen Wortes κωμῳδία (kômôidia) bestätigt diesen Ursprung: Die kômôidoi sind ursprünglich die „Sänger des kômos“, das heißt der dionysischen Prozession, jene, die einen Text – Vorläufer des Komödientextes – interpretierten und improvisierten.5 Man erkennt in dieser vorliterarischen Form Elemente, die an die Ballettkomödien erinnern: Zu nennen sind Tanz, Musik, Satire, bacchantische Einlagen in den Zwischenspielen, der Improvisationscharakter der Situationskomik, das apotheotische Moment wie auch die kulturelle Funktion eines Festspiels. Letzteres dient am Hof von Ludwig XIV. dessen Repräsentationskultur mit größter Schauwirkung. Diese zunächst noch autonomen Bestandteile der Dionysien bestimmen das Wesen der Ballettkomödie, jedoch in einer in erheblichem Maße verfeinerten und strukturierteren Darstellung.
Die dramatische Struktur wird in der Alten Komödie besonders unter Aristophanes elaboriert und gefestigt.6 Es ist interessant und hinweisgebend für das Verständnis der Intermedientradition zugleich, dass die in der Alten Komödie integrierte Parabase7 bereits die Idee einer Intervention in die Hauptkomödienhandlung erkennen lässt. Die Chorinterventionen sind fester Bestandteil des attischen Theaters mit unterschiedlichen Funktionen: Der Chor ist Betrachter und Kommentator des Geschehens, an welchem er sich zugleich als Akteur beteiligt, indem sein Agieren oftmals eine Art Parallelhandlung zur Haupthandlung darstellt.8 Er interveniert ungleichmäßig in die Handlungsphasen des Dramas, das bis dato noch nicht in Akte unterteilt ist. Im Verlauf der Dramenentwicklung verringert sich seine dramatische und thematische Bedeutung, bis er in der Neuen Komödie auf Zwischenaktmusik reduziert wird.
Zu Beginn der hellenistischen Epoche erschließt sich aus der Alten Komödie eine weitere antike Quelle für die Ballettkomödie, die Neue Komödie von Menander. Sie überzeugt das zeitgenössische Publikum mit ihrem politiklosen Sujet, aber auch mit ihrer Struktur, wodurch sie sich von der Alten Komödie absetzt und eine neue Etappe in der europäischen Komödienentwicklung markiert. Die Neue Komödie charakterisiert sich durch das Verschwinden der Wettkämpfe und der Parabase sowie durch die Reduzierung der Chorinterventionen, die fortan nur noch aus kurzen gesungenen und getanzten Intermezzi zwischen den Akten bestehen und nicht mit der Komödienhandlung verbunden sind.9
Als Ausgangspunkt für das Intermedientheater kann das antike Theater aufgefasst werden. Die molièreschen Intermezzi lassen traditionelle Strukturen des antiken Chors erkennen, da jene ebenfalls eine dramatische und thematische Bedeutung haben und ein Aktionsmoment beinhalten. Dennoch unterscheiden sich die klassischen Intermedien von den antiken Chorinterventionen dahingehend, dass sie keine Reflexionsinstanz im Sinne der Parabase verkörpern und keine die Komödienfiktion sistierenden Interventionen darstellen. Sie bereichern durch Spiegelung, Parodierung, Kontrastierung und Weiterführung die Komödienhandlung. Darüber hinaus stellen sie unter formalem Aspekt eine Aktmarkierung dar. Das verbindende Moment zum antiken Chor muss sonach in einer ästhetischen Verschiebung der dramen- und sujetstrukturellen Relevanz der Intermedien gesucht werden. Molières Einheitsstreben führt insgesamt zu einem Gewinn an neuer dramatischer und thematischer Kontinuität und Konformität,10 womit er sich auch von der Neuen Komödie distanziert. Obschon Menander bereits Musik- und Tanzeinlagen als Bereicherung in seine Neue Komödie aufnimmt, erhebt dieser keineswegs den künstlerischen Anspruch Molières, die Dramen- und Sujetstruktur der Zwischenspiele mit der Komödienstruktur ästhetisch harmonisieren zu wollen. Dies hat zur Folge, dass sich die Ballettkomödie im Hinblick auf ihre Komikästhetik von den beiden antiken Komödientypen unterscheiden wird. Das Aktionspotenzial der Intermedien fließt sonach in die Komödienhandlung mit ein und führt zu einer dynamischen Gesamtdarstellung, die aus Ballett und Komödie synergetisch zusammengefügt ist. Die antiken Maßgeblichkeiten – wie man „autorités“ ebenfalls lesen kann – können aufgrund ihrer hybriden Struktur sowie ihrer inspirierenden Künstefusion für Molière als Referenzpunkt gegolten haben.11
Mit der commedia dell’arte wird die neue Ästhetik des französischen Autors überdies durch eine frühneuzeitliche Quelle inspiriert. Abgesehen davon, dass Molière von Tiberio Fiorelli, dem bekannten Schauspieler dieses auch in Frankreich praktizierten Theaters, einiges über seine später verwendete gestische Ästhetik lernt, interessieren im Zusammenhang mit der binären Struktur der Ballettkomödie vordergründig die lazzi. Die komischen Einlagen, die zum festen Bestandteil dieses Theatertypus gehören, werden immer dann ausgespielt, wenn der improvisierte Spielfluss zu stocken droht und das Hauptspiel neu organisiert werden muss.12 Angesichts des Umstandes, dass den Schauspielern der commedia kein vollständiger Rollentext zur Verfügung steht, sondern nur ein grobes Handlungsschema, ein canavaccio oder scenario, ist die Beherrschung der lazzi ein wichtiges Element des Schauspielerrepertoires. Die Akteure vermögen innerhalb ihrer Typenrolle die komischen Gags situationsbezogen einzusetzen wie auch zu variieren und können damit über Engpässe in der Haupthandlung hinwegtäuschen. Die Schlüsselidee liegt in der situationsbezogenen Integration theatralischer Elemente in den Handlungsverlauf des Hauptspiels, wodurch der Eindruck erweckt werden soll, dass sie tatsächlich dazugehören. Die zunächst unfreiwilligen lazzi erfreuen sich großer Beliebtheit und tragen maßgeblich zur Gattungsspezifik bei. In der commedia dell’arte findet man daher eine weitere Spielart von Handlungsinterventionen, die eher zufällig während der Aufführung entstehen und anders motiviert sind als bei Aristophanes und Menander, denn sie geben nicht Musik- und Tanzeinlagen Priorität, sondern Einlagen schauspielerischen Agierens.
Molière kombiniert die aus der antiken und frühneuzeitlichen Interludientradition der Komödie stammende Trias Musik, Tanz und schauspielerisches Agieren in seinen Interludien. Er verschafft ihnen ein starkes Aktionspotenzial, indem er die Musik- und Tanzeinlagen durch die Einbindung in die Dramen- und Sujetstruktur der Komödie dramatisiert wie auch theatralisiert und über das mimische Moment komisiert.