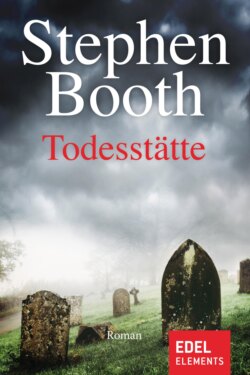Читать книгу Todesstätte - Stephen Booth - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление8
Als Cooper an diesem Abend seine Wohnung betrat, blinkte die Anzeige des Anrufbeantworters, und die Katzen wollten gefüttert werden. Eine der beiden war immer besonders ungeduldig, und so dauerte es ein paar Minuten, bis er den Knopf drückte, um seine Nachrichten abzuspielen. Es waren insgesamt drei.
»Ben, hier ist Matt. Ruf mich zurück.«
Die erste Nachricht war sehr kurz, sorgte bei Cooper jedoch für ein Stirnrunzeln. Sein Bruder rief ihn normalerweise nie an, es sei denn, es war unbedingt nötig. Matt hielt sich strikt daran, ihn nicht auf seinem Mobiltelefon anzurufen, da er wusste, dass Cooper es beruflich nutzte. Er würde ihn wohl zurückrufen müssen, um sich zu erkundigen, was passiert war. Doch zuerst musste er sich noch zwei weitere Nachrichten anhören.
»Ben. Matt. Ruf mich an, sobald du kannst. Es ist wichtig.«
Jetzt stellte sich bei Cooper Unbehagen ein. Er drückte den Knopf, um sich die dritte Nachricht anzuhören.
»Ben, bitte ruf mich an. Es ist sehr wichtig.« Dann folgte eine Pause. »Es geht um Mum.«
Diane Fry bog mit ihrem Peugeot von der Castleton Road in die Grosvenor Avenue ein und hielt schließlich am Randstein vor der Hausnummer 12. Das Haus war einst imposant und eindrucksvoll gewesen, eine freistehende viktorianische Villa in einer baumgesäumten Straße. Die Eingangstür schmiegte sich in einen nachempfundenen Säulengang, und zu den Einzimmerappartements im obersten Geschoss gelangte man nur über ein verborgenes Bedienstetentreppenhaus. Doch inzwischen waren die meisten Bewohner Studenten des High Peak College, dessen Campus sich im Westen der Stadt befand.
Fry fand ihre Wohnung oft deprimierend, vor allem, wenn sie leer war. Wardlow hatte sie allerdings auch deprimierend gefunden. Die Gewöhnlichkeit der Ortschaft hatte die Anrufe von der Telefonzelle neben der Kirche noch beunruhigender gemacht.
Obwohl sie Wardlow schlimm genug gefunden hatte, war es längst nicht so hinterwäldlerisch wie die Gegend, die Dark Peak genannt wurde. Dort oben herrschte nur Trostlosigkeit: karges, menschenleeres Moorland, das keinerlei Abwechslung bot. Sie erinnerte sich an ein Straßenschild, das sie gesehen hatte, als sie das letzte Mal dort gewesen war: SCHAFE AUF 7 MEILEN. Sieben Meilen. Das war die Entfernung von einem Ende von Birmingham zum anderen, von Chelmsey Wood bis Chad Valley. Dazwischen lebte ungefähr eine Million Menschen. Das sagte eigentlich alles.
Nachdem sie sich von den West Midlands hierher hatte versetzen lassen, war sie eine Außenseiterin gewesen, das neue Mädchen, das sich erst noch beweisen musste. Zeitweise war das ein ziemlicher Kampf gewesen, genau wie sie es erwartet hatte. Doch sie war zielstrebig, und sie hatte hart gearbeitet. Und jetzt wurde ihr eine Menge Respekt entgegengebracht, allerdings in erster Linie von Menschen, die sie verabscheute.
Fry ging zum Fenster, da sie glaubte, auf der Straße ein Auto gehört zu haben. Doch es waren keine Autos zu sehen, nicht einmal Fußgänger, die auf ihrem abendlichen Nachhauseweg vorbeikamen. Das Einzige, was sie dort draußen sehen konnte, war Edendale.
Nein, Moment. Da war doch jemand. An der Ecke trennten sich zwei Gestalten, so nah am Rand ihres Sichtfeldes, dass sie die Stirn gegen die Fensterscheibe drücken musste, um sie zu sehen. Einen Augenblick später kam eine Person ins Blickfeld, die auf das Haus zuging. Angie.
Fry wich vom Fenster zurück, bevor ihre Schwester sie sehen konnte, und ging in die Küche. Zwei Minuten später hörte sie Angies Schlüssel im Türschloss.
»Hallo, Schwester.«
»Hallo. Hattest du einen schönen Tag?«
»Klar.«
»Was hast du gemacht?«
Angie hatte ein geheimnisvolles Lächeln auf den Lippen, als sie ihre Jeansjacke auszog. Diane war sich nicht ganz darüber im Klaren, was sie ihrer Schwester gegenüber empfinden sollte. Eigentlich hätte sie sich freuen sollen, dass Angie viel besser aussah als bei ihrem Einzug. Ihre Haut war weniger blass, sie hatte keine so dunklen Augenringe mehr, und ihre Handgelenke und Schultern waren nicht mehr so furchtbar dünn und knochig. Jemand, der Angie und sie nicht kannte, hätte vielleicht nicht erraten, welche von ihnen beiden die ehemalige Heroinabhängige war.
Trotzdem war Diane nicht in der Lage, ihren Groll zu unterdrücken, der sich inzwischen jeden Tag bemerkbar machte und ihr Verhältnis unterschwellig beeinflusste. Kaum hatte sie Angie wiedergefunden, hatte ihre Schwester erneut begonnen, ihr zu entgleiten, und dieses Mal schien es eine persönlichere Angelegenheit zu sein. Wäre alles anders gekommen, wenn sie Angie selbst aufgespürt hätte und Ben Cooper seine Finger nicht im Spiel gehabt hätte? Sie würde es nie erfahren.
»Wenn du es genau wissen willst, ich habe mir einen Job gesucht.«
»Was?«
»Denkst du etwa, ich will dir ewig auf der Tasche liegen, Di? Ich werde mich an der Miete beteiligen.«
Angie kickte ihre Schuhe weg und ließ sich aufs Sofa fallen. Diane wurde bewusst, dass sie wie eine vorwurfsvolle Mutter in der Tür stand, und setzte sich deshalb auf die Kante eines Sessels.
»Das ist ja toll«, sagte sie. »Was für einen Job denn?«
Da war es wieder, dieses Lächeln. Angie tastete zwischen den Kissen nach der Fernbedienung und schaltete den Fernseher an. »Ich werde in einer Bar arbeiten.«
»Soll das heißen, dass du hinter der Bar bedienen wirst?«, fragte Diane vorsichtig.
Angie sah sie an und lachte über ihren Gesichtsausdruck. »Was dachtest du denn? Dass ich als Stripperin arbeite? Gibt’s in Edendale etwa ein Spearmint Rhino?«
Diane lachte nicht. Sie atmete tief durch. »Und in welchem Pub wirst du arbeiten?«
»Im ›The Feathers‹. Kennst du den?«
»Vom Hörensagen.«
»Ich habe schon mal als Bardame gearbeitet, also werde ich schon zurechtkommen. Wenn ich Trinkgeld bekomme, bleibt mir vielleicht sogar noch was zum Ausgeben übrig. Freust du dich nicht, Schwester?«
Diane ging in Gedanken den Wortlaut der Polizei-Verordnungen durch. Verordnung Nummer sieben untersagte Polizeibediensteten und allen im Haushalt lebenden Angehörigen, Geschwister eingeschlossen, jegliche Geschäftsinteressen.
»Solange du nicht Mitinhaberin wirst – sonst müsste ich nämlich die Erlaubnis vom Chief Constable einholen.«
Sie versuchte, das beiläufig zu sagen, doch Angie schaltete den Fernseher aus und starrte sie entsetzt an.
»Das muss ein schlechter Scherz sein.«
»Nein.«
»Dein bescheuerter Chief Constable kann mir doch nicht vorschreiben, wie ich mein Leben zu leben habe. Was wäre, wenn er es mir nicht erlauben würde? Was kann er mir denn schon tun?«
»Nichts«, erwiderte Diane. »Aber ich müsste bei der Polizei aufhören.«
»Oh, Pech.«
Angie sprang wieder auf und sammelte auf dem Weg zu ihrem Zimmer ihre Schuhe auf. Diane spürte Wut in sich aufsteigen.
»Angie …«
Ihre Schwester drehte sich für einen Augenblick um, ehe sie verschwand. »Ganz ehrlich, Di, deinen verdammten Job zu kündigen, das wäre das Beste, was du tun könntest. Dann würde ich vielleicht die Schwester zurückbekommen, die ich in Erinnerung habe.«
Diane starrte auf die Tür, als diese hinter Angie zuschlug. Sie wusste nicht, was sie denken sollte, abgesehen davon, dass sie keine Gelegenheit bekommen hatte, zu fragen, wer der Mann war, mit dem sie ihre Schwester an der Straßenecke gesehen hatte.
Ben Cooper hatte das Gefühl, als marschierte er bereits seit einer halben Stunde durch Krankenhausflure. Er war sich sicher, dass er vor etwa hundert Metern an einem Schwesternzimmer links abgebogen war, doch jetzt stand er vor einem anderen Schwesternzimmer, das genauso aussah. Waren Krankenhäuser schon immer so anonym gewesen, oder war das nur das Ergebnis der jüngsten Modernisierungsmaßnahmen im Edendale General Hospital?
Und dann erblickte er in dem Flur vor ihm eine vertraute Gestalt in abgetragenen Jeans und einem dicken Pullover mit Löchern an den Ellbogen. Cooper lächelte erleichtert. Sein Bruder Matt wirkte in einem Krankenhaus völlig fehl am Platz. Zunächst einmal war Matt in einem anderen Maßstab gebaut als die Krankenschwestern, die an ihm vorbeigingen. Seine Hände und Schultern wirkten unbeholfen und zu groß, als würde alles Zerbrechliche, dem er zu nahe kam, zu Bruch gehen. Er war ein Mensch, den man nicht unbedingt zwischen Injektionsnadeln und Infusionsapparaten lassen sollte.
Außerdem sah er viel zu gesund aus, um sich in einem Krankenhaus aufzuhalten, auch als Besucher. Da er ständig der Sonne und der Witterung ausgesetzt war, hatte seine Haut einen dunklen, erdigen Teint, der in starkem Kontrast zu dem klinischen Weiß und den blassen Pastelltönen der frisch gestrichenen Wände stand.
Matt sah auf und kam auf ihn zu. Er legte seinem Bruder den Arm um die Schulter, eine seltene Geste, die Bens Herz vor Sorge ins Stocken geraten ließ.
»Ich habe mit dem Arzt gesprochen«, sagte Matt. »Nicht mit dem Chefarzt, nur mit einem Assistenzarzt, oder wie man die nennt. Komm mit runter ins Wartezimmer. Wir können uns eine Tasse Tee holen.«
»Ich möchte Mum sehen.«
»Sie schläft, Ben. Es hieß, sie muss sich ausruhen. Ich glaube sogar, sie haben ihr was gegeben, um sie ruhigzustellen.«
»Matt …«
»Komm mit, wir müssen da entlang. Ich glaube, das Women’s Institute betreibt noch eine Kantine für Besucher, also müsste der Tee in Ordnung sein.«
Ben spürte, wie er seinem Bruder automatisch folgte – beinahe so, wie er ihrem Vater so viele Jahre lang gefolgt war.
»Matt, vergiss den Tee. Ich muss wissen, wie es Mum geht. Was ist passiert?«
Anstatt zu antworten, ging Matt weiter den Flur entlang. Er war einige Zentimeter größer als Ben und wesentlich schwerer als sein Bruder. Ben wusste, dass es keinen Sinn hatte, sich zu sträuben, und versuchte deshalb, mit seinem Bruder Schritt zu halten. Er spürte eine warme Welle der Verärgerung in sich aufsteigen, eine Verärgerung, von der er wusste, dass sie von Furcht herrührte.
»Tee«, sagte Matt. »Und dann erzähle ich dir alles, was ich weiß.«
Matt Cooper balancierte vorsichtig zwei Tassen Kaffee durch die Krankenhauscafeteria. Es sah aus, als fürchtete er, dass er Flüssigkeit verschütten und jemand ausrutschen und sich das Bein brechen könnte. Ein solcher Unfall wäre in einem Krankenhaus schlimmer gewesen als irgendwo sonst.
Ben legte die Hände um die Tasse, um sich die Finger daran zu wärmen, und betrachtete den aufsteigenden Dampf – alles, was seine Ungeduld linderte, war ihm recht.
»Kate hat erzählt, dass sie dich heute schon gesehen hat«, sagte Matt. »Dein Wagen war auf der Scratter Road geparkt.«
»Wo?«
»Auf der Scratter Road, zwischen Wardlow und Monsal Head. So heißt die Straße.«
Ben runzelte die Stirn. »Komm schon, Matt, raus mit der Sprache.«
Sein Bruder ließ sich mit einem Seufzen auf einen Stuhl sinken. »Anscheinend ist Mum im Pflegeheim gestürzt.«
»Was heißt ›anscheinend‹?«
»Na ja, also … sie ist hingefallen. Aber das Personal in der Old School ist sich nicht sicher, wie es passiert ist. Und du weißt ja, wie verwirrt Mum manchmal ist. Ich konnte mit ihr sprechen, bevor sie ihr ein Beruhigungsmittel gegeben haben, und sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befindet.«
»Wie schwer ist sie verletzt?«
»Sie hat sich das Becken gebrochen.«
»Scheiße.«
»Ich weiß. Und sie denken, dass sie sich vielleicht auch den Kopf angeschlagen hat, als sie hingefallen ist. Sie war ziemlich benommen und konnte sich an nichts mehr erinnern.«
»Vom Pflegeheim sollte jemand hier sein«, sagte Ben. »Warum ist niemand hier? Die sind schließlich verantwortlich.«
»Ben, beruhige dich. Die Oberschwester hat sie ins Krankenhaus begleitet und ist für zwei Stunden geblieben, bis ich sie zurückgeschickt habe. Der Heimleiter hat schon zweimal angerufen und sich erkundigt, wie es Mum geht. Sie machen sich ziemliche Sorgen um sie.«
»Das sollten sie auch. Schließlich müssen sie noch ein paar Fragen beantworten.«
Matt trank einen Schluck Kaffee, doch Ben rührte seine Tasse nicht an. Er merkte, wie seine Hände vor Wut zitterten, und wusste, dass er seinen Kaffee nur verschütten würde.
Irgendjemand hatte eine gefaltete Ausgabe der Abendzeitung mit der oberen Hälfte der Titelseite nach oben auf dem Tisch liegen lassen. Ben sah oberhalb der Faltkante nur die ersten zwei bis drei Zentimeter eines Fotos, das er trotzdem sofort erkannte. Er hatte es den größten Teil des Tages betrachtet. Wenigstens hatte die Presseabteilung ihren Job ordentlich gemacht.
»Wann wird Mum wieder aufwachen?«, erkundigte er sich.
»Sie möchten sie so lange ruhigstellen, bis sie die Röntgenaufnahmen gemacht haben und sie in den OP bringen können. Morgen können wir vielleicht mit ihr sprechen. Aber wir könnten uns ein paar Minuten an ihr Bett setzen, wenn wir die Schwester fragen.«
Ben starrte seinen Kaffee an, der allmählich kalt wurde. Nachdem der Dampf verschwunden war, sah er noch weniger verlockend aus.
»Dann lass uns das machen.«
»Es war nur ein Sturz, Ben. Ein Beckenbruch hört sich schlimm an, aber so alt ist sie auch noch nicht.«
»Weißt du eigentlich, was eine Kopfverletzung bedeuten kann? Schon ein leichter Schlag …« Ben hielt inne und atmete tief ein. »Okay, entschuldige. Du findest, dass ich überreagiere.«
»Ja, das tust du.«
»Entschuldige, Matt«, sagte er noch einmal. »Die Arbeit, weißt du …«
»Zieht sie dich wieder runter?«
Ben gefiel das »wieder« nicht. Als sie über den Flur zur Station zurückgingen, spürte er abermals Wut in sich aufsteigen. Er legte Matt die Hand auf den Arm.
»Wie heißt der Heimleiter der Old School gleich wieder?«
»Robinson. Warum?«
»Wenn wir nachher von hier weggehen, fahre ich zu ihm und rede mit ihm.«
»Ben, das bringt doch nichts.«
»Ich will genau wissen, wie das passiert ist und was sie unternehmen werden.«
Matt griff nach seinem Arm und packte ein wenig zu fest zu. Sein Gesicht war noch etwas dunkler angelaufen als sonst, und er atmete schwer.
»Ich warne dich – fang nicht an, wahllos auf alle einzuschlagen, Ben. So wirst du deine Schuldgefühle auch nicht los.«
Unter ihren Füßen lag zerbröckelte Erde, die aussah wie Glasscherben. Der Regen der vergangenen zwei Tage hatte ihre Beine mit Schlamm besprenkelt, der jetzt dunkel und feucht zwischen ihren Zehen und in einer alten Bruchstelle an ihrem linken Oberschenkel lag. Ameisen waren aus dem verfaulten Laub auf dem Waldboden aufgetaucht und krabbelten zwischen den steifen Falten ihres Kleids umher und über ihre Hände. Eine von ihnen verharrte bei den geruchlosen Blumen, ehe sie weiter nach oben kletterte. Doch die Ameise wusste offenbar nicht, was sie tun sollte, als sie beim Kopf ankam, und nahm weder den Himmel noch die Alder-Hall-Wälder zur Kenntnis. Die Ameise nahm nur einen winzigen Teil des Körpers wahr – einen Quadratzentimeter des Halses, dessen Haut weiß und hart war und sich glatt anfühlte.
An diesem Nachmittag war jemand in die Wälder gekommen, eine Gestalt, die sich zum Schutz vor dem Wind in einen Mantel und einen Schal gewickelt hatte. Sie hatte die Hände in die Taschen gesteckt und eine Leinentasche über der Schulter getragen, war dem Pfad vom unteren Ende des Alder-Hall-Steinbruchs gefolgt, hatte den Bach überquert und war zwischen den Bäumen den Hang hinaufgeklettert. Am Rand der Lichtung war die Gestalt für ein paar Augenblicke stehen geblieben, ehe sie ins Freie getreten war und sich dann den Weg durch die hohen Weidenröschen gebahnt hatte, ohne deren abgebrochene Stängel wahrzunehmen, die sich an ihren Ärmeln verfingen und an ihren Jeans hängen blieben.
Als der Besucher bei dem Sockel angekommen war, hatte er seine Leinentasche geöffnet, einen Strauß Blumen herausgeholt und ihn zu Füßen der Statue gelegt, dann war er einen Schritt zurückgetreten, um das Arrangement zu bewundern. Der Anblick hatte ihm ein zufriedenes Lächeln entlockt. Bei den Blumen hatte es sich um weiße Chrysanthemen gehandelt, die zum Tod passten.
MEIN TAGEBUCH DER TOTEN, PHASE EINS
Niemand hat mir gesagt, dass mich die schlimmsten Albträume heimsuchen würden, während ich noch wach bin. Niemand hat mich davor gewarnt, dass ich in der Dunkelheit in meinem Bett liegen würde, die Augen weit geöffnet, und um Schlaf beten würde. Das waren die Stunden, in denen ich Gesichter auf der Tapete zählte und in meinen Kleidungsstücken, die auf einem Stuhl lagen, die Umrisse eines Monsters erkannte. Das war die Zeit, als ich den Geräuschen im Freien lauschte, als ich so genau auf sie lauschte, wie ich konnte, in der Hoffnung, dass die Geräusche in mir auf diese Weise vielleicht verschwinden würden. Wenn diese Stunden schließlich verstrichen waren, blieb nichts mehr übrig außer den Geräuschen der Nacht – dem Schlürfen der Dunkelheit, die über mein Dach gekrochen kam.
Irgendetwas lebt in dieser Dunkelheit. Es ist unsere größte Furcht, und wir nennen sie das Unbekannte. Jeder kennt diese Furcht, doch nur wenige wagen es, über sie nachzudenken. Wir wären niemals in der Lage, unser Leben weiterzuleben, wenn wir den feixenden Schemen tatsächlich sehen könnten, der hinter unserem Rücken lauert. Es ist viel besser, so zu tun, als wären wir uns dieses Ungeheuers nicht bewusst. Wir wenden den Blick ab und reden uns ein, es sei nur ein Schatten, den das Sonnenlicht wirft. Als sei es nur ein Windhauch, der durch ein geöffnetes Fenster weht, oder das Rascheln abgestorbener Blätter vor der Tür.
Es ist dieselbe Furcht wie die Furcht eines Kindes, dessen Tür nachts offen stehen muss, damit ein wenig Licht ins Zimmer fällt, oder die einer alten Frau, deren Hand zittert, wenn sie den Riegel zurückschiebt. Letztendlich sind wir alle dazu bestimmt, dieser Dunkelheit, die wir in unseren Träumen kurz erblicken, in die Klauen zu fallen. Dem großen Seelenfänger, dem unsichtbaren Schergen, der auf der Türschwelle lauert. Auf welcher Schwelle lauert er wohl, wenn nicht auf der Schwelle zum Tod?
Seht ihr diesen Schatten jetzt? Spürt ihr die Kälte, und hört ihr das Rascheln?
Heutzutage sind meine Träume anders. Manchmal sehe ich in meinen Albträumen, wie sich Leichen in ihren Särgen bewegen. Ihre Münder verziehen sich, ihre Gliedmaßen krümmen sich, ihre Hände öffnen und schließen sich wie Klauen, wenn sie nach dem Licht greifen. Ich versuche, dafür zu sorgen, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie still liegen, damit sie bestattet werden können. Doch das ist immer vergebens. In meinen Träumen hören die Toten einfach nicht auf, sich zu winden.