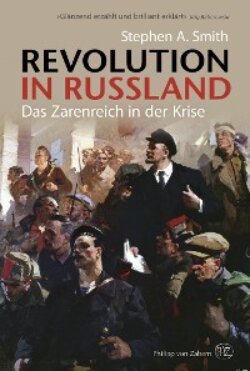Читать книгу Revolution in Russland - Stephen Smith - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Landwirtschaft und Bauerntum
ОглавлениеIn der Spätzeit des Zarismus war Russland eine weit überwiegend agrarische Gesellschaft, in der drei Viertel der Bevölkerung ihren Lebensunterhalt als Bauern bestritten.40 Die Umweltbedingungen variierten stark, wobei der Hauptunterschied zwischen der fruchtbaren Schwarzerdezone und den weniger fruchtbaren Gebieten außerhalb dieser Zone lag. Zur Schwarzerdezone gehörten die Ukraine, die landwirtschaftliche Zentralregion (die Provinzen Kursk, Orel, Tula, Rjasan, Tambow und Woronesch), die mittlere Wolga, der südwestliche Ural sowie Südwest-Sibirien; die anderen Gebiete waren die zentrale Industrieregion und die bewaldeten Provinzen im Norden und Westen. Hauptsächlich wurde Getreide angebaut, und zwar bis 1913 auf 90 Prozent der Gesamtanbaufläche.
Um 1910: Einbringen der Ernte
In technischer Hinsicht war die Landwirtschaft zurückgeblieben: Dreifelder- und Streifenflurwirtschaft waren noch weit verbreitet. Auch die Mechanisierung hatte kaum Fortschritte gemacht (Holzpflug und Handsense bildeten die Norm), und nur selten wurde Kunstdünger eingesetzt. Insofern lag der Ernteertrag weit unter dem anderer Länder. Ein ungewöhnlich kalter Winter und eine Reihe von Missernten konnten katastrophale Auswirkungen haben. So geschah es 1891/92, als in den Wolga- und den zentralen Landwirtschaftsprovinzen bis zu 400.000 Menschen verhungerten (wobei die Regierung eine Mitschuld traf, weil sie die Getreideexporte nicht rechtzeitig stoppte).41 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs die Bevölkerung des Reichs schneller als in den zweieinhalb Jahrhunderten zuvor und stieg zwischen 1860 und 1914 von 74 auf 167,5 Millionen.42 Als Ergebnis wurde das Land knapp und die Pachtzinsen stiegen: Betrug die Fläche an Ackerland 1877 im Durchschnitt 13 Hektar pro Haushalt, so waren es 1905 nur noch 10 Hektar.43 Das war, verglichen mit den Bauernhöfen in Westeuropa, immer noch viel, doch da die Erträge sehr viel niedriger waren, hatten die russischen Bauern vor allem in den zentralen Schwarzerde- und den westlichen Provinzen eine unsichere Existenz.
Bezeichnend für die Rückständigkeit des europäischen Teils von Russland ist die Tatsache, dass 1905 weniger als die Hälfte der Neugeborenen ein Alter von fünf Jahren erreichten. Das Land wurde von ansteckenden Krankheiten wie Masern und Diphterie heimgesucht; mangelnde Hygiene, Übervölkerung, schlechte Belüftung und natürlich ein miserables Gesundheitswesen taten ihr Übriges.44 Ein direkter Grund für die hohe Kindersterblichkeit – 1914 betrug sie 273 auf 1000 Geburten – lag darin, dass die auf dem Feld arbeitenden Mütter ihre Babys der Fürsorge der älteren Leute oder jüngeren Geschwister überließen, die die Kleinen mit vorgekautem Brot fütterten, das, nur von einem Tuch bedeckt, bei Hitze schnell faulte. Bei den Tataren, wo die Frauen nicht auf dem Feld arbeiteten, war die Kindersterblichkeit sehr viel geringer.45
Die dörfliche Gemeinschaft war höchst konservativ, was ihre Werte und Praktiken anging. Sie hatten sich über Jahrhunderte herausgebildet und waren geeignete Mittel, um die Unwägbarkeiten des Klimas ebenso kollektiv kontrollieren zu können wie die unvorhersehbaren Entscheidungen der Behörden. Die Gemeinschaft hatte Vorrang vor dem Individuum, und das Dorf bildete „eine geschlossene Front gegen das Außerhalb“. Man wehrte sich gegen Eindringlinge wie etwa Steuereintreiber oder Anwerber für das Militär.46 Die Gemeinschaft war die Institution, die den Kollektivismus der ländlichen Gesellschaft am stärksten verkörperte. An der Wende zum 20. Jahrhundert waren etwa drei Viertel des in bäuerlichem Besitz befindlichen Landes, darunter fast die Hälfte des Ackerlands, einer einzigartigen Form von Verwaltung unterworfen, in der die Haushaltsvorstände das der Gemeinschaft gehörende Ackerland periodisch neu unter die betreffenden Haushalte aufteilten. Des Weiteren entschied diese Dorfversammlung darüber, wann die Haushalte pflügen, säen, ernten oder Heu machen sollten. Solche Art von kollektiver Kontrolle hatte den Zweck, unwägbare Umweltrisiken zu minimieren und dafür zu sorgen, dass die Armen nicht zur Belastung wurden. Die Dorfversammlung war auch für die Steuerzahlung der Haushalte verantwortlich und musste Recht und Ordnung aufrechterhalten.
1905 verfügten in den 46 Provinzen des europäischen Teils von Russland 8,68 Millionen Haushalte über Land, das formell der kommunalen Neuaufteilung unterstand, während 2,3 Millionen über Landbesitz auf erblicher Basis verfügten (das also vom Vater auf den Sohn überging). Die Gesamtzahl der bäuerlichen Haushalte im europäischen Teil betrug etwa 12 Millionen. Im Baltikum gab es keine derartigen Dorfgemeinschaften, und in der Ukraine herrschte die Erbfolge vor.47 Zeitgenossen sahen in der Dorfgemeinschaft einen Hemmschuh für Unternehmertum und Innovation, da es wenig Anreize gab, den eigenen Hof zu verbessern, wenn das Land wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft neu aufgeteilt würde. (Allerdings hatten 1917 etwa zwei Fünftel der Gemeinschaften im europäischen Teil, darunter einige in den übervölkerten zentralen Landwirtschaftsprovinzen, seit den 1880er Jahren keine Neuaufteilung erlebt.)48
Die bäuerliche Gesellschaft war patriarchal organisiert: Die Männer hatten Macht über die Frauen, und die ältere Generation über die jüngere. Nur Männer hielten Eigentumsrechte an Hof und Land, und die Vermögenswerte wurden beim Tod des Haushaltsvorstands gleichmäßig auf die Söhne verteilt. Trotz der Privilegierung des Mannes waren die Söhne dem Vater fast ebenso vollkommen untergeordnet wie die Frau dem Mann.49 Wurde eine junge Frau Mitglied der Familie ihres Mannes, war sie der Schwiegermutter untergeordnet. Allerdings verbesserte sich ihr Status, wenn sie Kinder bekam, und war ihr Mann erst einmal Haushaltsvorstand, konnte sie das Zepter über ihre Schwiegertöchter schwingen.50 Allerdings waren die jungen Ehepaare immer weniger bereit, unter dem Dach des Patriarchen und seiner Frau zu wohnen. Es wuchs die Neigung zur Trennung vom elterlichen Haushalt und zur Bewirtschaftung eines eigenen Hofs. Damit wurde der durchschnittliche Haushalt kleiner. 1897 bestand die Durchschnittsfamilie aus 5,8 Personen, wobei es jedoch Größenunterschiede gab, vor allem zwischen der Schwarzerde- und den anderen Zonen.51
Bis 1917 bestimmte das Gesetz, dass eine Ehefrau ihrem Mann unbedingten Gehorsam schulde. Sie müsse mit ihm leben, seinen Namen an- und seinen sozialen Status übernehmen. Es war ihre Pflicht, sich um den Haushalt zu kümmern und dem Mann bei der Arbeit auf dem Hof zu helfen; dafür sollte er „mit ihr in Eintracht leben, sie respektieren und schützen, ihre Unzulänglichkeiten verzeihen und bei Erkrankung ihre Schmerzen lindern“. Eine verheiratete Frau durfte keine bezahlte Arbeit annehmen, keine Ausbildung absolvieren, keinen Personalausweis für Lohnarbeit oder Wohnort besitzen, keinen Wechsel ohne Zustimmung ihres Gatten ausstellen. 1914 kam es zu begrenzten Reformen: Nun durfte sie sich von ihrem Ehemann trennen und über einen eigenen Ausweis verfügen.52 Das Gewohnheitsrecht schützte das persönliche Eigentum einer Ehefrau, dazu gehörten neben der Aussteuer auch Einkünfte aus dem Verkauf von Gemüse, Federvieh oder Strick- und Webwaren. Wenn der Ehemann sie verließ, konnte sie Unterstützung durch das örtliche Gericht erwarten, obwohl die Gerichte bei Beschwerden über Misshandlung durch den Mann nicht unbedingt auf Seiten der Frau standen.53 Im Haushalt selbst konnte die Frau relativ frei schalten und walten. Sie zog nicht nur die Kinder auf, kochte, putzte, wusch, nähte und stopfte, sondern spann auch Garn und webte, kümmerte sich um das Vieh, baute Flachs an und half bei der Ernte. Durch ihre Rolle beim Arrangieren von Heiraten, bei Geburten und Taufen und allgemein bei der Pflege von für die Gemeinschaft wichtigen Werten und Normen genoss die verheiratete Frau im Dorfleben eine gewisse informelle Autorität.54 In Regionen, wo Männer Arbeitsmigranten sein mussten, übernahmen Frauen bei der Hof- und Feldarbeit deren Aufgaben wie Pflügen, Säen, Heumachen, das Vieh füttern und Brennmaterial herbeiholen.55
Wenn auch die Landwirtschaft selbst der Subsistenz und damit der Tradition verhaftet blieb, blühte das Geschäft mit Agrarprodukten auf. 1914 war Russland der weltweit führende Getreideexporteur, und im letzten Jahrzehnt des Ancien Régime wuchs die Getreideproduktion schneller als die Bevölkerung. Meistens kam das Getreide von Großbetrieben, die Lohnarbeiter beschäftigten, aber um die Wende zum 20. Jahrhundert verkauften Bauern bis zu einem Viertel ihrer Ernte (und sei es auch nur, um die Steuern bezahlen zu können).56 Die Produktion von anderen Feldfrüchten als Getreide und von Nutzvieh war bei weitem nicht so gut entwickelt, aber in der westlichen Ukraine – in den Provinzen westlich des Dnjepr – wuchs die industrielle Verwertung von Zuckerrüben beträchtlich. Und in den baltischen Provinzen, im Nordwesten und in der zentralen Industrieregion – den Provinzen von Moskau, Wladimir, Jaroslawl, Kostroma, Tula, Kaluga und Rjasan – begannen die Bauern mit dem Betreiben von Gemüsegärten, der Herstellung von Milchprodukten für wachsende städtische Märkte und dem Anbau von industriell verwertbaren Feldfrüchten wie Flachs.57 In Sibirien, wo es nie besonders viel Großgrundbesitz und Leibeigenschaft gegeben hatte, fing man sogar mit dem Einsatz von Maschinen fürs Mähen, Garbenbinden und Dreschen an. Wo es also Zugang zu Märkten (wie in der Südukraine oder Südostrussland) oder zu Eisenbahnen, der Wolga oder dem Schwarzen Meer gab, nutzten Bauern neue Möglichkeiten, um ihre Landwirtschaft stärker auf den Handel auszurichten. In den Kerngebieten des europäischen Teils jedoch blieb die marktorientierte Agrikultur unterentwickelt und der Kapitalismus, gemessen an Investitionen, technischen Innovationen und der Verwendung von Lohnarbeit, selten voll ausgebildet.
Zeitgenössische Beobachter sahen auf dem Land verbreitete Armut, bemerkten, dass die Größe des durchschnittlichen Bauernhofs schrumpfte, und glaubten, dass die Entschädigungszahlungen auch weiterhin eine schwere Last sein würden (die Zahlungen waren 1861 verfügt worden, um die Landbesitzer für das ihren ehemaligen Leibeigenen überlassene Land zu entschädigen). Infolgedessen waren sie davon überzeugt, dass der Lebensstandard der Landbevölkerung sich verschlechterte. Natürlich blieb die bäuerliche Existenz ärmlich und unsicher, doch ist wahrscheinlich, dass der Lebensstandard insgesamt langsam stieg, denn die Pro-Kopf-Produktion an landwirtschaftlichen Gütern wuchs schneller als die Bevölkerungszahl, und der dem bäuerlichen Haushalt zukommende Anteil an Getreide und anderen Lebensmitteln nahm ebenfalls zu.58 Auch die zunehmende Körpergröße der Rekruten deutet darauf hin, dass die Ernährung sich verbesserte.59 Zudem gibt es Hinweise darauf, dass sich die Last an Steuern, Pacht und Zinsen auf durchschnittlich ein Fünftel des Haushaltseinkommens reduzierte, wobei diese Zahlen nicht unumstritten sind.60 Und schließlich konnten die Geldeinlagen in den ländlichen Sparkassen als gesund bezeichnet werden.
Diese allmählichen Verbesserungen spiegelten die Tatsache, dass die Bauern neue Einkommensquellen in Handel und Handwerk entdeckt hatten: Bier brauen, Butter machen, Garn spinnen, Leder einfärben. Oftmals fanden sie auch bezahlte Arbeit in der Land- und Waldwirtschaft, im Transportgewerbe, in der Fabrik oder als Hausgehilfen, wobei es sich für gewöhnlich um Saisonarbeit handelte. Allerdings verlief diese Entwicklung regional sehr unterschiedlich. Fast ein Drittel der Bauern des europäischen Teils lebte in den Schwarzerde- und Wolgaprovinzen, wo der Pro-Kopf-Ertrag an Getreide seit den 1880er Jahren zu sinken begann. Darüber hinaus sank die Nutzviehhaltung ebenso wie die Entlohnung der Landarbeiter.61 Dennoch gibt es viele Hinweise auf eine allmähliche Verbesserung der Lebensbedingungen der Landbevölkerung.
Die weitreichendste Reform, die im Vorfeld der Revolution von 1905 eingeführt wurde – auf jeden Fall die, von der am meisten Menschen betroffen waren –, stammte von Ministerpräsident Pjotr Stolypin. Er verkündete sie im November 1906 und vervollständigte sie durch die Gesetze vom Juni 1910 und Mai 1911. Dadurch konnten die Bauern die Landanteile, die sie in der Dorfgemeinschaft bewirtschafteten, erwerben und einen eigenen Hof gründen. Stolypin wollte mit dieser Reform die „Starken“ begünstigen und für eine Schicht tatkräftiger freier Bauern sorgen, die die Modernisierung der Landwirtschaft vorantreiben sollten. Außerdem hoffte er, damit nach den Bauernaufständen von 1905 eine konservative Stütze der Autokratie zu schaffen. Zwischen 1906 und 1915 profitierten etwa drei Millionen Haushalte von der Reform, sei es, dass sie Land von der Gemeinschaft erwarben oder sich an der Entscheidung der Gemeinschaft zu einem gruppenweisen Landerwerb beteiligten oder sich zu einer Trennung von der Gemeinschaft entschlossen. Weitere drei Millionen, die einen Antrag auf Erwerb gestellt hatten, waren entweder abschlägig beschieden worden oder warteten noch bei Kriegsausbruch auf eine Entscheidung.62 In der zentralen Schwarzerderegion, der zentralen Industrieregion und im Norden gab es nur wenige Übernahmen; die größte Konzentration an eingehegten Höfen fand sich im Nordwesten und Westen sowie im Süden und Südosten.63
Im Allgemeinen besaßen ärmere Familien nicht die notwendigen Mittel, um sich selbständig zu machen, wobei nicht alle, die einen Antrag stellten, wohlhabend waren. Viele wohlhabendere Haushalte scheuten das Risiko und blieben lieber in der Gemeinschaft. Schätzungsweise waren bis 1914 15,9 Prozent Gemeindeland (ohne das der Kosaken) privatisiert worden, während zwischen 27 und 33 Prozent aller Haushalte mit einer Form von Erbrecht verknüpft waren. Die Divergenz zwischen diesen Zahlen ist der Tatsache geschuldet, dass nur Ackerland eingehegt werden konnte, während Weideflächen, Wald, Brachland, Teiche, Viehtriften, Straßen usw. der Kontrolle der Gemeinde unterlagen.64 Ein endgültiges Urteil über den Erfolg der stolypinschen Reformen ist schwer zu fällen, da die Zeit der Umsetzung durch den Krieg ein jähes Ende fand und weil der Fokus der Reformen sich allmählich von der Einhegung auf die Verbesserung der ländlichen Produktionsbedingungen verschob. Es gibt Gründe für die Annahme, dass ohne den Krieg die Privatisierung weitere Fortschritte gemacht hätte, doch brachten Krieg und Revolution so viel Unruhe und Unsicherheit mit sich, dass die Gemeinschaft, als risikominimierende Institution, neuen Zulauf erhielt.
Einige Zeitgenossen waren davon überzeugt, dass sich die Bauern in dem Maße, wie der Kapitalismus sich auf dem Lande entwickelte, zu Klassen schichteten. Soziale Ungleichheit war typisch für das Dorfleben. Zur Jahrhundertwende erstellte Statistiken besagen, dass 17 bis 18 Prozent der Haushalte (1908 mögen es 25 Prozent gewesen sein) als wohlhabend eingestuft werden konnten, was besagt, dass sie über genügend Landbesitz sowie über Nutzvieh, Maschinen und Geld in einer Sparkasse verfügten. Am unteren Ende der Skala besaßen 11 Prozent der Bauernschaft kein Ackerland oder Nutzvieh.65 Diejenigen Personen, die die Bauern „Kulaken“ (dt.: „Fäuste“) nannten, wurden gewöhnlich nicht nach der von ihnen bewirtschafteten Fläche an Land bemessen, sondern mittels der Tatsache, dass sie Geld, Gerätschaften oder Zugtiere verliehen, Läden oder Mühlen besaßen. Einige Historiker führen an, dass solche Statistiken dynamische Prozesse, in denen die Lebensumstände individueller Haushalte sich bald zum Schlechteren, bald zum Besseren hin verändern, zeitlich stillstellen. Sie behaupten, die Wohlhabenheit von Haushalten sei durch Arbeit, nicht durch Landbesitz bestimmt worden. Wohlhabendere Haushalte hätten einfach über mehr arbeitende Mitglieder verfügt. Sobald jedoch erwachsene Söhne ihren eigenen Haushalt errichteten, sei das Vermögen des elterlichen Haushalts geringer geworden. Dieser Auffassung zufolge wurde der Hang zur sozialen Differenzierung durch die Teilung der Haushalte und die periodische Neuaufteilung des Ackerlands durch die Gemeinschaft wieder aufgehoben.66
Und es gibt noch weitere Probleme, wenn man bestimmen will, ob oder inwieweit es einen Trend zur sozialen Differenzierung gab; eines davon betrifft die Messbarkeit: Soll man die von einem Haushalt eingesäte Fläche zugrunde legen oder die in seinem Besitz befindliche Anzahl von Pferden oder sonstigem Nutzvieh oder die Verwendung von Lohnarbeit (die allerdings meistens von Saison- oder Tagesarbeitern geleistet wurde) oder den Besitz von landwirtschaftlichen Maschinen? Zudem erschien die Differenzierung geringer, wenn sie per Pro-Kopf-Einkommen gemessen wurde anstatt pro Haushalt. Im europäischen Teil stieg der Anteil der Haushalte ohne Pferde von 61,9 Prozent in den Jahren 1888–91 auf 68 Prozent um die Jahrhundertwende und erreichte 1912 74 Prozent. Das ließe auf eine Vertiefung der Klassenteilungen auf dem Lande schließen, sofern man nicht berücksichtigt, dass Haushalte mit einer großen Anzahl von Pferden vor allem in kommerziell weniger entwickelten Regionen zu finden waren.67 Wenn die Differenzierung tatsächlich zunahm, hatte das vielleicht weniger mit der Entwicklung geschäftsmäßig betriebener Landwirtschaft als mit Einkünften außerhalb des direkten Agrarbereichs zu tun. Eine Untersuchung von acht Provinzen der zentralen Industrieregion zeigt, dass die Differenzierung in der Landbevölkerung in Kreisen, wo die Menschen noch direkter in die Landwirtschaft eingebunden waren, geringer war als dort, wo Anbau für den Markt, Handwerk und Handel sowie Lohnarbeit sich weiter entwickelt hatten und der Bildungsgrad höher war.68
Wenn sich also die Lage der Bauern langsam verbesserte, warum gab es dann so viele Unruhen? Um das zu verstehen, muss man bis 1861 zurückgehen, dem Jahr, in dem die Leibeigenen endlich frei wurden. Die Bauern spürten jedoch, dass sie bei der Landverteilung betrogen worden waren. Nicht nur mussten sie für das erhaltene Land über einen Zeitraum von 49 Jahren sogenannte Entschädigungszahlungen leisten, sondern sie erhielten auch weniger Land, als sie bearbeitet hatten, da sie noch Leibeigene waren. Außerdem behielten ihre ehemaligen Herren etwa ein Sechstel des von den Leibeigenen kultivierten Landes, oftmals Ackerland bester Qualität und Lage. Ferner lagen die Entschädigungszahlungen über dem Marktwert des den Emanzipierten zugeeigneten Landes. 1917 gab es noch Großeltern, die als Kinder von Leibeigenen geboren worden waren, und die Militanz der Revolutionen von 1905 und 1917 wurde auch von der Erinnerung an die Leibeigenschaft genährt. Grundlegender noch war die moralische Ökonomie der russischen Bauernschaft, der zufolge nur diejenigen ein Recht auf Landbesitz hatten, die den Boden bearbeiteten und kultivierten. In einer Geschichte von Tolstoi entscheiden die Bauern über die Aufnahme von Fremden, indem sie deren Hände anschauen: Wenn die Handflächen schwielig sind, werden sie aufgenommen. In einem Brief vom August 1917 erklärt ein Bauer:
„Das uns gemeinsame Land ist unsere Mutter; sie nährt und schützt uns; sie macht uns glücklich und wärmt uns liebevoll … Und jetzt gibt es Leute, die davon reden, sie zu verkaufen, und tatsächlich wird in unserem korrupten, bestechlichen Zeitalter Land auf den Markt gebracht, um angepriesen und, wie sie es nennen, verkauft zu werden … Der grundsätzliche Irrtum liegt in der seltsamen und abartigen Behauptung, das Land, das Gott allen Menschen gab, damit sie sich ernähren können, irgendjemandem als Privateigentum gehören könnte … Land ist das Vermächtnis, das allen Menschen gemeinsam und gleichermaßen zu eigen ist und somit nicht Gegenstand privaten Besitzes sein kann.“69
Obwohl der Adel bei der Emanzipation der Leibeigenen ein gutes Geschäft gemacht hatte, nahm sein Vermögen während des folgenden halben Jahrhunderts rapide ab. 1917 gab es etwa 100.000 Familien mit Landbesitz, von denen ca. 61.000 dem Landadel angehörten.70 Diese Grundbesitzer hatten ungefähr die Hälfte des Landes, das sie zur Zeit der Emanzipation besaßen, verloren; allerdings gehörte ihnen noch mehr als die Hälfte aller Ländereien in Privatbesitz (auch wenn viele mit Hypotheken der Bank des Landadels belastet waren).71 Die Besitzungen des Landadels waren größenmäßig höchst unterschiedlich: Es gab einige sehr große Domänen, doch mehr als 60.000 Familien besaßen weniger als 145 Hektar (100 desjatina nach dem damals üblichen Flächenmaß). Zudem waren zwar manche Großgrundbesitzer zu kapitalistisch produzierenden Landwirten geworden, doch war das durchschnittliche Adelsgut so unterkapitalisiert wie der durchschnittliche Bauernhof. Bezeichnenderweise war um 1903 fast die Hälfte des Landes der landbesitzenden Klasse an Bauern verpachtet, und einige Bauern hatten Kredite von ihrer Bank aufgenommen, um dem Adel Land abzukaufen.72 Wie erwähnt, betätigten sich die liberalen Angehörigen des Adels während der 1890er Jahre und bis 1905 in den Semstwos, aber der zunehmend urbane Lebensstil einer großen Anzahl von ihnen und ihr nachlassendes Interesse an der Verwaltung ihrer Güter untergrub ihr Ansehen in der ländlichen Gesellschaft. Abgesehen davon war es den Bauern egal, ob der Adlige arm oder reich, konservativ oder liberal war – er gehörte in jedem Fall zu „denen“, zu jener privilegierten Gesellschaft, von der die Bauern sich vollkommen ausgeschlossen fühlten.
Der zaristische Staat begann im späten 19. Jahrhundert mit Investitionen in die Grundschulbildung, weil er den Bedarf an alphabetisierten, ausgebildeten und disziplinierten Arbeitern, Soldaten und Matrosen erkannte. Die Anzahl der Schüler in den ländlichen Grundschulen vervierfachte sich zwischen 1880 und 1914, während die Zahl der aus Bauernfamilien stammenden Lehrer zwischen 1880 und 1911 von 7369 auf 44.607 stieg.73 Die Volkszählung von 1897 ergab, dass 21,1 Prozent der Bevölkerung des europäischen Teils alphabetisiert waren, doch bestanden große Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Nur 13,1 Prozent der Frauen, aber 29,3 Prozent der Männer konnten lesen und schreiben. In den Städten betrug der Alphabetisierungsgrad 45,3 Prozent, auf dem Lande lag er bei 17,4 Prozent; in beiden Bereichen sollte er bis 1914 noch steigen.74 In jenem Jahr 1897 besuchte nur ein Fünftel aller Kinder im schulpflichtigen Alter die Schule.75 Sicher hielten viele Bauern die Schule für überflüssig, sobald die Söhne einigermaßen lesen und schreiben gelernt hatten, während Töchter keine Bildung brauchten. Ein Dorfbewohner gab (1893) einer weitverbreiteten Auffassung folgendermaßen Ausdruck: „Schickt man sie zur Schule, kosten sie Geld; behält man sie zu Hause, bringen sie Geld ein.“76 Doch 1911 machten Mädchen schon fast ein Drittel der Grundschüler aus, und die weitere Ausbreitung des Schulwesens führte dazu, dass 1920 von den Männern 42 Prozent und von den Frauen 25,5 Prozent alphabetisiert waren.77
Die Bewertungen dessen, was die zaristische Regierung im Bereich Schulbildung erreicht hat, fallen recht positiv aus.78 Die bäuerlichen Gemeinschaften kamen für fast ein Drittel der Lehrergehälter auf und übernahmen einen beträchtlichen Teil der Verantwortung für die Dorfschulen.79 Allerdings erhöhte sich der Anteil des regulären Staatshaushalts für Bildung und Erziehung von 2,69 Prozent 1881 auf 7,21 Prozent 1914; darin eingeschlossen sind Ausgaben des Bildungsministeriums, der Semstwos und der kommunalen Institutionen.80 Eine andere Zahl lässt auf ein weniger positives Bild schließen: Nach 1907 erhöhte sich der Anteil dessen, was das Bildungsministerium für die Grundschulbildung aufwendete, von 20 auf 40 Prozent, doch bedeutete dies immer noch, dass der Löwenanteil der höheren Schulbildung zugutekam.81 Die Regierung erkannte die Notwendigkeit, die Grundschulbildung stärker zu fördern, um die technischen Fähigkeiten und Arbeitsgewohnheiten der arbeitenden Bevölkerung zu verbessern, doch schauderte sie bei dem Gedanken, dass Schulbildung zur Denkfreiheit anregen könnte. Grundlos waren solche Befürchtungen nicht, denn während der Revolution gab es massenhaft Schulstreiks und Studentendemonstrationen – mindestens 50 Oberschüler wurden getötet und 262 verwundet –, und nach Wiederherstellung der Ordnung wurden an die 20.000 Lehrer entlassen.81 In der Folge überwachte das Regime das öffentliche Schulwesen und ging gegen alles vor, was nach Aufruhr aussah. Ein Dekret von 1911 zur Grundschulbildung ließ wissen: „Grundschulen sollen den Schülern religiöse und moralische Erziehung vermitteln, in ihnen die Liebe zu Russland anfachen, ihnen das Grundwissen beibringen und ihre geistige Entwicklung ermöglichen.“83