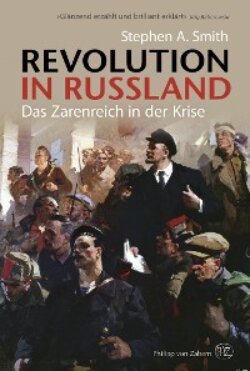Читать книгу Revolution in Russland - Stephen Smith - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Reformaussichten
ОглавлениеBeherrschendes Thema im Jahr 1905 war nicht der Sozialismus, sondern die Frage der Staatsbürgerschaft. Unabhängig von den Rechten und Pflichten, die ihnen durch den gesellschaftlichen Stand, in den sie hineingeboren waren, zukamen, bestanden Bürger, so war die Vorstellung, auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf dem Recht, gleichermaßen am politischen Gemeinwesen mitzuwirken und in ihm vertreten zu sein. Die Frauen spielten dabei allerdings keine Rolle, obwohl einige Gruppen von Frauen aus der Mittelschicht, inspiriert vom Beispiel des Herzogtums Finnland, im Januar 1905 den Allrussischen Bund für die Gleichheit der Frauen gründeten. Ihre Stimmrechtskampagne führte jedoch zu nichts, weil politisch einflussreiche Männer wie der Führer der Kadetten, Pawel Miljukow, es ablehnten, sie zu unterstützen.7
Auch für Bauern und Arbeiter war diese ihrem Wesen nach liberale Auffassung von Staatsbürgerschaft wichtig, doch sahen sie bürgerliche und politische Rechte untrennbar an soziale Rechte gekoppelt. Zudem waren individuelle Rechte von den kollektiven Rechten auf Selbstverteidigung und Subsistenz nicht zu trennen. Während für die Gebildeten Privateigentum das Fundament der Staatsbürgerschaft war, konnte sie nach Ansicht der arbeitenden Bevölkerung als integrales Ganzes von bürgerlichen, politischen und sozialen Rechten nur im Rahmen einer tiefgreifenden Restrukturierung der gesellschaftlichen Ordnung verwirklicht werden, wozu vor allem die Landreform gehörte.8 Ungeachtet dieser entscheidenden Differenz wurde der Begriff der Staatsbürgerschaft in einer neuen Vorstellung von nationaler Identität verankert.
Der 1905/06 geführte „gesamtnationale“ Kampf um die Staatsbürgerschaft hatte zum Ergebnis, dass eine russische nationale Identität nur noch von Konservativen an die von Nikolaus I. vertretene Formel Orthodoxie, Autokratie und Nationalität geknüpft wurde. Sonst aber verstand man darunter die Mitgliedschaft in einer umgrenzten politischen Gemeinschaft, die im Interesse ihrer Mitglieder regiert werden sollte.9 Dies brachte die Ausweitung bürgerlicher und politischer Rechte auf die Nicht-Russen im Reich mit sich, doch blieb die Konzeption der nationalen Identität als Fundament der Rechte implizit an das Imperium gebunden: Die Russen, so wurde unterstellt, hatten die zivilisatorische Mission, den Nicht-Russen den Fortschritt zu bringen. Wie wesentlich russisch diese Konzeption war, zeigte sich in aller Deutlichkeit, als es darum ging, dem aufstrebenden Nationalismus der Nicht-Russen zu begegnen, nicht zuletzt dem der Muslime. Liberale und sogar sozialistische Auffassungen neigten dazu, muslimische Forderungen nach politischer Vertretung als Symptome von Fanatismus und Ignoranz abzutun.
Die Zeit zwischen 1907 und 1914 wurde von Zeitgenossen als „Jahre der Reaktion“ bezeichnet, doch heben heutige Historiker eher die positiven Entwicklungen dieser Periode hervor, die, so die generelle Ansicht, in der Stärkung der „Zivilgesellschaft“ resultierten. Gemeint ist damit eine Sphäre bürgerlichen Lebens, in der die „Öffentlichkeit“ ihre Aktivitäten auf eine vom Staat nicht kontrollierte Weise entfalten konnte. Die Ursprünge dieser Sphäre reichen bis in die Regierungszeit von Katharina der Großen (1762–1796) zurück, doch nach 1905 entwickelte sich der öffentliche Raum zu bislang ungekannter Größe und Vielfalt. Es breiteten sich Freiwillige Gesellschaften und politische Parteien aus, Pressewesen und Lesepublikum wuchsen beträchtlich, neue Formen kommerzieller Unterhaltung entstanden.10 Das von Historikern in den letzten zwei Jahrzehnten bekundete Interesse an diesen Entwicklungen hat eine seit langem währende Auseinandersetzung zwischen zwei Lagern neu eröffnet. Das eine Lager geht davon aus, dass Russland sich in der Zeit nach 1905 von der Revolution entfernte, wobei die eher evolutionär verlaufende Entwicklung durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs abgebrochen wurde, während das andere Lager die Auffassung vertritt, dass die Reformenergien sich 1914 erschöpft hätten und es im Vorfeld des Kriegs bereits Zeichen für eine revolutionäre Krise gegeben habe. Obwohl man diese Debatte nicht umgehen kann, ist es vielleicht erhellender, ihrem „Entweder-Oder“ zu widerstehen und die Betonung auf die Widersprüchlichkeit und Vielschichtigkeit der Geschehnisse in der Zeit nach 1905 zu legen. Die in dieser Periode sich vollziehenden Entwicklungen waren nicht nur an die vom Oktobermanifest ausgehenden politischen Reformen und die Heraufkunft der Zivilgesellschaft geknüpft, sondern verbanden sich auch mit dem raschen Wandel wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Bedingungen, die nicht im Gleichschritt mit der Regierungspolitik marschierten und die man besser begreift, wenn man sich der eben geschilderten Alternative entzieht und nicht fragt, ob Russland sich von der Revolution absetzte oder dem Abgrund entgegeneilte.11
Viele Jahrzehnte lang konzentrierte sich die Auseinandersetzung zwischen Optimisten und Pessimisten auf die Dritte Duma und die Aussicht auf eine Zusammenarbeit zwischen dem neugewählten Parlament und der Monarchie, sodass das Reich auf den Weg friedlicher Modernisierung gebracht werden könnte. Anders als ihre Vorgängerinnen hatte diese Duma die ganze Wahlperiode lang Bestand, wobei ihre Beständigkeit sich einem einfachen Mittel verdankte: Die Zahl der parlamentarischen Vertreter von Nicht-Russen, Bauern und Arbeitern wurde zugunsten der Repräsentanten von Großgrundbesitzern und Geschäftsleuten erheblich verringert. Die Revolution von 1905 hatte das Bewusstsein des Adels schwer erschüttert. Angesichts des Aufruhrs in der Bevölkerung und eines nicht-russischen Nationalismus ging der Adel von verschwommenem Liberalismus zu unversöhnlichem Konservatismus über. 1906 leisteten Adlige ihren eigenen Beitrag zur Zivilgesellschaft und gründeten eine Interessenvertretung, den Vereinigten Adel. Die Lobbyarbeit dieser Gruppe zielte darauf, die Zahl der Repräsentanten der unteren Klassen in der Duma zu reduzieren, wobei sie Erfolg hatte. Außerdem beherrschte der Adel den Staatsrat, der im Oktober 1905 in eine Art Oberhaus der Duma umgewandelt worden war. Die Adelsvertreter nutzten diese Macht, um bestimmte Gesetzesvorhaben des „Unterhauses“ zu blockieren, so etwa die Ausweitung der Semstwos in den westlichen Provinzen, die Demokratisierung der Gerichtshöfe und des Bildungs- und Erziehungssystems sowie rechtliche Garantien für nicht-orthodoxe Glaubensrichtungen. Weil die Reform der lokalen Regierungen unterblieb, konnten Provinzgouverneure, Polizei und Verwaltung so weitermachen, wie sie es seit 50 Jahren gewohnt waren. Dieses Versäumnis der Duma kann jedoch nicht dem Staatsrat zur Last gelegt werden, denn sie hatte durch ihre internen Streitigkeiten die Aussicht auf politische Reformen selbst verbaut.
Stolypin begann sein Amt als Ministerpräsident in der festen Absicht, mit der Duma zusammenzuarbeiten, um Reformen zu bewirken, die die Erneuerung der sozialen Stabilität unterstützen sollten, und seine Agrarreformen wurden nach und nach in Gesetzesform verabschiedet. Die Oktobristen waren für Stolypins Unterstützung in der Duma der Drehund Angelpunkt, doch spalteten sie sich zunehmend in zwei Fraktionen auf, deren eine den Kadetten und deren andere den Nationalisten (einer im Oktober 1909 gegründeten Partei) nahestand. Insbesondere wurde Stolypins Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit der Duma durch seinen eigenen Machtinstinkt, durch Intrigen der Rechten und durch die ausbleibende Unterstützung seitens des Zaren geschwächt. Seinem Nachfolger, W. N. Kokowzow, fehlte Stolypins Energie und Vision, weshalb es ihm nicht gelang, in der Duma ausreichende Kräfte zur Unterstützung zu mobilisieren, und die Beziehungen zwischen Oktobristen und Nationalisten waren irgendwann völlig festgefahren. Insgesamt war die Duma in ihrer Gesetzgebung nicht besonders eindrucksvoll und als Instrument zur Transformation des politischen Systems ein klarer Fehlschlag.12
Blicken wir jedoch auf die Beziehungen zwischen Duma und Regierung von einem weniger institutionellen Standpunkt aus, ist ihre Unfähigkeit zur Zusammenarbeit nicht so einfach zu erklären. Eigentlich hätte die Ausweitung einer modernen Version russischer nationaler Identität zu einem festen Bündnis zwischen der Regierung und einem Großteil der gebildeten Öffentlichkeit führen können, und sei es auch nur aufgrund oberflächlicher Einigkeit über außenpolitische Fragen. Die Revolution stärkte eine Konzeption lebendiger Kräfte der Nation, die nicht mehr eng an den Staat gebunden war; dennoch bezweifelte die liberale Opposition nie, dass der russische Staat gegen Bedrohungen von außen (wie auch gegen die drängenden Forderungen der nicht-russischen Völkerschaften) verteidigt werden müsse.13 Hinsichtlich der Außenpolitik unterstützten weite Kreise der meinungsbildenden Eliten die Entschlossenheit der Regierung, Russlands Abstieg als Großmacht – sichtbar in der Niederlage gegen Japan, der Annektion Bosniens durch Österreich und, demnächst, der Hilflosigkeit angesichts der Balkankriege – aufzuhalten und schließlich, so hoffte man, in neue Stärke umzukehren.
Die hauptsächliche Bedrohung war natürlich durch ein auf Expansion bedachtes Deutschland gegeben, und dies vor allem in Südosteuropa, wo das deutsche Reich aus strategischen und wirtschaftlichen Gründen mit dem osmanischen Reich zusammenarbeitete. Das manifestierte sich in Projekten wie dem Bau der Eisenbahnlinie Berlin–Bagdad (1903), in aggressiven Waffenverkäufen durch die Firmen Krupp und Mauser und in diversen preußischen Militärmissionen. Deutschlands Expansionsgelüste ängstigten die russischen Eliten, und die Presse verlieh diesen Ängsten politisches Gepräge. Die konservative Zeitung Nowoje Wremja (Neue Zeit) riet zum festen Bündnis mit Frankreich und Großbritannien, und das weitverbreitete liberale Blatt Russkoje Slowo (Das russische Wort) schlug in dieselbe Kerbe, warnte aber vor Chauvinismus. Das erschwerte diplomatische Bemühungen, die Spannungen im Verhältnis zu Deutschland abzubauen.14
Natürlich gab es auch größere Differenzen in den Eliten selbst, vornehmlich zwischen einer lautstarken Lobby von Panslawisten und kühleren Köpfen wie Stolypin und Miljukow, die vor der Gefahr eines Krieges warnten. Doch alle stimmten darin überein, dass es Russlands historischer Auftrag sei, seinen Status als Großmacht zu bewahren, und so fanden die Bemühungen, die russischen Interessen auf dem äußerst instabilen Balkan ungeachtet des Kriegsrisikos voranzutreiben, breite Unterstützung. Kadetten, Oktobristen und Nationalisten traten gleichermaßen für den massiv betriebenen Aufrüstungskurs der Regierung ein, der zwischen 1909 und 1913 etwa ein Drittel des Haushalts für die Ausweitung von Marine und Heer verwendete. Damit übertraf Russland sogar Großbritannien, das schließlich ein weitgespanntes Imperium schützen musste.15 Die Aufwendungen für die Marine kamen zwar nicht an die Ausgaben von Deutschland und Großbritannien heran, doch die Kosten der Aufrüstung des Heeres waren weitaus größer.16
Hinsichtlich der Innenpolitik war „Einiges und Unteilbares Russland“ ein Symbol, um das sich ein Großteil der Eliten scharen konnte, auch wenn manche Politiker wie etwa Miljukow gegenüber den Nicht-Russen eine weniger chauvinistische Politik befürworteten als dies der „Vereinigte Adel“ tat.17 Das zeigte sich in weitverbreiteter Furcht vor panturkischen und panislamischen Bestrebungen, und ebenso in der Reaktion der Duma auf eine Reihe konservativer Maßnahmen zur Begrenzung des wachsenden nicht-russischen Nationalismus: Die Duma reduzierte die Befugnisse finnischer Institutionen, unterstützte Siedler in Zentralasien, die sich das Weideland der Nomaden aneigneten, verstärkte antijüdische Maßnahmen und machte im September 1913 aus der zum Königreich Polen gehörenden Region Chełm (Kholm) eine „wahrhaft russische“ Provinz. Diese Vorgehensweise erzürnte polnische Nationalisten wie Roman Dmowski. Die Duma unterstützte auch Stolypins Vorschlag, die Semstwos auf die westlichen Provinzen auszudehnen, was, ungeachtet seines Plans, Wählerversammlungen die Nationalität zugrundezulegen und nicht den sozialen Status, ein Trick war, um russische Interessen zu schützen. Tatsächlich konnte sich die Duma für eine polnische Vertretung nur mäßig und für eine jüdische überhaupt nicht erwärmen.18
Und in der Außenpolitik unterstützten die Eliten, trotz tieferer Meinungsverschiedenheiten zwischen Duma, Staatsrat und Ministern, auf breiter Front eine imperiale Version der russischen Identität. Es war der Zar selbst, der ein übergreifendes Identitätsgefühl, unter dem Duma und Regierung sich hätten einigen können, verhinderte, denn er wollte nicht dulden, dass die Duma sich um Dinge wie Verteidigung und Außenpolitik kümmerte – um Bereiche, die vom Grundgesetz her sein Vorrecht blieben.19
Wenn wir jedoch den Blick vom Taurischen Palais, dem Sitz des neuen Parlaments, abwenden, sind die Aussichten für Russland erfreulicher, denn es war eine Periode vieler unterschiedlicher Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeit, und eine Zeit raschen kulturellen und sozialen Wandels. Häufig gelten die Jahre nach 1905 jetzt als die Zeit, da Menschen aus allen Schichten die neuen, vom Oktobermanifest gewährten Möglichkeiten – Gewissens-, Rede-, Versammlungs-, Vereinigungs- und Religionsfreiheit – zu nutzen gedachten. Berufsverbände von Ärzten, Anwälten und anderen Professionen wurden aktiver, Universitäten vergrößerten sich, politische Parteien wurden gegründet. Die meisten dieser Freiberufler lehnten das Familienleben alten Stils ebenso ab wie die Unterordnung der Frau und die Herrschaft der Polizei und setzten im Kampf gegen kommunale Überwachung und die Tyrannei der Tradition auf Bildung und soziale Reformen. So war ihnen das autonome Individuum ein Ideal, dennoch lehnten sie das Streben der Bürger der westlichen Nationen nach Eigennutz und Selbstverwirklichung ab.20 Um 1900 gab es in Russland bereits an die 10.000 Freiwillige Vereinigungen, die sich nun fast explosionsartig in so unterschiedlichen Bereichen wie Wissenschaft und Bildung, Landwirtschaft, Wohlfahrt, Sport oder Lokalgeschichte ausbreiteten. Damit ging eine Stärkung der Zivilgesellschaft und möglicherweise auch eine Verminderung von Staatsmacht einher. Allerdings waren die meisten dieser Vereinigungen vom Staat als rechtmäßig anerkannt. Überdies fielen ihre Initiativen auf manchen Gebieten – z.B. Gesundheitsförderung, Popularisierung der Wissenschaft, Verbreitung von Bildung, Förderung des Patriotismus – mit entsprechenden Projekten der Regierung zusammen.21
Des Weiteren zeigte sich die Entwicklung einer öffentlichen Sphäre in der schnellen Ausbreitung des Presse- und allgemeinen Publikationswesens, die durch eine großzügiger gehandhabte Zensur erleichtert wurde. 1913 war Russland der zweitgrößte Buchproduzent der Welt und lag in der Anzahl der veröffentlichten Titel nur knapp hinter Deutschland.22 Die Zeitungen wollten aktiv auf die öffentliche Meinung einwirken, und die Minister waren gezwungen, ihre Politik via Presse zu rechtfertigen. Da das Lesepublikum so schnell wie beständig wuchs, die Einnahmen durch Anzeigen stiegen, neue Technologien die Bebilderung verbilligten und ein neues Massenpublikum für Sensationsmeldungen empfänglich war, erlebte das Pressewesen einen ungeheuren Boom. Die Lesefähigkeit nahm zu, und die Leser verschlangen Abenteuergeschichten, Detektivromane, romantische Literatur, die insgesamt für die Ausbreitung von eher säkularen, rationalen und kosmopolitischen Anschauungen sorgte und den Individuen das Gefühl gab, sie könnten für ihr Leben selbst verantwortlich sein.23
Die Gazeta Kopejka (soviel wie „Groschenblatt“) war eine in St. Petersburg gedruckte Boulevardzeitung, die auf die Leser unterer Schichten ausgerichtet war. 1909 hatte sie eine verkaufte Auflage von 250.000 Exemplaren, was für die damalige Zeit sehr viel war. 1911 gab es bereits 29 solcher Groschenblätter.24 Sie suchten die Aufmerksamkeit der Leser durch Sensationsnachrichten wie etwa Verbrechensgeschichten, die bisweilen mit Holzschnitten illustriert waren, zu erregen, dazu gab es Anzeigen für alle möglichen Konsumgüter. Zugleich wollten die Journalisten mit diesen Zeitungen die unteren Klassen in die Öffentlichkeit hineinführen, indem sie ehrliche Arbeit, individuelle Wahl und sozialen Aufstiegsehrgeiz als positive Werte darstellten.25
Die Ausbreitung der Boulevardblätter gehörte zum Wachstum einer Konsumentenkultur, die insgesamt auf die einkommensschwächeren Schichten zielte. In den Städten entwickelten sich neue Arten der Freizeitgestaltung mit kommerziellen Unterhaltungsmöglichkeiten wie etwa Lustgärten, Variétés, Volkstheatern, Stummfilmkinos und Detektivromanen, alles zu für die Massen günstigen Preisen. Diese Kulturprodukte brachten den vom Lande kommenden bäuerlichen Arbeitsmigranten eine neue Welt von Charakteren und Geschichten nahe. Die Historikerin Louise McReynolds bemerkt dazu: „Rüder Widerstand gegen Obrigkeiten, die raubtierhafte Sexualität von Goldgräbern, sogar die geschärfte ethnische Aufmerksamkeit der Stadtbevölkerung – all dies waren neue Erfahrungen, die Charaktere mit bis dato unbekannten Motiven ausstatteten. Die Persönlichkeit wurde zum Fokus und Antriebsrad der Narrative.“26 Insgesamt zielt ihre Argumentation in diesem Abschnitt darauf, dass die Massenkultur dazu tendierte, Vorstellungen von gesellschaftlicher Ordnung zu entpolitisieren, Klassenkonflikte in den Hintergrund zu drängen und jene Werte der Mittelschichten, die den sozialen Zusammenhalt förderten, positiv hervorzuheben. Das war sicher ein Effekt der Konsumentenkultur, doch sollten wir daraus nicht schließen, dass sie die Bildung klassenbezogener Identitäten verhinderte.
In den Städten war der traditionelle Einzelhandel noch die Regel; die große Mehrheit der Bevölkerung kaufte ihre Waren auf Märkten oder Messen. Doch das hell erleuchtete Kaufhaus mit seinen Werbetafeln, der luxuriösen Inneneinrichtung, den modisch bestückten Schaufenstern und der Vielfalt an Konsumgütern regte die Phantasie der Stadtbewohner an. Das Kaufhaus war das Symbol par excellence der Konsumentenkultur: Es verwendete Güter und Werbebilder, um die Konsumenten – hauptsächlich Konsumentinnen – zu modischer Einstellung und gutem Geschmack zu erziehen, das Kaufverlangen zu fördern und Phantasievorstellungen vom Konsumüberfluss auszulösen. Das Kaufhaus war vor allem ein Ort, wo das Bürgertum lernte, sich zu kleiden, das Heim auszustaffieren und die Freizeit angemessen zu verbringen. Aber auch die unteren Schichten wurden angesprochen: Sie lernten etwas über die Tagesmode, über das, was Komfort zu sein hat, über respektables Auftreten – alles gemäß den Schaufensterauslagen. Dergleichen schwappte bis aufs Land oder doch wenigstens in jene Regionen, aus denen die meisten Arbeitsmigranten kamen. Michail Isakowski, dessen Schwester von Smolensk nach Moskau gegangen war, um in einer Textilfabrik zu arbeiten, erinnert sich an ihren Stolz auf einen modischen sak – einen weit sitzenden Mantel, der von den Schultern in Falten herabfiel:
„Frauen sparten, weil man unbedingt einen sak haben musste. Wer keinen hatte, fühlte sich der Rechte beraubt, nicht wirklich wertgeschätzt, im Abstieg begriffen. Die Arbeiterinnen redeten endlos davon, einen sak zu kaufen. Und wenn sie ihn gekauft hatten, schrieben sie sofort ans Dorf, um jedem zu sagen, dass der lang ersehnte sak gekauft wurde.“27
Die Arbeitsmigranten brachten bei ihrer Rückkehr ins Dorf neu erworbenen Geschmack an Kleidung, Einrichtung und Ernährung sowie billige Gebrauchsgüter mit. Durch den Erwerb von modischer Kleidung, Samowaren oder Lampen verbreiteten sich bestimmte Vorstellungen von Respektabilität, während Intellektuelle und Geistliche schon bald „nutz- und geschmackloses Dandytum“ verurteilten. Entscheidend für die Frage, wohin Russland auf dem Weg war, ist jedoch die Tatsache, dass die Werte der Konsumentenkultur klassenübergreifend Fuß gefasst hatten. Von dieser Kultur waren sowohl die unteren Mittelschichten wie auch die „respektablen“ Schichten der Arbeiterklasse ergriffen worden, und darin lag das Potential für die Bildung eines Individualismus, der dem Klassenbewusstsein zuwiderlief.
Der Historiker Wayne Dowler geht davon aus, dass „marxistische Intellektuelle nur wenig Einfluss auf die Kultur, die Werte und Ziele der Mehrheit der Arbeiter hatten. Die Dynamik des Stadtlebens verschaffte den Industriearbeitern Möglichkeiten, in einer vielgestaltigen Umwelt mit anderen sozialen Gruppen in Interaktion zu treten … Die Alphabetisierung der Arbeiter machte Fortschritte und begünstigte ihren Zugang zu Groschenblättern, zum Film und anderen kommerzialisierten Kulturangeboten, was wiederum zu ihrer Assimilierung an die Werte und die Kultur des Mainstream führte.“28 Zweifellos war die arbeitende Bevölkerung mehr als bereit, sich auf die Konsumkultur einzulassen und etwa in Fragen der Kleidung Mode über Nützlichkeit zu stellen. Unverheiratete Arbeiterinnen gaben ca. ein Fünftel ihres Einkommens für Kleidung aus, wobei viele noch Näherinnen bezahlten, damit sie die neueste Mode aus entsprechenden Magazinen kopierten.
Auch junge Männer lernten, dass gut gekleidet sein die Selbstachtung förderte und einem den Respekt von Seinesgleichen eintrug. Der junge Semjon Kanatschikow, der gerade neu in die Stadt gekommen war und schon bald Bolschewik werden sollte, kaufte sich Urlaubskleidung, eine Uhr und für den Sommer einen breiten Gürtel, graue Hosen, einen Strohhut und modische Schuhe. „Mit einem Wort, ich kleidete mich nach Art jener jungen städtischen Metallarbeiter, die ihr eigenes Geld verdienten und nicht ihre Gesundheit mit Wodka ruinierten.“29 Natürlich half es auch, sich modisch zu kleiden, wenn man einen attraktiven Sexualpartner suchte. In den Landkreisen Soligalitsch und Tschuchlomski, die zur Provinz Kostromo gehörten, bevorzugten die dortigen Frauen Männer, die in St. Petersburg gelebt hatten. Sie waren nämlich „um einiges kultivierter als die Männer hierorts; in ihrem Gespräch waren sie häufig nicht von einem Stadtbewohner zu unterscheiden, zudem geschmückt mit phantasievollen Ausdrücken; ihr Benehmen war dem großstädtischen Kleinbürgertum abgeschaut; sie konnten tanzen und trugen geschniegelte Anzüge“.30
Dennoch ist, wie das Beispiel von Kanatschikow zeigt, bei der Annahme, die Anziehungskraft der Konsumkultur habe der Entwicklung von Klassenbewusstsein notwendigerweise im Wege gestanden, Vorsicht geboten. Fotografien von Gewerkschaftsführern zeigen sie immer in städtischer, nie in bäuerlicher Kleidung: Dreiteiler, Kreissäge, Spazierstock, Lederschuhe.31 Das Vergnügen, das der Kauf neuer, reizvoller Dinge bereitete oder das mit neuen Formen kommerzialisierter Freizeitbeschäftigungen verbunden war, besaß wohl das Potential, den sozialen Zusammenhalt zu fördern, doch war dergleichen bestenfalls provisorisch und konnte von gegenläufigen Kräften leicht blockiert werden. Die Mühseligkeiten des Arbeits- und Alltagslebens gemahnten die Arbeiterschaft an ihren untergeordneten Status in der Gesellschaftsordnung. Dem konnte man zumindest zeitweise entfliehen, wenn man am Sonntagnachmittag einen Abenteuerroman las oder sich schick anzog.
Betrachten wir den Komplex „Arbeit“ näher, begreifen wir, dass es zwar nach 1905 ein Potential für Reformen gab, die Möglichkeiten aber vom Regime selbst zunichte gemacht wurden. Im Juni 1906 wurden Gewerkschaften gesetzlich zugelassen und Streiks teillegalisiert. Anfang 1907 hatten sich bereits 300.000 Arbeiter in Gewerkschaften organisiert, in manchen Berufen mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte.32 In Westeuropa und den USA hatten die Gewerkschaften die Funktion, den Einfluss der Arbeiterschaft in Industrie und Politik auszuweiten und sie zugleich in die kapitalistische Ordnung zu integrieren. In Russland dagegen waren die Gewerkschaften eine radikale Herausforderung für das existierende Wirtschaftssystem. Das Gesetz über die Gewerkschaften war vage und wurde von der Polizei beaufsichtigt – die beste Voraussetzung für offiziellen Missbrauch.
Nach Stolypins Auflösung der Duma am 3. Juni 1907 wurde die Gewerkschaftsbewegung durch polizeiliche Repression im Verein mit einer Wirtschaftskrise schnell untergraben. Zwischen 1906 und 1909 wurden 350 Gewerkschaften dichtgemacht, weiteren 500 wurde die Registrierung verweigert. Dennoch hatte die Revolution den Arbeitern einige Vorteile gebracht: Die Arbeitszeit in den industriellen Großbetrieben wurde bis 1913 um acht Prozent reduziert, und der durchschnittliche Jahresarbeitslohn lag, nach dem Nomalwert gerechnet, in diesem Jahr 36 Prozent höher als 1904.33 Die Unternehmer trugen das ihre dazu bei, Gewerkschaften zu unterdrücken und jeglicher Modernisierung der Arbeitsverhältnisse Widerstand entgegenzusetzen. Besonders in St. Petersburg unternahm die Gesellschaft der Fabrik- und Werksbesitzer den energischen Versuch, die Arbeitsprozesse zu rationalisieren, ohne das autokratische System der Arbeitsverhältnisse aufgeben zu müssen.34 Bemühungen, den Arbeitsschutz auszuweiten, wurden von der Industriellenlobby torpediert (sie schaffte es, den Beitrag der Arbeitgeber zur Sozialversicherung zu reduzieren), doch im Januar 1912 verabschiedete die Duma ein Gesetz, das eine Unfall- und Krankenversicherung vorsah, und der Staatsrat bestätigte es nach dem Massaker an der Lena (das im Abschnitt „Am Vorabend des Krieges“ erörtert wird).
Gerade das enge Verhältnis der Regierung zu den Arbeitgebern verhinderte die Trennung ökonomischer von politischen Konflikten, die im Westen vorherrschte und die Integration der Arbeiterschaft in das kapitalistische System erleichterte. In Russland aber sah es so aus, dass Staat und Kapital einen Gesamtmechanismus von Ausbeutung und Herrschaft darstellten. So kam es, dass der Widerstand der Arbeiter häufig nicht gegen das Kapital als solches gerichtet war, sondern gegen den Vorarbeiter, der sich als Herr und Meister aufspielte, oder gegen die Polizei und die Kosaken. Im sogenannten „autokratischen Kapitalismus“ floss die Kritik an den Schattenseiten des modernen Kapitalismus – ungleiche Verteilung von Lohn und Profit, Stumpfsinn der mechanisierten Arbeitsprozesse – mit „traditionelleren“ Vorbehalten und Erinnerungen an das Dorfleben zusammen.35 So könnte die hierarchische Ordnung der Fabrik vor dem Hintergrund der „Leibeigenschaft“ gesehen werden, was heißt, dass in bestimmten Aspekten von Beziehungen in der Arbeitswelt, etwa wenn der Vorarbeiter oder Aufseher die Arbeiter nicht mit dem höflichen „Sie“ anredete, die Willkür des politischen Systems insgesamt widerhallte. Der gleichzeitige Widerstand gegen Staat und Kapital fand in Begriffen wie „Willkür“, „Rechtlosigkeit“ und der Verweigerung von „Würde“ konzentrierten Ausdruck.
Andererseits gab es natürlich auch immer noch Arbeiter, die von Unternehmern und Regierung paternalistischen Schutz erwarteten und sich, wenn dieser ausblieb, betrogen fühlten. Die Vorstellung, der autokratische Kapitalismus habe die Arbeiter „revolutionär“ gemacht, ist irreführend – man erinnere sich der endlosen Klagen über die Servilität der „zurückgebliebenen“ Massen –, aber die Kombination der elementaren Energie der bäuerlichen gewalttätigen Empörung (russisch bunt) mit den tagtäglich frustrierenden Mechanismen kollektiver Arbeitsorganisation war hochexplosiv. Zudem äußerten sich die Beschwerden über wirtschaftliche und politische Missstände zunehmend in der Sprache von Klassenkampf und Sozialismus, was erheblich zur Militanz der Arbeiterschaft beitrug. Nirgendwo in Europa war die Intensität der Streikbewegung so hoch: In den Hochzeiten, den Jahren 1905/06 und 1912/14 waren durchschnittlich pro Jahr fast drei Viertel der Industriearbeiter an Streiks beteiligt.36 Und diese Streiks konnten, wie wir sahen, leicht eine politische Dimension gewinnen.
Schließlich lässt sich zeigen, wie ein Problem, das 1917 in den Vordergrund treten sollte, sich bereits 1905/06 abzeichnete, nämlich das der „Kontrolle“ der Arbeiter über das Management. Vor allem in der Druckindustrie verbreitete sich die Vorstellung von einer „Arbeiterselbstverwaltung“, aber auch in anderen Branchen begannen die Vertretungen der Arbeiterschaft auf Betriebsebene auf die Rechte des Managements überzugreifen. Sie forderten die Aufsicht über Einstellungen und Kündigungen, über die Berufung von Verwaltungspersonal oder über die Verhängung von Geldstrafen. Ging es zunächst um die Kontrolle über innerbetriebliche Vorgänge, wurde 1917 das soziale und politische Leben insgesamt einbezogen. Hier trat die Klasse selbst fordernd auf, und das war für den Kapitalismus eine viel direktere Konfrontation als die Auseinandersetzung um die Staatsbürgerschaft. Doch zunächst gab es zwischen den sozialistischen Ideen („Klasse“) und den liberalen Vorstellungen („Staatsbürgerschaft“) noch nicht jene Divergenzen, wie sie später unter der Provisorischen Regierung auftreten sollten.
Zwischen 1905 und 1907 erfuhr die sozialistische Bewegung ein rapides Wachstum. Die Bolschewiki arbeiteten auf einen bewaffneten Aufstand hin, um das Regime zu stürzen, hatten aber 1905 weniger Einfluss auf die Arbeiterbewegung als die Menschewiki, die eifrig damit beschäftigt waren, Streiks, Gewerkschaften und Sowjets zu organisieren. Die Spaltung zwischen beiden Gruppierungen war an der Basis keineswegs so tief wie häufig angenommen, aber allgemein lässt sich sagen, dass die Bolschewiki zäher, kühner, disziplinierter, intoleranter, selbstbewusster, amoralischer, gewaltbereiter waren als die Menschewiki. Diese gingen bedachtsamer und vorsichtiger vor, neigten zu zögerndem Verhalten, schätzten die Demokratie und lehnten allzu einfache Slogans ab. Zwischen 1906 und 1907 wuchs die SDAPR, weil die Bolschewiki stärker wurden. Im Frühjahr 1907 hatten sie an die 58.000 Mitglieder, während es die Menschewiki auf 45.000 brachten.
Im europäischen Teil des Reichs war die Partei in der Ukraine, und dort besonders im Donezbecken, am stärksten; ferner in der zentralen Industrieregion um Moskau, in St. Petersburg und im Ural. In den nicht-slawischen Gebieten bildeten russischsprachige Mitglieder den Kern der Sozialdemokraten; eine Ausnahme war der Kaukasus. Auf dem Vierten Kongress der SDAPR schlossen sich die Sozialdemokraten Litauens und Lettlands sowie die vom Jüdischen Bund der russischen Partei an, die im Frühjahr 1907 über 150.000 bis 170.000 Mitglieder zu verfügen behauptete.37 Das hört sich nur so lange beeindruckend an, bis man sich daran erinnert, dass der Bund des russischen Volkes und andere rechtsradikale Organisationen im selben Jahr eine Mitgliederzahl von 410.000 behaupteten (wobei manchmal ganze Familien als Mitglieder gezählt wurden). Auch sie waren in der Ukraine und in Bessarabien stark.38
Insbesondere sollten die Zahlen für die Bolschewiki und Menschewiki cum grano salis genommen werden. Die Unterschiede zwischen den beiden Fraktionen der SDAPR traten in den Städten hervor, doch in den meisten Provinzzentren gab es diese Gruppierungen gar nicht, oder sie waren bereit, einander in einer einzigen Organisation gegenseitig zu tolerieren. In großen Teilen Sibiriens, im Ural und in Teilen der Ukraine blieben die meisten sozialdemokratischen Organisationen „vereint“. Und viele der abstrusen, jedoch tödlichen Auseinandersetzungen, die die Parteiführung spalteten, fanden in der Parteibasis keinen Widerhall. Eine mögliche Ausnahme bildete der „Liquidationismus“, d.h. die Auffassung, dass die SDAPR (und die Sozialrevolutionäre) ihre im Untergrund arbeitenden Organe auflösen („liquidieren“) und nur noch im Rahmen der Legalität arbeiten sollten. Die wohl stabilsten sozialdemokratischen Organisationen waren der Jüdische Bund sowie die Parteien Lettlands und Georgiens, wo nationalistische Impulse den Sozialismus verstärkten – ein Gesichtspunkt, der in den ideologischen Themen, von denen Lenin besessen war, keine große Rolle spielte. Es ist klar, dass staatliche Unterdrückungsmechanismen, nicht zuletzt durch polizeiliche Infiltration, ab 1908 mit großer Wirksamkeit die Vernichtung sozialdemokratischer Organisationen betrieben, deren Führer verhaftet oder ins Exil getrieben und Aktivisten zum Stillhalten gezwungen wurden. Zehntausende Mitglieder mussten auf parteiliche Aktivitäten verzichten. 1908 gab es 260 sozialdemokratische Organisationen, 1911 nur noch 109.39
Die Sozialrevolutionäre wuchsen während der Revolution zur größten linken Partei heran, deren Mitglieder sich aus allen Klassen rekrutierten. 1907 verfügten die Sozialrevolutionäre über 287 Organisationen mit 60–65.000 Mitgliedern und einem weiten Umkreis von um die 300.000 Sympathisanten.40 Vor allem auf dem Lande hatten sie Erfolge zu verzeichnen, aber auch bei Fabrikarbeitern, Soldaten und Matrosen, Lehrern, Sanitätern, Agronomen und vielen anderen. Ihren Ersten Kongress hielten die Sozialrevolutionäre im Dezember 1905 ab, wo sie es ablehnten, die Forderung nach der sofortigen Übernahme von Großgrundbesitz zu unterstützen. Andererseits verpflichteten sie sich, die politische Revolution durch bewaffneten Aufstand herbeizuführen. Allerdings besaß das Zentralkomitee keinen großen Einfluss auf die Organisationen in der Provinz, und die Sozialrevolutionäre, die selbst zu ihrer besten Zeit eine sehr lockere Koalition gewesen waren, wurden bald durch tiefgreifende politische Spaltungen geschwächt. Auf der extremen Rechten trennten sich die den Kadetten nahestehenden „Volkssozialisten“ (Narodno Sozialistitscheskaja Partija) 1906 von der Partei, und auf der extremen Linken waren die „Maximalisten“, einige tausend Arbeiter, Studenten und Angestellte mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren, kaum von den Anarchisten zu unterscheiden. Sie führten Anschläge durch, forderten massenhaften Terror und die sofortige Errichtung einer „Arbeiterrepublik“. 1909 tauchte am rechten Flügel der Partei eine Gruppe von Alt-Narodniki auf, allen voran E. K. Breschko-Breschkowskaja, die „Großmutter der Revolution“. Sie forderte die sofortige Einstellung der Untergrundtätigkeiten zugunsten der Arbeit in den legalen Organisationen der Arbeiterschaft, in den Kooperativen und den Semstwos.
Nachdem das Regime die Ordnung in der Gesellschaft allem Anschein nach wiederhergestellt hatte, machte es sich ab Ende 1907 daran, die Massenorganisationen der Sozialrevolutionäre – den Bauernbund, die Gewerkschaften der Eisenbahner und Lehrer sowie die meisten Kampfeinheiten – zu zerschlagen. Die zaristische Geheimpolizei Ochrana besaß mit Ewno Asef, von 1904 bis 1908 Leiter der Kampforganisation, eine Trumpfkarte, denn er fungierte als Informant. Tatsächlich gingen nur zwölf der zwischen 1902 und 1914 verübten Terrorakte auf das Konto der Kampforganisation; die anderen, mehr als 230, wurden von bewaffneten Einheiten oder Überfallkommandos verübt, die mit lokalen und Provinzorganisationen der Partei lose verbunden waren.41 Dennoch umgab die Kampforganisation eine Aura von Helden- und Märtyrertum, weshalb sie Spenden von liberalen Geschäftsleuten, jüdischen Emigranten und anderen Personenkreisen bekam. Zwischen 1908 und 1913 verminderte sich die Zahl der Organisationen der Sozialrevolutionäre von 350 auf 102, und diese existierten vor allem auf der Provinzebene.42
Trotz des gewaltigen Rückschlags für die revolutionäre Linke sollte man die Tatsache nicht übersehen, dass es Aktivisten gelang, mittels Reden, Flugblättern, illegalen Veröffentlichungen, Gewerkschaften, Fonds zur Gesundheitsfürsorge und Abendkursen ein Bewusstsein für Sozialismus zu verbreiten. In den großen Fabriken gab es mittlerweile eine Schicht „klassenbewusster“ Arbeiter, von denen viele Mitglieder oder Sympathisanten der Sozialdemokraten und Sozialrevolutionäre waren und die den Kämpfen der Arbeiter eine Richtung zu geben vermochten. Es waren überwiegend in der Metallindustrie beschäftigte junge Männer, die durch Selbststudium, Disziplin und kämpferisches Verhalten ihr Los und das ihrer Arbeitskollegen zu verbessern suchten. Für sie war der Marxismus, der der Arbeiterklasse eine entscheidende Rolle in der geschichtlichen Entwicklung zuwies, besonders anziehend. Andere glaubten an den Auftrag des „hart arbeitenden Volkes“, und einige wenige gehörten der Temperenzler-Bewegung an oder folgten den Lehren Leo Tolstois.
Diese „bewusste“ Minderheit sah häufig auf die sie umgebende „graue Masse“ von Arbeitern herab, die nur nach vorne schaute, um sich dem Trunk zu ergeben oder irgendwann auf ihr Stückchen Land zurückzukehren oder in der Hoffnung auf Erlösung in der nächsten Welt die Übel dieser Welt geduldig erlitt. Doch waren die „bewussten“ Arbeiter jedes Mal wieder überrascht, wenn die „grauen Massen“ zornentbrannt den Aufstand wagten.43 Diese wiederum blickten mit widersprüchlichen Gefühlen auf den „bewussten“ Arbeiter, dessen beunruhigender Einfluss lebhaft in den Erinnerungen von A. Businow beschrieben wird: „Seine äußere Erscheinung war düster abweisend, sein Blick angsterregend. Er erweckte den Eindruck, als hasste er alle Arbeiter, und so war immer ein leerer Raum um ihn, wenn er an der Werkbank stand, als wäre er von der Pest befallen.“44 Andererseits bestaunten sie diese „Studierten“ mit Ehrfurcht, bewunderten ihre Kenntnisse, ihren unbezwingbaren Mut und ihre Bereitschaft zur Selbstaufopferung, und in einer Krise sahen sie in ihnen ihre Führer.