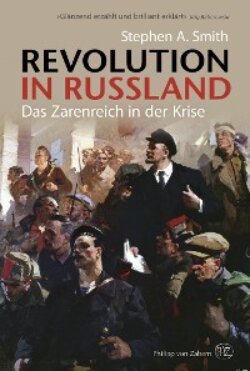Читать книгу Revolution in Russland - Stephen Smith - Страница 19
Politik und Wirtschaft
ОглавлениеBis zum Sommer 1915 dauerte die positive Stimmung nationaler Einheit an, und so blieb auch die Politik relativ ruhig. Die Regierung erkannte schnell, dass sie einiges tun musste, um die Moral der Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten, und die Unternehmer erkannten ebenso schnell, dass es jetzt eine Gelegenheit gab, Gewinne zu machen. Das Ergebnis war eine Explosion patriotischer Propaganda, die sich traditioneller wie neuer kultureller Formen bediente, darunter Postkarten, Plakate, Magazine, Holzschnitte (lubki) und Wochenschauen im Kino. Die patriotische Propaganda setzte auf Identifikation mit russischen Kriegshelden und kulturellen Persönlichkeiten sowie mit Russlands Geschichte und imperialer Geographie. Bezeichnenderweise gab es wenig Hinweise auf eine in der Bevölkerung verbreitete Begeisterung für den Zaren selbst.91 Typische Motive waren Spottschriften über den deutschen Kaiser, fotografische Abbildungen moderner Waffen, heroische Bilder von Schlachten und allegorische Darstellungen von Mütterchen Russland. Die Propaganda funktionierte klassenübergreifend. Der Oberbefehlshaber, Großherzog Nikolai Nikolajewitsch, über den die Öffentlichkeit nur wenig wusste, wurde von der Presse als jemand dargestellt, der aufgrund seiner bekannten Strenge und Religiosität (Zeitungsfotos zeigten ihn beim Betreten der Kirche im Hauptquartier der Armee) mit den artifiziellen Umgangsformen der gehobenen Gesellschaft nicht vertraut war.92
Eher abstoßende Ausdrucksformen des in der Bevölkerung verbreiteten Chauvinismus zeigten gewalttätige Angriffe auf „ausländische Feinde“. Die Angriffe richteten sich hauptsächlich gegen Deutsche und betrafen Personen wie auch Eigentum, zudem wuchs der Hass auf Juden. Hauptsächliche Triebkräfte waren rechte Gruppen, die jetzt allerdings weniger stark organisiert auftraten als noch 1906. Aber sie forderten am lautesten die Deportation von Polen und Juden, wobei sie von Teilen der Presse und aus allen Schichten der Bevölkerung Unterstützung erfuhren. Der Historiker Eric Lohr ist der Auffassung, dass die Forderung, Regierung und Wirtschaft seien von ausländischen Einflüssen zu reinigen, zu einer Kampagne gehörte, die den Staat als nationale, nicht als imperiale Größe verstanden wissen wollte.93 Allerdings währte die positive Stimmung nationaler Einheit nicht besonders lange. 1916 verlor die patriotische Propaganda zunehmend ihre Fähigkeit, die Identifikation mit der Nation bei den Frontsoldaten und den unteren Klassen in Stadt und Land zu festigen, denn bei ihnen allen wuchs die Überzeugung, dass sie allein die Kriegskosten und -lasten aufgebürdet bekamen.94
Viele Angehörige der Elite hofften, dass durch den Krieg die im Oktobermanifest versprochene Einführung einer Verfassung erneut auf die Agenda gesetzt werden würde. Schon bald jedoch erhöhten sich die Spannungen zwischen Regierung und Stawka, als die Munitionsknappheit offenbar wurde und der Galizien-Feldzug ins Stocken geriet. Sogar Minister fanden die von Nikolai Nikolajewitsch betriebene Russifizierungspolitik abstoßend. A. W. Kriwoschejn, der Landwirtschaftsminister, bemerkte: „Man kann nicht zugleich gegen Deutschland und gegen die Juden Krieg führen.“ Kriwoschejn, einer der fähigsten Minister des Zaren, wurde schon bald entlassen, weil er Nikolaus II. geraten hatte, die Haltung des Oberbefehlshabers nicht zu übernehmen. Im Juni 1915 erzwangen Gruppierungen der Duma (die zu dieser Zeit keine Sitzungen abhielt) den Rücktritt von Kriegsminister W. A. Suchomlinow, der für die Munitionskrise den Kopf hinhalten musste. Am 19. Juli erhielt die Duma die Erlaubnis zu einer erneuten Zusammenkunft, doch ihre Forderung einer Regierung, die „das Vertrauen des Volkes genießt“, wurde vom Zaren ignoriert.
Der Ruf nach einer solchen Regierung wurde nun zur Parole eines Blocks der Fortschrittlichen, gebildet von einer Mehrheit von Duma-Abgeordneten, bestehend aus Kadetten, Oktobristen und Progressiven (das waren gemäßigte Liberale). Der Block befürwortete eine politische und religiöse Amnestie sowie die Aufhebung der Beschränkungen für Nationalitäten, Konfessionen und Gewerkschaften. Diese Forderungen brachten den verärgerten Zaren dazu, die Duma am 3. September zu suspendieren, wodurch er eine Verfassungskrise hervorrief. Der Ministerpräsident, I. L. Goremykin, torpedierte Gespräche zwischen dem Block der Progressiven und dem Ministerrat, aber seine Unnachgiebigkeit verschlechterte die Beziehungen weiter. Im Februar 1916 wurde er durch B. W. Stürmer ersetzt, der den Zaren dazu bewegte, die Zusammenarbeit mit der Duma zu suchen. Doch als diese am 9. Februar wieder zusammentrat, enttäuschte Stürmer die Abgeordneten, indem er die Unmöglichkeit betonte, in Kriegszeiten eine Verfassungsreform anzustreben. Auch er blieb nicht lange auf seinem Posten, ein Wechselspiel, das als „ministerielles Bockspringen“ bekannt wurde.
Von Juli 1914 bis Februar 1917 erlebte Russland vier Ministerpräsidenten, sechs Innen-, sowie jeweils vier Justiz-, Kriegs- und Landwirtschaftsminister, ferner vier Oberprokuroren des Heiligen Synod. Bewirkt wurde das durch die zwanghafte Einmischung der deutschstämmigen Kaiserin Alexandra Feodorowna in die Angelegenheiten der Regierung. In der Bevölkerung war die Ansicht verbreitet, sie arbeite auf einen deutschen Sieg hin. Kaum zweifelhaft ist, dass sie unter dem Einfluss von Grigori Rasputin stand, dem Bauernheiligen, der, wie sie glaubte, über die mystische Kraft verfügte, ihren an Hämophilie leidenden Sohn Alexej zu heilen. Rasputin hatte keine Bedenken, seinen Einfluss zu nutzen, um sich in die Hofpolitik einzumischen, was zu Gerüchten über sexuelle Eskapaden und Verrat durch „dunkle Mächte“ am Zarenhof führte. Zwar war Rasputins Bedeutung weniger real als symbolisch, doch für viele Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, aber auch für hochrangige Militärs und Politiker wurde er zum Sinnbild für Korruption, Lüsternheit und Ausschweifung. All diese Vorstellungen führten dazu, die von Zar und Zarin so verzweifelt begehrte mythische Einheit mit dem Volk zu untergraben. Hatte um 1900 noch die große Mehrheit der Bevölkerung im Zaren das von Gott eingesetzte „Väterchen“ gesehen, war es im Februar 1917, nur noch eine Handvoll.
Unterdessen nutzte die Zivilgesellschaft die Gelegenheit, über patriotische Tätigkeiten im Umfeld des Krieges ihren politischen Einfluss zu stärken. Die Regierung begrüßte die Arbeit des Roten Kreuzes, die Hilfsorganisationen für Flüchtlinge, die Frauenverbände, die sich für Wohltätigkeit engagierten, Spendengelder sammelten und Schals und Socken für die Frontsoldaten strickten. Eine politische Herausforderung stellte das im Juni ohne Erlaubnis des Zaren gegründete Vereinigte Komitee der Semstwo- und Stadträteverbände Russlands, bekannt als „Semgor“, dar. Sein Vorsitzender, Fürst G. J. Lwow, wurde nach der Februarrevolution 1917 der erste Ministerpräsident der Provisorischen Regierung. Der Semgor widmete sich einem breiten Spektrum kriegsbedingter Aufgaben; unter anderem kümmerte man sich um die Verwundeten und organisierte den Nachschub für die Armee. Zu diesem Zweck erwarb der Semgor Materialien und beauftragte private Firmen mit der Beschaffung von Ausrüstung, Munition, Uniformen und Verpflegung.95 Im Winter 1916/17 kritisierte der Semgor die Regierung ganz offen: Sie sei zum Hindernis für den Sieg geworden.96
Im Monat der Institutionalisierung des Semgor wurde auf Initiative von Moskauer Industriellen und Kaufleuten ein Zentrales Kriegsindustriekomitee gegründet. Die Gründer waren nicht damit einverstanden, dass das Kriegsministerium zum Nachteil der kleinen und mittleren Industriebetriebe Aufträge an die großen Metall- und Maschinenbaufabriken von St. Petersburg und Südrussland vergab. Geleitet wurde das Komitee von dem Oktobristen A. I. Gutschkow, der Vorsitzender der Dritten Duma gewesen war. Die Mitglieder des Komitees bauten ein Netzwerk auf, um kriegsrelevante Aufträge an lokale Firmen zu vermitteln. Eine Neuerung war die Bildung von gewählten Arbeitergruppen: 58 waren bis Februar 1917 entstanden; zu dieser Zeit gab es 240 Kriegsindustriekomitees.97 Zwar wurden die Arbeitergruppen von den Sozialisten, die gegen den Krieg waren, boykottiert, doch scheint ihre politische Einstellung von vielen Arbeitern geschätzt worden zu sein. Sie forderten das Ende der Autokratie, wollten in der Hauptsache aber dafür sorgen, dass die Interessen der Arbeiter im Rahmen der Kriegsanstrengungen angemessen repräsentiert wurden. Sie betonten den Klassencharakter des Kriegs und forderten einen demokratischen Frieden, beharrten aber darauf, dass die Arbeiterklasse eine Niederlage Russlands nicht zulassen dürfe.98
Zwar kämpften die Komitees eifrig darum, die Kontrolle über die Versorgung der Armee den Offiziellen Händen zu entreißen, doch führte das zu keiner substantiellen Verbesserung der Nachschubsituation.99 Die Kriegsindustriekomitees erhielten nicht mehr als fünf Prozent aller kriegsrelevanten Aufträge, zudem fehlten ihnen Kredite und der Zugang zu Rohstoffen. Im Januar 1917 wurde ihnen mitgeteilt, dass sie keine weiteren Aufträge von der Regierung erhalten würden, weil sie mit der Erfüllung der bereits bestehenden im Verzug waren.100 Trotzdem war die Intervention öffentlicher Organisationen in diesen wichtigen Bereich, und das mitten im Krieg, ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr die Autorität des Zaren geschwächt war.
Allerdings war die Regierung bei der Mobilisierung der Wirtschaft für den totalen Krieg durchaus erfolgreich: 1916 betrug die Kriegsproduktion 30 Prozent der Gesamtproduktion, ein Anstieg von fünf Prozent gegenüber 1913.101 Schnell waren große Lieferbetriebe für Getreide, Fleisch, Öl und Tiernahrung eingerichtet worden, und im Mai 1915 hatte man einen Sonderverteidigungsrat gebildet, der in der Lage war, staatliche und private Unternehmen zur Erfüllung von Regierungsaufträgen zu zwingen und, falls notwendig, Direktoren zu entlassen und Privatfirmen zu schließen. Doch dies führte, wie das Kriegsindustriekomitee bemängelte, zu einer engen Beziehung zwischen dem Kriegsministerium und großen Industrie- und Finanzkonzernen, die auf Kosten der Regierung umfangreiche Gewinne einstrichen. Auf Druck der Duma ersetzte der Zar im August 1915 den Sonderverteidigungsrat durch vier Sonderräte für Verteidigung, Nahrungsmittelversorgung, Brennstoff und Transport. In ihnen waren auch Vertreter öffentlicher Organisationen tätig, aber die Zügel hielten die Minister in der Hand.102
Positive Resultate zeigten sich an bestimmten Steigerungsraten: 1917 war die Produktion von Granaten um 2000 Prozent, die von Artillerie um 1000 Prozent und die von Gewehren um 1100 Prozent gestiegen.103 Dennoch war die Situation keineswegs ermutigend: Immer wieder gab es Engpässe aufgrund von Brennstoffknappheit und Transportproblemen, und 1916 wurden Kohle, Eisen und Stahl knapp.104 Wichtiger noch waren die Kosten, die der unersättliche Appetit der Kriegsmaschinerie verschlang. Einer Schätzung von Peter Gatrell zufolge kostete der Krieg 1916, gemessen am heutigen Preisniveau, etwa 40 Millionen Rubel pro Tag.105 Das war Spiegelbild und Ursache einer galoppierenden Inflation, bei der zwischen 1914 und 1916 die Löhne sich verdoppelten, die Preise aber verdreifachten.
Die Kriegskosten wollte man durch Inlands- und Auslandsanleihen, durch direkte und indirekte Steuern, durch den Verbot von Tauschgeschäften mit Gold und durch den Druck von Banknoten auffangen (die zirkulierende Geldmenge stieg von 1,53 Millionen Rubel am 1. Juli 1914 auf 17,175 Millionen Rubel am 1. Oktober 1917).106 1916 betrug das Haushaltsdefizit 78 Prozent.107 Nach jahrzehntelangen Diskussionen wurde endlich eine Einkommenssteuer eingeführt, was bedeutete, dass auch ein privilegierter Status nicht mehr zur Steuerbefreiung führte.108 Seeblockaden der gegnerischen Mächte in Ostsee und Schwarzem Meer führten 1915 zu einem Rückgang der Exporte um 75 Prozent, während die Einfuhr militärischer Güter ungeahnte Höhen erreichte. Die Franzosen unterstützten Russland mit 1,5 Milliarden Rubel in Anleihen, und die Engländer sogar mit 5,4 Milliarden, verlangten aber 2 Milliarden Rubel in Goldbarren als Sicherheit und bestanden darauf, dass die russische Regierung für 1,8 Milliarden Rubel britische Schatzverschreibungen erwarb. Dadurch wuchs Russlands Schuldenlast zwischen 1914 und 1917 um das Doppelte und stieg auf insgesamt 8 Millionen Goldrubel.109 Bemühungen, die Bevölkerung zur Zeichnung von Kriegsanleihen zu bewegen, waren nur teilweise erfolgreich: Die Bauern zogen es vor, Bargeld zu sparen, und die Arbeiter erhoben Einwände, wenn Beiträge zu Kriegsanleihen ihnen automatisch vom Lohn abgezogen wurden. Die Zukunft würde massive Probleme bereithalten, weil der Boom der Kriegswirtschaft durch die Inflation angeheizt wurde: Die Geldausgabe betrug das Fünf- bis Sechsfache des Vorkriegsniveaus, während es in Frankreich das Doppelte und in Deutschland das Dreifache betrug, in Großbritannien jedoch unverändert blieb.
Zwar konnte die Wirtschaft die Bedürfnisse der Streitkräfte befriedigen, doch wurden damit Konsumtion und Investition wertvolle Ressourcen entzogen. 1916, als sich die Industrie auf die Produktion für Heer und Marine konzentrierte, lag der Bruttowert der Konsumgüterproduktion 15 Prozent unter dem von 1913, und gegen Ende 1916 wurden die Konsumgüter im ganzen Land bedrohlich knapp. In den Großstädten kam es zu Engpässen in der Getreideversorgung. Die Preise explodierten, und im Februar 1917 war die Kaufkraft des Rubels auf etwa 30 Prozent seines Vorkriegswerts gefallen.110 Eine erhebliche Ursache für die Güterknappheit war die krisenhafte Entwicklung des Transportwesens, die sich im Laufe des Jahres 1917 zur Katastrophe ausweitete. Die Eisenbahnen hatten weder das erforderliche Schienennetz noch die benötigten Waggons, um die Zivilbevölkerung mit den dringend benötigten Gütern zu versorgen. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes hatte ursprünglich auch dazu dienen sollen, Getreide aus der Südukraine und den südlichen Steppengebieten Russlands zum Export ans Schwarze Meer zu bringen, während es jetzt die im Norden und Osten liegenden Hauptfrontlinien versorgen musste.
Es ist schon erstaunlich, dass die Getreideversorgung nun zur Achillesferse der russischen Wirtschaft geriet, während 1913 die Exporte 30 Prozent des Weltgetreidehandels ausmachten. Die Blockade der Schwarzmeer- und Ostseehäfen durch die Zentralmächte setzte dem Export ein Ende, womit eigentlich genug Getreide für die Streitkräfte wie auch für die Zivilbevölkerung hätte vorhanden sein müssen. Auch waren die Ernten nicht schlechter als sonst: Die von 1915 war gut, die von 1916 mittelmäßig.111 Für die Regierung bestand die Priorität in der Versorgung der Streitkräfte, doch hatten die diversen Behörden wenig Vertrauen in die Fähigkeit des freien Marktes, Streitkräfte und Zivilbevölkerung gleichermaßen zu beliefern. Daraus entwickelten sich Konflikte zwischen der Stawka, den Ministerien und den Semstwos, die sich um Beschaffungsmaßnahmen und Preisbildung drehten. Im August 1915 führte der neugegründete Sonderrat für die Lebensmittelversorgung Festpreise für Lieferungen an das Militär ein. Das sei, so wurde konstatiert, die beste Methode, um „die Konsumenten vor überhöhten Preisen zu schützen“. Die Lieferungen an die Streitkräfte verzerrten den Markt, weil zunehmender Bedarf künstliche Knappheit erzeugte und die Preise in die Höhe trieb.
Als über den Getreidetransport aus frontnahen Provinzen ein Embargo verhängt wurde, stärkte das die Macht der lokalen Regierungen in diesen Gebieten, und Rationierungen vor Ort trugen zu einer weiteren Fragmentierung dessen bei, was eigentlich als zentralisiertes Lieferungs- und Versorgungssystem gedacht war. Schon im Februar 1915 gestattete die Regierung das Requirieren von Gütern, „sofern diese auf dem Markt nur eingeschränkt verfügbar sind“ – ein Phänomen, für das Kaufleute verantwortlich gemacht wurden, die Vorräte in Erwartung höherer Preise zurückhielten. Dennoch vertrauten die mit dem Ankauf von Getreide beauftragten Sonderkommissionen, die es anfänglich direkt von den Produzenten erworben hatten, im Juli 1916 auf eben jene Mittelsmänner, bei denen sie nun 50 Prozent des Getreidebedarfs der Streitkräfte kauften (verglichen mit 18 Prozent von Grundbesitzern, 15 Prozent von Bauern und 17 Prozent von Kooperativen).112
Da nun zugleich Getreide zu Festpreisen und auf dem freien Markt gekauft werden konnte, war das ein Anreiz zum Horten, weshalb im September 1916 Festpreise für Getreide und Mehl für die gesamte Bevölkerung eingeführt wurden. Im Dezember 1916 gab es ein voll entwickeltes System der Getreiderequirierung – ein Vorgeschmack auf das von den Bolschewiki Ende 1918 institutionalisierte Nahrungsmittelmonopol. Die Provinzen bekamen Quoten an Getreidemengen zugewiesen, die sie erfüllen mussten. In der Praxis konnte das System allerdings gar nicht funktionieren, weil die Transportmittel in schlechtem Zustand und die Semstwos zur Kooperation nicht bereit waren. Nach der Februarrevolution tat deshalb die Provisorische Regierung den nächsten logischen Schritt und führte ein staatliches Monopol auf Getreide ein.
Der Einfluss des Kriegs auf die Landwirtschaft war von Region zu Region verschieden. Der Einzug zum Militär und dessen Bedarf an Zugpferden war für all jene Regionen von Nachteil, wo, wie in der Südukraine, an der unteren Wolga und im Nordkaukasus, die kommerzielle Getreideproduktion intensiv betrieben wurde. Zudem waren Großbetriebe vom Arbeitskräftemangel schwerer betroffen als bäuerliche Pachtgüter.113 In Gebieten, wo vorwiegend Landwirtschaft für den Eigenbedarf betrieben wurde, wie in der zentralen Schwarzerderegion und in nördlichen Teilen der Ukraine, blieb die Produktion auf normalem Niveau, weil die Arbeitskraft von Männern durch die von Frauen und Jugendlichen ersetzt wurde. Zudem handelte es sich hierbei um übervölkerte Gebiete, wo die Arbeitskraft nicht ausgenutzt worden war. Im Gegensatz dazu konnten in Sibirien Freibauern trotz der Knappheit an Arbeitskräften und Gerätschaft den Bestand an kultivierten Flächen ebenso mehren wie Erträge aus Ernten und Nutzviehhaltung; auch die Handwerksproduktion wurde gesteigert.114
Nach dem ersten Kriegsjahr konzentrierte sich die Lieferung von Landwirtschaftsprodukten auf Sibirien, was das Transportwesen weiter unter Druck setzte. Das hauptsächliche Problem war jedoch, dass die Festpreise für Getreide den Bauern nur wenig Anreize boten, ihre Erzeugnisse zu vermarkten; stattdessen aßen sie besser, verfütterten mehr Getreide an das Vieh oder brannten Schnaps. Zudem wurde es für sie immer schwieriger, die Einkünfte aus dem Getreideverkauf zum Kauf von Fertigprodukten wie Textilien, Kerosin, Streichhölzern, Salz, Fleisch oder Zucker zu verwenden. Bauern tätigten substantielle Einlagen bei Sparkassen, obwohl schon bald die Angst vor einer Inflation um sich griff. Als sich die Lebensmittelknappheit im Winter 1916 dramatisch zuspitzte, wurde die Regierung dafür verantwortlich gemacht. Zweifellos hätte sie einiges besser machen können, aber die Probleme waren grundlegend strukturspezifischer Provenienz, und weder die Provisorische Regierung noch die Bolschewiki wurden später besser damit fertig.
Wenn man die erheblichen regionalen Unterschiede vernachlässigt, nahm, verglichen mit dem Vorkriegsniveau, der Lebensstandard der Landbevölkerung zu: Das Einkommen stieg im Durchschnitt um 18 Prozent. Doch selbst in einer sehr wohlhabenden Region wie dem Altai stieg während des Kriegs der Anteil der Haushalte ohne eingesätes Land von 3,2 auf 10,6 Prozent, und in Westsibirien verfügten 1917 fünf bis sechs Prozent der Haushalte nicht über Nutzvieh.115 Anders gesagt, nahmen Ungleichheiten innerhalb der Landbevölkerung auch dort zu, wo der durchschnittliche Lebensstandard stieg. In der Provinz Charkow wiederum scheint der durchschnittliche Standard, wenn man Einkommen aus Pacht und Handwerk betrachtet, eher zurückgegangen zu sein. Dort stieg die Anzahl der Haushalte ohne Landbewirtschaftung von 14 auf 22, und die Anzahl der Haushalte, die 4,4 Hektar (drei Desjatinen) oder weniger bewirtschafteten, um mehr als 50 Prozent.116
In Charkow wie in vielen anderen Gebieten waren es jetzt die Frauen, die den Hof führten und bei den Protesten in vorderster Front standen. Sie hatten viele Gründe für Beschwerden bei den Behörden: die Requirierung von Nutzvieh und Futter für das Heer, Steuern, Landvermessung (die Bemühungen zur Umsetzung der stolypinschen Reformen gingen immer noch weiter), und nicht zuletzt die steigenden Lebensunterhaltskosten.117 Frauen und Witwen von Soldaten waren besonders militant; sie erhielten Unterhaltszahlungen von der Regierung, doch die konnten mit der Inflation nicht Schritt halten. 1916 gab es auf dem Land an die 300 Vorfälle von Unruhen, von denen die meisten durch Truppen niedergeschlagen wurden. Das war zwar nicht das Niveau der Militanz von 1905, doch zeigte sich daran, dass die Ruhe auf dem Lande, die mit den Jahren der Reaktion eingesetzt hatte, zu Ende ging.118
Insgesamt wurden etwa 20 Prozent der Arbeitskräfte des Reichs zur Armee eingezogen.119 Anfänglich zog man unterschiedslos Facharbeiter ein und nahm insbesondere jene revolutionären Aktivisten ins Visier, die sich im Juli 1914 an den aufrührerischen Ereignissen in der Hauptstadt beteiligt hatten. Doch schon bald kam es bei der Waffenproduktion zu einer Verknappung von Facharbeitern, was die Löhne nach oben trieb, sodass einige der eingezogenen Facharbeiter unter militärischer Aufsicht zur Arbeit in die Rüstungsfabriken geschickt wurden. Die Massenproduktion dort führte auch zu einer Erhöhung des Anteils von ungelernten Arbeitskräften – Frauen und Bauern – wodurch sich der Prozentsatz von Arbeitern und Arbeiterinnen mit Bindung an das Land auf 60 Prozent der Gesamtarbeitskräfte erhöhte.120 Nun wurden Frauen in weit größerem Umfang als Fabrikarbeiterinnen eingestellt als vor dem Krieg, und nicht nur das: Wie in allen kriegführenden Ländern drangen sie zum ersten Mal in männliche Reservate auf dem Arbeitsmarkt ein. So gab es bei der Eisenbahn jetzt Lokomotivführerinnen und Heizerinnen, und auch das Reinigungspersonal wurde von Frauen gestellt. Die zunehmende Sichtbarkeit von Frauen als Arbeiterinnen in männlichen Berufen rief Diskussionen über konventionelle Geschlechterrollen und Ängste bezüglich weiblicher Sexualität hervor.
Anfänglich stiegen die Reallöhne, doch ab 1916 machte dem die Inflation den Garaus. In der mittlerweile in Petrograd umbenannten Hauptstadt (was weniger deutsch klang), gab es einen hohen Anteil an Facharbeitern für Maschinenbau und Metalltechnik, deren Durchschnittslöhne mittlerweile auf 70 bis 75 Prozent ihres Vorkriegsniveaus gefallen waren.
In Moskau – wo Textilarbeiterinnen vorherrschten – waren die Reallöhne im Februar 1917 auf 60 bis 65 Prozent des Vorkriegsniveaus gefallen. Im Uralgebiet, dem dritten großen Zentrum der Kriegsproduktion, fielen die Reallöhne im Durchschnitt um die Hälfte.121
Im Winter 1916 erlitten die Städte, die Industrieregionen und die getreidearmen Provinzen eine bedrohliche Getreideknappheit. Sie hatte zwar strukturelle Ursachen, wurde aber der durch die Requirierungspolitik der Regierung begünstigten Profitmacherei zur Last gelegt. Selbst die Kadetten, die von allen politischen Parteien der freien Marktwirtschaft am gewogensten waren, erklärten am 2. März 1917: „Jeder Händler soll seine Lager öffnen und darauf vertrauen, dass es dann nichts mehr von jener Korruption und Erpressung gibt, die einige ungestraft davonkommen ließ und anderen unerträgliche Steuern aufbürdete.“122 Zu den hässlicheren Erscheinungsformen der Proteste seitens der Bevölkerung gehörten gewalttätige Übergriffe auf Ladeninhaber, Händler und angebliche (oder tatsächliche) Hamsterer. Häufig waren diese Angriffe antisemitisch motiviert, manchmal kam es zu Tötungen. Schon am 12. April 1915 wies das Innenministerium die Provinzgouverneure warnend darauf hin, dass es in den „ärmsten Schichten der Bevölkerung“ zu Unruhen komme, weil die Versorgung in bestimmten Gebieten nicht hinreichend gewährleistet sei.123 1915 gab es in einigen Ortschaften und Industrieansiedlungen 23 Vorfälle von „Unruhen auf Märkten oder sonst wegen Lebensmitteln“, die aber bis 1916 auf 288 anstiegen. In Polizeiberichten wurden Soldatenfrauen und Jugendliche als Anführer dieser Protestaktionen bezeichnet.124 Die Frauen bestanden darauf, dass ihnen als Ehefrauen der Männer, die für das Vaterland kämpften, Pensionen und faire Preise zustanden; zudem forderten sie Maßnahmen gegen die Spekulation.125 Alle diese Unruhen entstanden aus dem Zorn darüber, dass die Kriegslasten so ungerecht verteilt waren. In zunehmendem Maße waren auch Äußerungen zu hören, die sich gegen den Krieg selbst richteten: „Sie schlachten unsere Männer und Söhne im Krieg ab, und in der Heimat wollen sie uns zu Tode hungern lassen.“126
Mit dem Ausbruch des Kriegs brach die Militanz der Arbeiterschaft zusammen. Doch im Verlauf der Jahre 1915 und (insbesondere) 1916 gab es in Russland ein Ausmaß an Streikaktivität wie in keinem anderen kriegführenden Land; zudem hatten die Streiks häufig eine äußerst politische Note. 1915 gab es 1928 Streiks, 1916 waren es 2417, an denen sich über 1,5 Millionen Arbeiter beteiligten. Im Januar/Februar 1917 gab es 718 Arbeitsniederlegungen mit 548.300 Streikenden.127 Allerdings kam dies auch nicht im Entferntesten an das Niveau von 1905 heran, insbesondere die Eisenbahnarbeiter zeigten nichts von ihrer damaligen Militanz. Zudem konzentrierten sich die Streiks auf Petrograd und Moskau, wohingegen die Arbeiter im Baltikum, in Weißrussland und im Kaukasus weniger kämpferisch waren als ein Jahrzehnt zuvor (und Polen stand unter deutscher Besatzung). In staatlichen Rüstungsbetrieben waren die Arbeitsniederlegungen weniger häufig als in Privatfirmen, mit Ausnahme von Petrograd.
Mit Besorgnis sah die Politik die Zunahme politisch motivierter Streiks im Jahr 1916, besonders nachdem im August 1915 die Sitzungen der Duma vertagt worden waren. Etwa ein Viertel der 1916 in den Streik tretenden Arbeiter tat dies aus politischen Gründen.128 Der Anteil war in der Hauptstadt besonders hoch; hier beklagte die Ochrana die „äußerst negative Haltung zur Regierung und … zur Fortsetzung des Kriegs“.129 In den Petrograder Putilow-Rüstungsbetrieben war die Anzahl der Arbeitskräfte 1917 auf 29.300 gestiegen. Als sie im Februar 1916 in den Streik gingen, wurden sie ausgesperrt; 100 Arbeiter wurden verhaftet und 2000 zum Militär eingezogen. Das Gleiche geschah nach einem Streik im November, als 5000 Soldaten vom Tarutinski-Regiment als Streikbrecher eingesetzt wurden.130 Vor allem die Stadtbevölkerung litt unter der ständig mangelhafter werdenden Versorgung mit Brennstoffen und Lebensmitteln. Daraus erwuchs ein Zorn, der zur Triebkraft der politischen Streiks und Demonstrationen wurde, die nach Vertagung der Duma am 16. Dezember 1916 und ihrer erneuten Vertagung am 9. Januar 1917, dem 12. Jahrestag des Petersburger Blutsonntags, aufflammten. Die Arbeitergruppe des Kriegsindustriekomitees spielte bei diesen Streiks eine zentrale Rolle, während revolutionäre Aktivisten vor allem die Arbeiter vor Ort mobilisierten.131
Der Krieg hatte die sozialistischen Parteien in Gegner, die sogenannten Internationalisten, und (widerstrebende) Befürworter, die sogenannten Defensisten, gespalten, wobei die Bolschewiki davon weniger hart getroffen waren als die Sozialrevolutionäre und die Menschewiki. Allerdings waren in lokalen Zusammenhängen nur wenige Bolschewiki bereit, Lenins Aufforderung, den imperialistischen in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, zu folgen. In der zweiten Hälfte des Jahres 1914 waren die Bolschewiki durch Verhaftungen und Einberufungen dezimiert. Ab 1916 fassten sie wieder Fuß, doch am Vorabend der Februarrevolution gab es im Land vielleicht nicht mehr als 12.000 Bolschewiki.132 Im Verlauf der Jahre 1915/16 kamen auch weitere internationalistische Gruppierungen (Sozialrevolutionäre, die Meschrajonzy in der Hauptstadt und die menschewistischen Internationalisten) wieder zu Kräften und nahmen immer mehr Einfluss auf die Agitation gegen den Krieg.133
Die starke Zunahme von Arbeiterkämpfen lässt vermuten, dass Millionen von Arbeitern revolutionär gestimmt waren, aber die Internationalisten räumten ein, dass sich die Stimmung genauer als „revolutionär-defensistisch“ beschreiben lasse. „Revolutionär“ war sie insofern, als große Teile der Arbeiterschaft der Autokratie und den Kriegsprofiteuren höchst feindselig gesonnen waren; „defensistisch“ indes, weil kein Bedürfnis bestand, die russischen Armeen im Kampf gegen Deutschland untergehen zu sehen, auch wenn sie das Ende des Kriegs verzweifelt herbeisehnten. Das war in etwa die von der Arbeitergruppe des Kriegsindustriekomitees vertretene Position; die Gruppe bestand zum Großteil aus defensistischen Menschewiki. Sie unterstützten den Krieg weitgehend, doch als A. I. Gutschkow, der Vorsitzende des Komitees, die Arbeitergruppe um Unterstützung bei der Bewahrung des „sozialen Friedens“ bat, erhielt er die Antwort: „Es ist schwierig, über die Bewahrung von etwas zu reden, was es nicht gibt und nie gegeben hat.“134 Zusammen mit den von ihr unterstützten Gewerkschaften und Stiftungen zur Gesundheitsförderung sollte die Arbeitergruppe im Zentrum der Führerschaft stehen, als das Land der Revolution entgegentaumelte.
Am 1. November 1916 ritt Pawel Miljukow, der Führer der Kadetten, einen unerhörten Angriff auf die Regierung, in dem er „dunkle Mächte“ anklagte und, indem er eine Reihe von schweren Fehlern der Regierung auflistete, fragte: „Ist das Dummheit oder Verrat?“ Die schamlose Einmischung von Grigori Rasputin in die Politik war zur Zündschnur für den Ausbruch von Enttäuschung geworden, mit dem die politische Elite auf die Inkompetenz der Regierung reagierte. In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember heckte Fürst Felix Jussupow, Spross einer der ältesten Familien Russlands, mit Großherzog Dmitri und mit Wladimir Purischkewitsch, einem der Gründer der „Schwarzen Hundert“, einen Plan zur Ermordung von Rasputin aus. Später schrieb er einen blumigen Bericht über ihre Bemühung, die alte Ordnung zu retten, indem man sich Rasputins entledigte.
„Das Gift wollte einfach nicht wirken, und der Starez [der ‚heilige Mann’] durchschritt weiterhin ruhig den Raum … Ich zielte auf sein Herz und betätigte den Abzug. Rasputin stieß einen wilden Schrei aus und sackte auf dem Bärenfell zusammen … Es gab keinen Zweifel: Rasputin war tot. Dmitri und Purischkewitsch hoben ihn auf und legten ihn auf die Steinfliesen. Wir machten das Licht aus und gingen nach oben in mein Zimmer, nachdem wir die Tür zum Kellergeschoss geschlossen hatten … Wir sprachen über die Zukunft unseres Landes, nachdem es ein für alle Mal vom bösen Geist befreit worden war … Als wir so sprachen, befiel mich auf einmal ein vages, ungutes Gefühl und ein unwiderstehlicher Drang trieb mich ins Kellergeschoss. Rasputin lag noch genau dort, wo wir ihn hingelegt hatten. Ich fühlte ihm den Puls: Nichts war zu spüren, er war tot … Ganz plötzlich bemerkte ich, wie sich sein linkes Auge öffnete. Wenige Sekunden später begann sein rechtes Lid zu zucken, dann öffnete es sich ebenfalls. Ich sah, wie mich die grünen Augen einer Viper mit teuflischem Hass anstarrten … Dann geschah etwas Schreckliches: Mit einer plötzlichen gewaltsamen Anstrengung sprang Rasputin auf, Schaum vor dem Mund … Er lief auf mich zu, versuchte, mich an der Kehle zu packen, und bohrte seine Finger wie Stahlklauen in meine Schulter.“135
Allerdings schien die Ermordung Rasputins durch Angehörige des Zarenhofs kaum Einfluss auf die Gleichmut Nikolaus’ II. gehabt zu haben. Als im Januar 1917 der britische Botschafter, Sir George Buchanan, ihn fragte, wie er denn das Vertrauen seiner Untertanen zurückzugewinnen gedenke, antwortete Nikolaus:
„Meinen Sie etwa, Ich müsse das Vertrauen Meines Volkes wiedergewinnen, oder Mein Volk habe Mein Vetrauen wiederzugewinnen?“